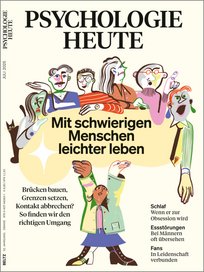Herr Professor Nisbett, psychologische Studien über unser Alltagsdenken haben wenig Schmeichelhaftes ergeben. Wir scheinen Fehler über Fehler zu machen. Sind wir dümmer, als wir glauben?
Wir irren uns häufig, sollten uns deshalb aber keine Sorgen machen. Schließlich begehen alle Menschen dieselben Denkfehler, auch wir Psychologen. Ich würde deshalb nicht sagen, dass die Leute dumm sind. Denn in vielen Situationen gibt es ja Werkzeuge, die uns helfen, weniger oft danebenzuliegen. Manchmal genügt schon ein…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
Situationen gibt es ja Werkzeuge, die uns helfen, weniger oft danebenzuliegen. Manchmal genügt schon ein wenig Statistik – und zwar auf einem Niveau, das jeder verstehen und lernen kann.
Was meinen Sie mit „Statistik“? Reden wir jetzt über komplizierte Formeln?
Nein, nein. Viele Menschen verwenden die Regeln der Statistik ja ganz automatisch. Sportfans haben zum Beispiel ein gutes Gespür dafür. Sie wissen, dass man einen Spieler nicht vorschnell beurteilen sollte. Schließlich erwischt jeder mal einen guten oder schlechten Tag. Man muss also mehrere Matches beobachten, um sich ein korrektes Bild zu machen. Ob man einen Spieler in sein Team aufnimmt oder nicht– diese Entscheidung würde kein Trainer treffen, der den Athleten lediglich eine halbe Stunde lang beim Training beobachtet hat.
Man braucht eine größere Stichprobe?
Richtig. Man spricht auch vom „Gesetz der großen Zahl“ – je mehr Beobachtungen wir haben, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Das versteht jeder. Allerdings scheitern wir im Alltag verblüffend oft daran, diese Regel anzuwenden. Manche Leute glauben zum Beispiel, dass ein 30-minütiges Vorstellungsgespräch genügt, um einen Bewerber einschätzen zu können. Dieselben Menschen, die so ein Vorgehen bei einem Sportler ablehnen, würden es im Geschäftsleben unwidersprochen akzeptieren. Aus statistischer Sicht ist jedoch klar, dass so eine kurze Begegnung fast gar nichts darüber aussagt, ob ein Bewerber geeignet ist oder nicht. Die Stichprobe ist viel zu klein.
Im Allgemeinen scheint es uns schwerzufallen, Statistik im Alltag korrekt anzuwenden. Sie selbst haben dazu einige Studien durchgeführt. Das Ergebnis war immer dasselbe: Eine konkrete Geschichte, eine Anekdote oder ein persönliches Gespräch beeinflussen uns stärker als jede Statistik.
Das stimmt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In den USA werden Universitätsseminare von den Studenten benotet. Diese Werte sind ziemlich aussagekräftig. Aber wir haben herausgefunden, dass die Studenten jüngeren Semesters sich kaum darum kümmern. Wenn dagegen ein älterer Kommilitone ihnen erzählt: „Ich war in diesem Kurs, der war richtig toll“, dann reagieren die jüngeren Studenten sofort und lassen sich sehr stark davon beeinflussen. Anders gesagt: Die zufällige Meinung eines Einzelnen scheint für uns wichtiger zu sein als das ausgewogene Urteil vieler. Dieses Muster haben wir immer wieder gefunden. In einem anderen Experiment ging es darum, wie viele Menschen sich in einer bestimmten Situation als hilfsbereit erweisen. Der Prozentsatz war übrigens nicht besonders hoch. Nur vier von zehn Probanden haben geholfen. Diese Zahlen haben wir unseren Versuchspersonen vorgelegt, ihnen danach wildfremde Menschen gezeigt und gefragt: Was meint ihr – werden diese Leute helfen oder nicht?
Klingt nach einer leichten Aufgabe: Wenn die Statistik stimmt, dann werden vier von zehn Leuten helfen – und sechs eben nicht.
Aber unsere Probanden haben vollkommen anders entschieden. Sie haben sich eher davon leiten lassen, wie sympathisch ihnen die gezeigten Personen waren. Sie haben die wichtigste Information, die sogenannte „Basisrate“, kaum mit in ihr Urteil einbezogen.
In Ihrem Buch Einfach denken! beschreiben Sie nicht nur Konzepte aus der Psychologie. Einige Ihrer Werkzeuge haben Sie zum Beispiel von den Ökonomen übernommen. Etwa das Modell der „versunkenen Kosten“. Das kommt etwa dann zum Tragen, wenn wir im Restaurant sitzen und das Essen nicht mögen, das uns serviert wurde.
Die meisten Menschen sagen in so einer Situation: „Ich habe für diesen Fisch bezahlt, deshalb werde ich ihn auch aufessen.“ Ich halte das für einen Fehler.
Geben Sie uns bitte eine Faustregel – wie kann uns das Konzept der versunkenen Kosten zu besseren Entscheidungen verhelfen?
Ich empfehle ein Gedankenexperiment. Und zwar immer dann, wenn Sie etwas machen, das Ihnen keinerlei Freude bereitet, für das Sie aber schon Geld, Zeit oder Mühe aufgewendet haben. Fragen Sie sich: Würde ich das hier auch dann tun, wenn ich nichts dafür gezahlt hätte? Und wenn die ehrliche Antwort lautet: „Nein, das würde ich nicht“, dann sollten Sie schnell damit aufhören und stattdessen etwas anderes tun.
Wie häufig kommt so etwas denn vor?
Ziemlich häufig. Ich habe auf mein Buch eine Menge Zuschriften bekommen – und die meisten bezogen sich auf das Konzept der versunkenen Kosten. Die Leute schreiben: „Diese Art zu denken hat mein Leben verändert.“ Nach meiner Erfahrung gehören die Ökonomen und der Rest der Menschheit in solchen Fragen zu zwei verschiedenen Spezies. Ökonomen essen kein schlechtes Essen. Sie sehen sich keine schlechten Filme zu Ende an. Sie arbeiten nicht weiter an miesen Projekten, auch wenn sie schon viel Zeit damit verloren haben. Sie leben nach dem Motto: Der Rest meines Lebens beginnt genau jetzt. Und das halte ich für ausgesprochen vernünftig.
Ein weiteres Denkprinzip aus der Ökonomie ist das Konzept der „Opportunitätskosten“. Vereinfacht gesagt lautet es: Wenn ich eine Sache tue, kann ich zur selben Zeit alles andere nicht tun. Die Frage nach den Opportunitätskosten lautet in diesem Fall: Habe ich meine Zeit richtig und vernünftig investiert – oder hätte ich stattdessen lieber etwas anderes tun sollen?
Die meisten Menschen denken nicht auf diese Art, es widerspricht einfach ihrem Bauchgefühl. Meine Mutter ist früher durch die halbe Stadt gefahren, um einen Zwei-Dollar-Gutschein für Waschmittel einzulösen. Und auch ich habe so einen Fehler begangen. Vor vielen Jahren haben meine Frau und ich ein Ferienhaus gekauft, was uns ans absolute Limit unserer finanziellen Möglichkeiten gebracht hat. Wir hatten also kein Geld mehr für die Inneneinrichtung. Da kam mir eine Idee: Ich könnte die Möbel ja einfach selbst schreinern!
Klingt vernünftig.
Ich habe dann also diesen Kurs besucht. Und nach sage und schreibe fünfzehn Unterrichtsstunden hatte ich nichts fertiggebracht als einen kleinen Holzkasten. Spätestens da wurde mir klar: So wird das nichts – ich bin einfach kein guter Handwerker. Die Opportunitätskosten waren deshalb enorm. So viel Zeit für so ein winziges Stück! Es wäre viel klüger, erstmal auf dem Fußboden zu schlafen und zu warten, bis wieder ein bisschen Geld reinkommt.
In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass Sie im Alltag die Kraft des unbewussten Denkens nutzen. Wie funktioniert das?
Ich mache das zum Beispiel, wenn ich meinen Unterricht vorbereite. Dafür schicke ich meinen Studenten immer vorab eine kleine Liste mit Fragen, die sie zum Nachdenken anregen sollen. Wenn ich mir diese Fragen ausdenke, verfahre ich so: Ich beschäftige mich eine Weile mit dem Stoff und lasse die Sache danach liegen, ohne sie beendet zu haben. Wenn ich mich dann ein oder zwei Tage später wieder an die Arbeit mache, kommen die Ideen wie von selbst. Es fühlt sich an, als würden mir die Sätze diktiert, als müsste ich sie mir gar nicht mühevoll ausdenken.
Bringen Sie diese Technik auch Ihren Studenten bei?
Ich versuche es. Ich sage: Fangt früh an mit euren Hausarbeiten. Am besten schon ein paar Wochen vor der Deadline. Das Unbewusste wird euch weite Teile der Arbeit abnehmen. Aber die meisten von ihnen kaufen es mir nicht ab. Sie warten bis kurz vor Abgabe, und dann machen sie alles auf den letzten Drücker.
In Ihrem Buch gibt es auch ein Kapitel, das sich mit den Denkfehlern von Wissenschaftlern beschäftigt. Sie werfen Ihren Kollegen vor, gelegentlich die falschen Methoden anzuwenden. Worum geht es da genau?
Um die Arbeit mit Korrelationen. Meiner Meinung nach haben viele Leute die Zusammenhänge nicht richtig verstanden. Das gilt auch für einige Wissenschaftler und Journalisten, die es eigentlich besser wissen sollten. Ein wenig Wissen über die Zusammenhänge könnte jeden von uns zu einem besseren Zeitungsleser machen.
Geben Sie uns ein Beispiel!
Vor einiger Zeit konnte man lesen: Menschen, die zusätzlich ein bestimmtes Vitamin schlucken, erkranken mit geringerer Wahrscheinlichkeit an Prostatakrebs.
Klingt wie eine gute Nachricht.
Nein. Dieses Ergebnis hat nicht den geringsten Wert, nicht die geringste Aussagekraft. Denn wenn man im Labor untersucht, wie besagtes Vitamin eigentlich auf unseren Körper wirkt, dann stellt man fest, dass es Prostatakrebs sogar begünstigen kann.
Die Studien scheinen einander zu widersprechen. Woran liegt das?
An einem Phänomen, das die Epidemiologen den healthy user bias nennen. Manche Leute nehmen Vitamine, weil sie glauben, das sei gut für ihre Gesundheit. Aber sie tun auch sonst eine Menge für ihr Wohlbefinden. Sie informieren sich, sie sind gebildet, sie verdienen gut, treiben Sport, ernähren sich ausgewogen, rauchen nicht, trinken nicht zu viel Alkohol und so weiter. Und natürlich kriegen diese Leute auch seltener Krebs. Das heißt: Wer Vitamine zu sich nimmt, bekommt tatsächlich seltener Krebs. Aber mit den Vitaminen selbst hat es gar nichts zu tun.
Diese wissenschaftliche Methode, die Sie kritisieren, heißt in der Fachsprache „multiple Regressionsanalyse“. Sie haben kürzlich in einem Interview gefordert, man solle solche Untersuchungen nur noch mit einem Warnhinweis veröffentlichen.
Das fordere ich in der Tat. Und es gibt viele solcher Studien – nicht nur in der Medizin, auch in den Sozialwissenschaften. Eine davon hat behauptet: Ein Volvo-Kombi ist nach den vorliegenden Daten sicherer als ein Ford-Pick-up, weil der Volvo statistisch gesehen seltener in Unfälle verwickelt ist. In Wahrheit hat das natürlich gar nichts mit dem Auto selbst zu tun, sondern damit, dass der Volvo vor allem von Familien aus der Vorstadt gefahren wird – und der Pritschenwagen von Cowboys mit einer Knarre auf dem Beifahrersitz.
In Ihrem Buch ermutigen Sie Ihre Leser dazu, auch im Privatleben Experimente nach wissenschaftlichen Standards zu machen. Wie geht das?
Angenommen, Sie leiden unter Sodbrennen. Dann können Sie selbst herausfinden, ob es am Kaffee liegt oder am Weißwein oder am scharfen Essen. Mein Rat lautet: Nehmen Sie sich die Hypothese, die Ihnen am wahrscheinlichsten vorkommt. Beispielsweise den Kaffee. Was passiert, wenn Sie ihn weglassen? Werden die Beschwerden dann besser?
Ein wissenschaftliches Experiment arbeitet ja möglichst mit einer Kontrollgruppe. Man wirft eine Münze und ordnet seine Versuchspersonen per Zufall in zwei Gruppen. Man sagt: Die eine Hälfte lässt den Kaffee weg, die andere macht weiter wie bisher. Nach einiger Zeit schaut man sich dann die Unterschiede an. So bekommt man das, was man eine „randomisierte kontrollierte Studie“ nennt. Wie kann ich das auf unser Beispiel mit dem Sodbrennen übertragen?
Na ja, wie Sie schon sagten: Indem Sie eine Münze werfen. Sie entscheiden per Zufall, ob Sie in der kommenden Woche den Kaffee weglassen oder einfach weitermachen wie bisher. Das steigert die Aussagekraft Ihres Experiments ganz erheblich. Denn wenn Sie stattdessen nach Lust und Laune entscheiden, ob Sie heute Kaffee trinken oder nicht, kommen noch ganz viele andere Faktoren mit ins Spiel, die Sie gar nicht untersuchen wollten. Sie werden den Kaffee trinken, wenn Sie sich morgens ein bisschen schlapp fühlen. Das wiederum könnte damit zusammenhängen, was Sie am Abend zuvor so getrieben haben – und so weiter. Der Münzwurf sorgt also für eine größere Genauigkeit.
Welche Ihrer eigenen Alltagsprobleme haben Sie mit Experimenten untersucht?
Ich gebe zu: Ich selbst mache das viel seltener, als ich sollte. Trotzdem habe ich ein Beispiel für Sie. Als junger Student habe ich sehr unter Schlafstörungen gelitten. Also habe ich irgendwann Experimente darüber gemacht.
Davon habe ich gelesen. Sie haben Leuten Placebos gegeben und behauptet, dass die Tabletten den Herzschlag erhöhen. Wenn Probanden dann nachts wach wurden, haben sie das nicht auf ihre Sorgen geschoben, sondern eben auf die angeblichen Medikamente. Statt also ins Grübeln zu verfallen, konnten sie sich einfach umdrehen und weiterschlafen.
Genau. Mit meinen Probanden hat dieser Trick ganz gut geklappt. Er funktioniert, wie man inzwischen weiß, aber nur bei Leuten, die viel nachdenken. Bei schlichteren Versuchspersonen bekommt man leider kaum einen Effekt.
Und wie haben Sie selbst Ihre Schlafstörungen in den Griff bekommen?
Indem ich auf meine Mutter gehört habe (lacht). Sie hat mir damals einen Auszug aus einem Hausfrauenmagazin zugeschickt. Dort hieß es: Arbeiten Sie nicht bis kurz vor dem Einschlafen. Schlafen Sie in einem kühlen Raum. Halten Sie Ihre Füße warm. Sorgen Sie für regelmäßige Schlafzeiten. Das hat wunderbar funktioniert.
Richard Nisbett ist Professor für Sozialpsychologie an der University of Michigan. Er erforscht, wie wir unsere Denkfehler nicht nur erkennen, sondern im täglichen Gebrauch unseres Verstandes auch überwinden können.