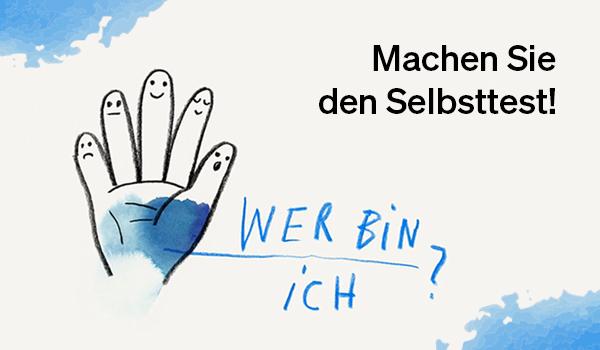In seinem Buch Die Kunst des Krieges schrieb der chinesische General und Philosoph Sunzi: „Töte einen, ängstige zehntausend.“ Nach derselben Methode verfahren Terroristen 2500 Jahre später. Nie zuvor war es so einfach wie heute, mit einer spektakulären Tat eine Unzahl von Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Vor allem das Fernsehen und Internet verbreiten Bilder und Berichte jederzeit und praktisch überall. Dabei folgt das Mediengeschäft bestimmten Regeln. „Hund beißt Mann“ ist keine Nachricht,…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
Mann“ ist keine Nachricht, „Mann beißt Hund“ dagegen schon, lautet eine alte Journalistenweisheit. Interessant ist das Ungewöhnliche. Ein weiteres Kriterium: Negatives hat einen höheren Nachrichtenwert als Positives. „Aufmerksamkeit gewinnt man vor allem durch dramatische, emotional aufwühlende Ereignisse. Daher sind Berichte über Kriege, über Krisen, über Konflikte und Katastrophen so dominant“, erklärte der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen kürzlich in einem Interview mit dem NDR.
Allerdings finden die Medien in uns auch willige Abnehmer für ihre Storys. Dabei ist es gerade bei Terrorattacken nicht (nur) Sensationsgier, die uns antreibt. „Eine intensive Berichterstattung erzeugt die Illusion, Informationen aufnehmen zu können, die für die eigene Sicherheit relevant sein könnten“, schreiben der Kriminologe Frank Robertz und der Kommunikationswissenschaftler Robert Kahr in dem von ihnen herausgegebenen Buch Die mediale Inszenierung von Amok und Terrorismus (Springer, Wiesbaden 2016). Wir kleben also vor dem Fernseh- oder Computerbildschirm, weil wir hoffen, persönlich oder als Gesellschaft weiteren Gefahren entgehen zu können, wenn wir wissen, wie die Täter vorgegangen sind und warum sie so gehandelt haben.
Symbiose zwischen Medien und Terroristen?
Experten sprechen von einer symbiotischen Beziehung zwischen Medien und Terroristen. Das heißt: Erstere profitieren von den Taten der Letzteren, die ihnen Leser und Zuschauer bringen, und Letztere bekommen die ersehnte Publicity. Die Anschläge selbst, so entsetzlich sie auch für die Opfer sind, können die Funktionsfähigkeit eines Staates nicht gefährden. Sie wirken indirekt, durch die psychologischen Folgen. Wie Bruce Hoffman von der Georgetown University in Washington D.C. in seinem vielzitierten Buch Inside Terrorism feststellt: „Beim Terrorismus geht es genauso sehr um die Androhung von Gewalt wie um die gewalttätige Handlung selbst.“ Journalisten spielen Terroristen dabei gleich zweifach in die Hände. Die Täter können mithilfe der Medien erstens Angst und Schrecken auslösen und zweitens ihre Propaganda verbreiten. „Die Verängstigung möglichst großer Teile einer Gesellschaft ist jedoch nicht das Endziel von Terrorismus, sondern vielmehr Mittel zum Zweck“, so Robertz und Kahr. Teil der Strategie sei, „die eigene Gruppe vom Rest der Gesellschaft zu entzweien“. So lassen sich Anhänger radikalisieren, so wird Nachwuchs angeworben.
Medienberichte können zur Nachahmung anstiften
Der IS beschrieb in einem seiner Onlinemagazine sein Ziel so: Noch hielten sich die meisten Muslime der Welt in einem Zwielichtbereich auf, zwischen Gut und Böse, dem Kalifat und den Ungläubigen. Nun sei die Zeit gekommen, die Welt zu spalten und den Graubereich zu zerstören. Um Anhänger zu gewinnen oder bei der Stange zu halten, schicken Terroristen außerdem Bekennerschreiben oder -videos oder stellen sie ins Netz, darauf vertrauend, dass Zeitungen und Sender diese Botschaften verbreiten. Wie die britische Zeitung The Guardian berichtete, teilten zum Beispiel Twitter-Accounts von IS-Unterstützern ein Video von der Verbrennung eines jordanischen Piloten, indem sie zur Website von Fox News verlinkten.
Je nach Art der Darstellung können sich auch weitere Personen zu ähnlichen Taten ermutigt fühlen. Ein vergleichbares Phänomen gibt es bei Selbsttötungen. Dort ist seit langem bekannt, dass Berichte unter bestimmten Bedingungen gefährdete Personen zur Nachahmung veranlassen können. Das Gleiche gilt für Schulamokläufe, vor allem wenn die Medien Taten und Täter detailreich und heroisierend (oder auch dämonisierend) beschreiben. Eine amerikanische Studie ergab, dass innerhalb der ersten zwei Wochen nach einer Tat die Wahrscheinlichkeit, dass eine weitere stattfindet, höher ist als üblich. Was für eine „Ansteckung“ spreche, vermutlich über die intensive Medienberichterstattung. Das Titelbild von Heft 31 des Spiegel von 2016 sei ein „Paradebeispiel“ für das, was Medien vermeiden sollten, so Robert Kahr. Es zeigt einen jungen Mann mit einem Kapuzensweatshirt, der mit einer Pistole durch eine geborstene Glasscheibe hindurch auf den Betrachter zielt. „Die Darstellung des Täters strahlt Macht, Stärke, Attraktivität aus. Er ist wie ein Actionheld fotografiert.“ Zwar ging es in diesem Fall um den Amoklauf eines 18-Jährigen in München und bei der erwähnten Studie um Massentötungen mit Schusswaffen. Jedoch gibt es zwischen diesen und terroristischen Taten große Ähnlichkeiten und fließende Übergänge.
Die Nachahmung, die durch Medienberichte gefördert wird, kann laut Jens Hoffmann zwei Aspekte der Tat betreffen: das Wie und das Warum. Hoffmann ist Kriminalpsychologe und leitet das Institut Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt. Auch er hat ein Kapitel zum Buch von Robertz und Kahr beigetragen. Mit dem Wie meint er den sogenannten Modus Operandi: Welche Waffen haben die Täter verwendet? Wo haben sie diese gekauft? Wie viel Schaden kann eine bestimmte Methode anrichten, etwa wenn man mit einem Fahrzeug in eine Menschenmenge rast? Beim Grund für die Handlung spricht Hoffmann von einem „scheinbaren“, also vorgeschobenen Warum. Dabei identifizieren sich gefährdete Personen mit früheren Tätern, zum Beispiel mit deren Idealen und Motiven. Diese Identifizierung wird erleichtert, wenn Medien Gewalttäter als besonders gefährlich und mächtig darstellen oder wenn sie zu Pauschalisierungen greifen wie „Mobbingopfer“, statt die Lebensumstände der Betreffenden im Detail zu erklären. In Wirklichkeit jedoch sind Allmachts- und Gewaltfantasien für potenzielle Täter ein Mittel gegen Selbstzweifel und Depressionen.
Richtlinien für die Berichterstattung
Wie können Medien über terroristische Anschläge berichten, ohne den Schaden zu vergrößern? Darauf gibt es keine einfache Antwort. Gesetzliche Verbote würden auf Zensur hinauslaufen. „Wenn die Pressefreiheit im Namen der Terrorbekämpfung geopfert wird“, schrieb dazu Paul Wilkinson, einer der führenden britischen Terrorexperten, „dann haben wir kleinen Gruppen von Terroristen erlaubt, eine der wichtigsten Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft zu zerstören.“
Machbar und vermutlich hilfreich wäre dagegen, nicht so viel und so häufig zu berichten. In der Wochenzeitung Die Zeit äußerte sich Anfang 2017 der Soziologe Ortwin Renn, Direktor des Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam, in diesem Sinne. Wenn etwas häufig thematisiert wird, etwa Terroranschläge, überschätzen wir seine Bedeutung. Um das zu veranschaulichen, nannte Renn ein Gegenbeispiel: „Auf dem Oktoberfest in München zum Beispiel, da passiert jedes Jahr etwas. Darüber wird aber in der Regel kaum berichtet. Entsprechend fühlt sich dann auch niemand unsicherer als vorher.“ Sich bei der Berichterstattung zu beschränken ist nicht so anrüchig, wie es vielleicht klingt. Medien sind bei Selbsttötungen durch Eisen- oder U-Bahn oft zurückhaltend, um nicht Nachahmer zu ermutigen. Journalisten schwiegen über die Entführungen von Kollegen durch Islamisten, um ihre Lage nicht zu verschlimmern. Sender verzichten darauf, Livebilder von einem Polizeieinsatz auszustrahlen, wenn sie dadurch Verbrecher warnen und Geiseln gefährden würden. In Fällen wie dem Letzteren rät Charlie Beckett von der Abteilung Medien und Kommunikation der London School of Economics zu Transparenz. Er war früher selbst BBC-Journalist und ist der Ansicht: Wenn man Zuschauern erklärt, warum man Informationen zurückhält, erwirbt man ihr Vertrauen.
Wie eine verantwortungsvolle Berichterstattung aussehen kann, dazu haben Robertz und Kahr in ihrem Buch einige Richtlinien formuliert. Beispielsweise sollten Journalisten Tat und Täter nicht romantisieren und zum Helden der Geschichte machen, sondern sich auf die Folgen der Tat konzentrieren. Sie sollten keine vereinfachenden Erklärungen für die Motive des Täters anbieten (zum Beispiel „Mobbingopfer“), mit denen sich viele identifizieren könnten. Wichtig ist auch die Wortwahl. Die Sprache sollte möglichst nüchtern und wenig bildhaft sein. Alexander Spencer, Politikwissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität München, rät, darauf zu achten, welche Metaphern man verwendet. Dabei denkt er speziell an Politiker und ähnliche Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Indem man einen Anschlag auf eine bestimmte Weise darstellt, kann man ihn weniger bedrohlich aussehen lassen, als es sich die Täter wünschen. Er erwähnt den britischen Generalstaatsanwalt Ken McDonald, der über die Anschläge von 2005 sagte: „London ist kein Schlachtfeld.“ Die Täter seien, anders als in ihren Videos behauptet, keine Soldaten, sondern Kriminelle.
Die Gier nach der Opfergeschichte
Schließlich sollten Journalisten bei Recherche und Berichterstattung auf Opfer und Hinterbliebene Rücksicht nehmen. Denn noch belastender als für die Allgemeinbevölkerung kann die Berichterstattung für Überlebende sowie Angehörige und Freunde der Opfer sein. Einerseits werden sie immer wieder an das Ereignis erinnert. Hinzu kommt jedoch, dass manche Reporter nicht davor zurückschrecken, die Betroffenen zu bedrängen, um an Informationen zu gelangen. Darüber schreibt Frank Nipkau im Buch von Robertz und Kahr. Er ist Redaktionsleiter des Zeitungsverlages Waiblingen, in dem unter anderem die Winnender Zeitung erscheint. „Die Gier nach der Opfergeschichte ist vielen Journalisten wichtiger als der Respekt vor der Trauer einer Familie, die ihr Kind verloren hat und die in dieser Situation meist keine Interviews geben will.“ Die Reporter der Winnender Zeitung dagegen berichteten nach dem Amoklauf nicht über Beerdigungen, sprachen keine Opferfamilien an, und es erschienen keine Fotos der Getöteten. „Diese redaktionelle Linie wurde auch in der Zeitung veröffentlicht“, erklärt Nipkau. „Von den Lesern gab es für diese Haltung viel Lob.“
Eine schwere Belastung für die Psyche
Mediennutzer sollten sich aus eigenem Interesse nicht allem aussetzen, was gedruckt und gesendet wird
Die Berichterstattung über Schreckensmeldungen belastet uns auf mehrfache Weise. Die Psychologin Michelle Slone von der Tel Aviv University wies bereits im Jahr 2000 darauf hin, dass es besonders Filme und Bilder sind, die uns ins Geschehen „hineinziehen“, was wiederum eine starke emotionale Reaktion hervorrufen kann. Probanden, denen sie Ausschnitte aus Fernsehnachrichten über Terrorismus und andere Bedrohungen der nationalen Sicherheit zeigte, empfanden anschließend größere Angst als solche, die Nachrichten über andere, nicht gefährliche Situationen zu sehen bekamen. Dieser Effekt fiel bei Frauen stärker aus als bei Männern.
Angst beeinflusst Handlungen
Sarah Oates, die damals an der University of Glasgow arbeitete, zeigte 2006 anhand von Befragungen, dass sich Berichte über Terrorismus in den abendlichen Fernsehnachrichten auf das Wahlverhalten in den USA und in Russland ausgewirkt hatten. Sie ist der Ansicht, dass für Politiker die Versuchung groß ist, im Wahlkampf die „Angst-Faktor-Karte“ auszuspielen. Angst kann außerdem Menschenmassen veranlassen, grundlos zu fliehen. So geschehen im John-F.-Kennedy-Flughafen in New York im Sommer 2016. Der Auslöser: Vermutlich hatten einige Anwesende laute Geräusche für Schüsse gehalten. Eine neue dänische Studie ergab, dass in der Woche nach den Anschlägen des 11. September die dortigen psychiatrischen Dienste 16 Prozent (also um ein Sechstel) mehr traumatische und stressbedingte Leiden diagnostizierten. Erst nach etwa einem Jahr war wieder das ursprüngliche Niveau erreicht. Dass sich diese Ereignisse bis ins weit entfernte Dänemark auswirkten, verdeutliche die Rolle der Massenmedien, so die Forscher.
Bilder können traumatisieren
Menschen, die sich direkt nach dem Anschlag beim Boston-Marathon wiederholt der Medienbericht-erstattung aussetzten, empfanden größeren akuten Stress als Personen, die bei dem Attentat anwesend waren. Das haben die Gesundheitspsychologin Alison Holman und ihre Kolleginnen von der University of California in Irvine herausgefunden. Zusammen mit früheren Ergebnissen zu den Anschlägen vom 11. September lässt dies die Forscherinnen vermuten, dass Medienkonsum tatsächlich traumatisieren kann. Anders als das Selbsterleben, „das enden kann, wenn die akute Phase des Ereignisses vorbei ist“, schreiben sie, „erhält das Aufnehmen der Medienberichte den akuten Stressor im eigenen Geist aktiv und lebendig“.
„Bitte auf keinen Fall Bilder im Internet verbreiten“
Wie soll man sich verhalten, wenn man Zeuge eines Anschlags wird? Der Kommunikationswissenschaftler Robert Kahr gibt wichtige Empfehlungen
Herr Kahr, wenn wir an die Attacke auf den Weihnachtsmarkt in Berlin denken, den 17-Jährigen, der in einem Zug bei Würzburg Fahrgäste mit Messer und Axt angriff, oder an den Amoklauf von München, dann scheint der Übergang zwischen den Anschlagsarten fließend zu sein. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Amokläufern und Terroristen?
Letztlich handelt es sich bei den Taten in beiden Fällen um Kommunikationsstrategien. Bei einem „normalen“ Verbrechen sind Triebbefriedigung, Gier oder Ähnliches das Motiv. Die genannten Attentäter möchten sich dagegen mitteilen und öffentlich Rache üben an einem System. Etwa an der Schule, weil sie sich zum Beispiel als Mobbingopfer sehen, oder an der Gesellschaft, die der eigenen Gruppierung und Ideologie entgegensteht. Wie wir es beim Münchener Attentäter gesehen haben, gibt es das Bedürfnis, mit der Tat Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und auch zu sagen, warum man so handelt. Terroristische Attentäter laden beispielsweise Propagandamaterial im Netz hoch oder schicken es an Hintermänner, die es veröffentlichen sollen.
Haben Sie durch die Attentate in Deutschland neue Erkenntnisse gewonnen?
Vor allem hat die Bedeutung von Social Media noch deutlich zugenommen. Wir haben auch gesehen, dass Menschen zum Beispiel über Facebook Videos vom Tatgeschehen teilen, vollkommen ungefiltert, etwa von Personen, die verletzt sind, oder mit einem Statement des Täters. Und dass Menschen, die so etwas tun, dies im Nachhinein oft bereuen. Sie haben gar nicht darüber nachgedacht: Was sende ich denn da? Sterben da vielleicht gerade Menschen vor meiner Kamera? Biete ich dem Täter ein Forum? Letztendlich kann jeder über sein Smartphone Öffentlichkeit herstellen. Das stellt einen Übergang vom klassischen Journalismus hin zum Jedermannjournalismus dar und ist insbesondere bei derartigen Fällen problematisch. In unserem Buch haben wir Richtlinien aufgestellt für Journalisten, die Berichte schreiben oder redaktionell beschließen, was veröffentlicht wird. Wenn aber die breite Masse darüber entscheidet, ob und wie etwas öffentlich gemacht wird, greifen solche berufsethischen Richtlinien nicht. Das sehe ich als eine der größten Herausforderungen.
Was wünschen Sie sich von der Allgemeinbevölkerung? Wie sollen wir uns verhalten?
Wenn man selbst Zeuge eines solchen Vorfalls wird: Bitte auf keinen Fall Bilder im Internet verbreiten, sondern sie der Polizei zur Verfügung stellen. Dafür gibt es inzwischen oft spezielle Uploadportale. Wichtig ist auch, einzuschreiten, wenn jemand anderes solche Bilder sendet: indem man die Polizei darauf hinweist, aber auch indem man denjenigen bittet, sein Verhalten einzustellen. Letztendlich liegt die Verantwortung für einen Widerstand gegen diese Art der terroristischen Nutzung des Internets bei uns allen. Und man sollte immer darüber nachdenken: Was will der Täter von mir? Was ist sein Ziel? Diese Personen wollen je nach Motivation Angst verbreiten und in vielen Fällen zudem Rassismus und Islamophobie säen, uns entzweien. Und eben das sollte man nicht zulassen, sondern im Gegenteil mit noch mehr Offenheit für andere und mit einem stärkeren gesellschaftlichen Miteinander reagieren.
Interview: Ingrid Glomp
Robert Kahr hat Kommunikationswissenschaft, Germanistik und Zivilrecht studiert und forscht an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Zusammen mit Frank J. Robertz hat er das Buch Die mediale Inszenierung von Amok und Terrorismus (Springer 2016) herausgegeben.
Literatur
Frank J. Robertz, Robert Kahr (Hgg.): Die mediale Inszenierung von Amok und Terrorismus. Springer, Berlin 2016
Erin M. Kearns, Allison Betus, Anthony Lemieux/Why Do Some Terrorist Attacks Receive More Media Attention Than Others?/SSRN/5. März 2017/ https://ssrn.com/abstract=2928138
Erin M. Kearns, Allison Betus and Anthony Lemieux, Yes, the media do underreport some terrorist attacks. Just not the ones most people think of. www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/03/13/yes-the-media-do-underreport-some-terrorist-attacks-just-not-the-ones-most-people-think-of
Daniel Geschke, Jana Eyssel, Wolfgang Frindte/ Immer richtig informiert? –Zusammenhänge zwischen Fernsehkonsum und Islamophobie/ In Farid Hafez (Hrsg.), Jahrbuch für Islamophobieforschung, New Academic Press, Wien 2014/162-179
Charlie Beckett/Fanning the Flames: Reporting on Terror in a Networked World/22. September 2016 www.cjr.org/tow_center_reports/coverage_terrorism_social_media.php
Michelle Slone/Responses to Media Coverage of Terrorism/Journal of Conflict Resolution/44(4)/2000/508-522/10.1177/0022002700044004005
Sarah Oates/Comparing the Politics of Fear: The Role of Terrorism News in Election Campaigns in Russia, the United States and Britain/International Relations/20(4)/2006/425-437/10.1177/0047117806069404
Bertel T. Hansen, Søren D. Østergaard, Kim M. Sønderskov, Peter T. Dinesen/Increased Incidence Rate of Trauma- and Stressor-Related Disorders in Denmark After the September 11, 2001, Terrorist Attacks in the United States/American Journal of Epidemiology/184(7)/2016/494-500/10.1093/aje/kww089
E. Alison Holman, Dana Rose Garfin, Roxane Cohen Silver/Media’s role in broadcasting acute stress following the Boston Marathon bombings/PNAS/111(1)/2014/93-98/10.1073/pnas.1316265110
Sherry Towers, Andres Gomez-Lievano, Maryam Khan, Anuj Mubayi, Carlos Castillo-Chavez/Contagion in Mass Killings and School Shootings/PLoS ONE/10(7)/2015/10.1371/journal.pone.0117259
Außerdem:
"Transparenz ist das Gebot der Stunde", Interview mit Bernhard Pörksen, www.ndr.de/kultur/Sollte-mehr-ueber-Positives-berichtet-werden,journal690.html
Bruce Hoffman, Inside Terrorism, Chapter One, www.nytimes.com/books/first/h/hoffman-terrorism.html
Jason Burke, How the changing media is changing terrorism, www.theguardian.com/world/2016/feb/25/how-changing-media-changing-terrorism
Scott Atran, Mindless terrorists? The truth about Isis is much worse, www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/15/terrorists-isis
Nicky Woolf, Fox News site embeds unedited Isis video showing brutal murder of Jordanian pilot, www.theguardian.com/media/2015/feb/04/fox-news-shows-isis-video-jordan-pilot
"Je fremder, desto schlimmer unsere Fantasien", Interview mit Ortwin Renn, www.zeit.de/wissen/2017-02/sicherheit-deutschland-fluechtlinge-risikoforschung
Alexander Spencer, Terrorism and the Media, www.ahrc.ac.uk/documents/project-reports-and-reviews/ahrc-public-policy-series/terrorism-and-the-media/