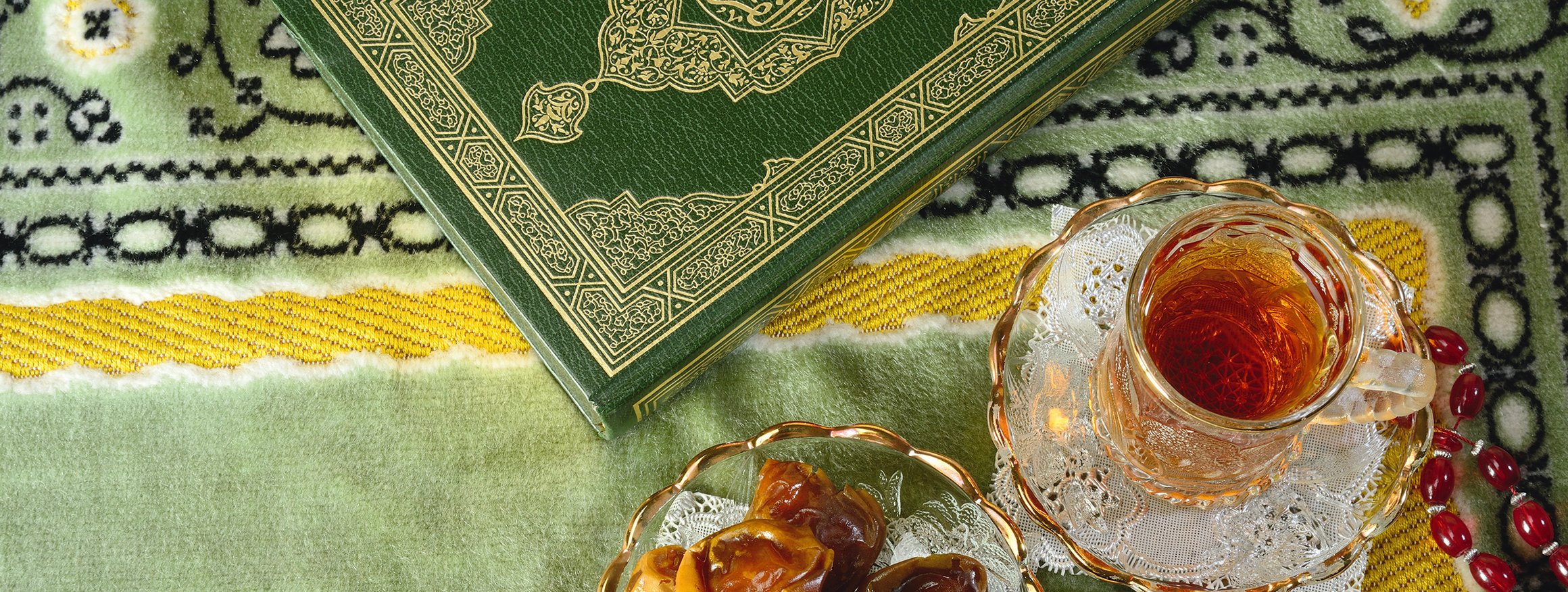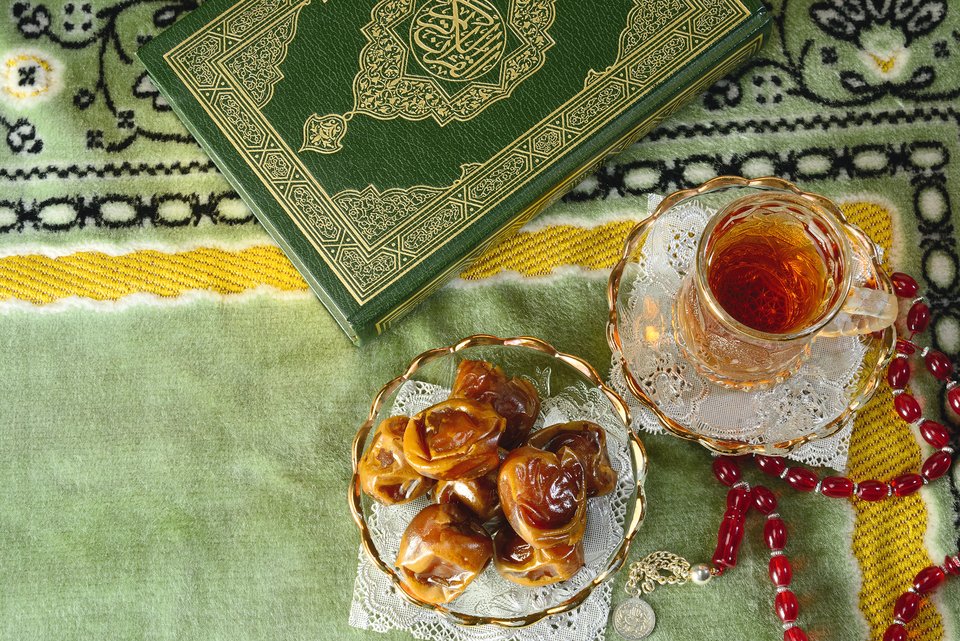Frau Menzfeld, wer „Salafist“ hört, der denkt sofort an Böses. Ist das ein unzulängliches Stereotyp?
Nein, wenn wir bei dem Wort Salafist bleiben, dann denke auch ich an Böses. Denn Salafist ist ein wertender Ausdruck, der im Laiensprachgebrauch, aber auch in der Prävention von Radikalisierung verbreitet ist. Wenn man ihn verwendet, muss man bedenken, dass man damit eine normative Vorbeurteilung der Menschen dieser bestimmten Glaubensrichtung vornimmt. Will man das nicht tun, dann nennt man sie Salafis.…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
Menschen dieser bestimmten Glaubensrichtung vornimmt. Will man das nicht tun, dann nennt man sie Salafis. Diese Menschen sind nur sehr selten gefährlich in dem Sinne, dass sie Gewalt ausüben.
Was kennzeichnet diese Glaubensrichtung?
Salafis wollen sich sehr genau daran orientieren, wie die ersten drei Generationen von Musliminnen und Muslimen gelebt haben – also die Zeitgenossen von Muhammad und deren Nachfahren. Sie versuchen, anhand einer wörtlichen Lesart des Korans und der überlieferten Aussprüche des Propheten zu deuten, wie sie sich zu verhalten haben.
Würden das andere Muslime nicht auch von sich behaupten?
Mag sein. Aber bei Salafis kommt Weiteres hinzu: Sie lehnen zum Beispiel religiöse Neuerungen und das, was sie als kulturelle Einflüsse auf die Religionspraxis wahrnehmen, weitgehend ab. Wichtig ist ihnen auch, dass nichts und niemand anderes neben Gott verehrt werden soll. Was genau das praktisch bedeutet, wird sehr unterschiedlich ausgelegt. Deshalb sehen wir bei Salafis ein erstaunlich breites Spektrum an Glaubensinterpretationen.
Die einzelnen Gruppen sind sich untereinander meist nicht grün. Selbst innerhalb der Gruppen gibt es auseinandergehende Auslegungen. Zudem sind Salafis in Deutschland üblicherweise Konvertiten und Rekonvertiten – also entweder Leute, die zuvor noch nie mit dem Islam zu tun hatten, oder die, die vorher einen ganz anderen Islam gelebt haben.
Die ersten drei Generationen der Muslime lebten im siebten bis achten Jahrhundert – wir im 21., in einer westlich geprägten Demokratie. Entstehen da nicht zwangsläufig Spannungen?
Ja, es gibt Spannungen. Salafis haben natürlich auch Kinder, die in die Kita gehen. Und wenn alle anderen nicht mit einem Kind spielen sollen oder wollen, weil dessen Mutter sich draußen mit dem Nikab, also mit dem Gesichtsschleier zeigt, dann entsteht ganz schnell eine Kollision zwischen nicht-salafitischer Umwelt und salafitischen Grundsätzen. Die Salafis müssen dann Antworten finden. Manche Frauen legen in solchen Situationen den Nikab ab, zumindest für eine Zeit. Andere sagen, dass ihnen die Meinung der Mehrheitsgesellschaft egal sei.
Allerdings wäre es nicht korrekt, solche Spannungen als Vorzeit-versus-Moderne-Konflikt zu vereinfachen. Denn erstens würden wir damit das bloße Ideal der Salafis – tatsächlich wie Menschen aus der Prophetengeneration zu leben – als eine faktische Beschreibung ihres Alltagslebens begreifen, was auf vielen Ebenen keinen Sinn macht.
Zweitens hat es Probleme zwischen sehr frommen Menschen und ihrem weniger frommen Umfeld auch schon im siebten Jahrhundert gegeben. Drittens ist die heutige salafitische Frömmigkeit kein Relikt, sondern nur aus ihrem heutigen Kontext heraus zu verstehen. Das Narrativ: „Die Salafis leben wie im Mittelalter und unsere Gesellschaft ist ganz modern“, verfängt auch darum nicht, weil viele jetztzeitige Elemente Salafis keine Probleme bereiten, wie zum Beispiel das Internet. Viele Salafis arbeiten in der IT-Branche.
Das bedeutet, die Vorschriften beziehen sich eher auf den sozialen Umgang und moralische Gepflogenheiten?
Bei vielen Gruppen, genau. Man muss aber verstehen, dass Salafis für jede Frage ihres Alltags eine Antwort in ihren heiligen Schriften suchen. Viele Salafis haben sich zum Beispiel sofort gegen Covid-19 impfen lassen, aber nicht weil sie hinsichtlich medizinischer Neuentwicklungen besonders fortschrittsbegeistert wären, sondern weil sie in ihren heiligen Schriften keinen Grund ausmachen, warum Gott diese Impfung missfallen könne. Genauso verneinen diverse salafitische Prediger, dass Frauen einen Nikab tragen müssen – aber nicht weil sie Frauen befreien möchten, sondern weil sie im Koran keinen Beweis dafür finden, dass eine Frau ihr Gesicht bedecken sollte.
Kann aus Differenzen zwischen salafitischen und nichtsalafitischen Normen seelischer Stress entstehen?
Absolut. Auch aus den bloßen salafitischen Idealen heraus, da braucht es gar keinen Konflikt mit anderen Gepflogenheiten: Ich erinnere mich an einen Mann, dessen Frau den dringenden Wunsch hatte, streng nach ihrer Lesart salafitischer Regeln zu leben. Das hieß für den Mann, dass er seine Frau mit Lebensmitteln und Alltagsgütern versorgen musste, weil diese nach ihrer religiösen Auslegung zu Hause bleiben soll.
Arbeiten, einkaufen, die Kinder aus dem Kindergarten holen – dem Mann wurde das alles irgendwann zu viel. Als die Frau ihn auch noch aufforderte, eine Zweitfrau zu nehmen, die ihr beim Putzen helfen sollte, vertraute sich der überforderte Mann seinem Imam an. Der sagte allerdings: „Deine Frau hat recht.“ Da wandte der Mann sich an eine psychologische Beratungsstelle.
Sie haben sich in Ihrer Forschung speziell auch den Emotionen der Salafis gewidmet. Was haben Sie herausgefunden?
Zum Beispiel dass viele Konvertiten und Rekonvertiten ein religiöses Regelwerk als entlastend und seelisch befriedend empfinden – und dass sie diese Ausgeglichenheit in ihrem Glauben hält und nicht etwa eine dauernde Rebellion gegen die Mehrheitsgesellschaft oder ein enormes Überlegenheitsgefühl gegenüber Ungläubigen. Wenn ein Salafi davon ausgeht, dass es klare Normen gibt, welche Gefühle wann, wo und unter welchen Umständen zugelassen und welche weggeschoben werden sollten, dann verschafft das Regulationsroutinen, so dass die Person sich nicht mehr mit jeder Gefühlswallung auseinandersetzen muss.
Können Sie dafür Beispiele geben?
Es gibt zum Beispiel viele Salafis, die glauben, es sei gut und männlich, oft und auch öffentlich über das Leid der Welt oder die Bedrohungen der Hölle zu weinen. Sie weinen also ganz viel zu bestimmten Gelegenheiten, da haben ihre Tränen ihren Platz. Bei anderen Gelegenheiten dann wiederum nicht: Trauer an Gräbern durch lautes Weinen zu zeigen gilt vielen als nicht angebracht. Durch solche Gefühlsnormen sind die Gelegenheiten zur und die gedanklichen Fokussierungen beim Trauern stabil gerahmt, das kann stark entlasten.
Ein anderes Beispiel: Weinen um misslungene Beziehungen oder aus Liebeskummer gilt schnell als selbstsüchtig und unangebracht. Ein unglücklich verliebter oder eifersüchtiger Mann wird also lieber nicht darauf konzentriert weinen, dass seine große Liebe sich abwendet oder ihn verletzt hat; er weint stattdessen eher um die Seele der betreffenden Frau. Manchen Menschen hilft so eine Rahmungsnorm, nicht in Verzweiflung und persönlicher Gekränktheit zu versinken. Frauen wird dabei übrigens oft mehr Toleranz gewährt, weil viele Salafis glauben, Frauen könnten sich emotional weniger gut regulieren. Sie dürfen sozusagen eher in persönlichem Schmerz schwelgen.
Vom Mann wird also Vernunft erwartet?
Er ist formell der Verantwortliche für die religiöse Bildung seiner Familie und dient idealerweise als Vorbild. Solche hohen Erwartungen sind natürlich nur schwierig zu erfüllen.
Und bei den Frauen?
Unter den Salafi-Konvertitinnen in unseren Breitengraden beobachten wir nicht selten eine emotionale Selbstentlastung, die mit der Konversion eintritt. Es gibt so einige, die in der Vergangenheit sexuelle Belästigung oder Gewalt erlebt haben oder Demütigungen aufgrund ihres Aussehens. Für diese Frauen ist Salafismus eine Art Selbsttherapie, weil ihnen hier gesagt wird: Du bist eine wertvolle Person, auch wenn du deinen Körper nicht zeigst, auch wenn dein Po nicht in Kleidergröße 40 passt – und niemand darf dich anfassen außer deinem Ehemann.
Sie hören: Dein künftiger Ehemann sieht erst mal nur deinen guten Charakter und höchstens noch die Augen, und nach der Hochzeit bist du die einzige Frau, die er je begehrlich ansehen darf. Es ist überflüssig, zu erwähnen, dass eine ganz reale salafitische Ehe natürlich keinen Deut großartiger ist als andere Ehen. Aber es ist diese Utopie, die diverse Salafitinnen sehr anzieht.
Welche psychischen Probleme sind Ihnen bei Ihren Gesprächen mit Salafis begegnet?
Es gab zum Beispiel einen Fall, bei dem ich einem möglichen Anschlag vielleicht am nächsten war. Die Person war psychisch nicht stabil und hat gesagt, dass sie vielleicht andere Menschen verletzen möchte. Leute aus ihrer Gemeinde und ihre Familie haben sich dann eingeschaltet und sie in eine Klinik gebracht. Situationen wie diese waren aber Momente, in denen Menschen nicht einfach von irgendetwas überzeugt waren, sondern später auch mit einer psychischen Erkrankung diagnostiziert wurden beziehungsweise bei einer bekannten Diagnose therapeutisch schlecht eingestellt waren.
Der Unterschied zwischen „schwer beeinträchtigt und gewaltaffin“ versus „nicht schwer beeinträchtigt und gewaltaffin“ ist wichtig und gleichzeitig sehr schwierig zu definieren und mündet in der großen Frage: Ist jemand grundsätzlich psychisch krank, der religiös-extremistisch konnotierte Gewalttaten verübt? Oder nehmen wir in unserem kulturspezifischen Bezugssystem vorschnell eine Pathologisierung von etwas vor, das nicht im eigentlichen Sinne erkrankungsbedingt ist, sondern schlicht brutal, furchtbar und im Spektrum menschlichen Tuns liegt, das nicht durch Erkrankung beeinflusst wird? Das muss man sich in jedem Einzelfall gut anschauen.
Wie stehen die Salafis generell zur westlichen Demokratie?
Ganz unterschiedlich. Ich war in Salafi-Moscheen, da wurde in der Freitagspredigt dazu aufgerufen, Die Grünen oder Die Linke zu wählen. Dann gibt es welche, die sagen: Wählen ist Götzendienst, über uns steht und entscheidet nur Gott und kein Volk als Souverän. Relativ viele raten dazu, dass man sich gar nicht politisch beteiligt, auch nicht an Wahlen.
Es gibt aber auch Salafis, die in Richtung Muslimbruderschaft neigen und mittels politischer Betätigung auf einen Gottesstaat hinarbeiten. Unter anderem aus diesem Thema heraus entstehen Kämpfe innerhalb der Glaubensrichtung, weil der eine sagt, man dürfe sich nicht beteiligen, und der andere, das einzig Richtige sei, durch die Gründung einer Partei zu einem Gottesstaat zu kommen. Wenn solche Leute sich begegnen, wechseln sie sogar die Straßenseite.
Könnten Salafis eine Gefahr für die Demokratie werden?
Die meisten ganz bestimmt nicht. Dafür sind sie erstens viel zu heterogen, und zweitens sind die meisten Salafis vorrangig darauf konzentriert, ihr eigenes Leben möglichst fromm zu gestalten. – Aber bedenkliche Gestalten gibt es natürlich auch, gerade unter den 19- bis 25-Jährigen, die viel Veränderungswillen haben, jedoch nur wenig Chancen.
Wenn sich diese Menschen dem Salafismus angeschlossen haben: Wie kann man verhindern, dass sie extremistisch oder gar dschihadistisch werden?
Am effektivsten wäre, gewaltaffine junge Männer – seltener sind es Frauen – mit Salafi-Predigern zusammenzubringen, die ihnen ausführen, warum dschihadistische Betätigung kein Gottesdienst ist. Jemand, der in Syrien den Krieg unterstützen will, hört nicht auf einen Sozialarbeiter, der Atheist ist. Sie müssen ihn mit einem Imam in Kontakt bringen, der seine Argumentationsstrukturen versteht und sie widerlegen kann. Das ist etwas, was in diversen Gemeinden bereits ganz von allein passiert.
Deswegen schüttele ich oft den Kopf, wenn Moscheen geschlossen werden sollen, die zwar extrem fromme Prediger einladen, aber aufgrund ihrer theologischen Ausrichtung niemals dschihadistische Gruppen unterstützen würden. Denn wenn diese Infrastruktur wegfällt, organisieren sich die potenziell gefährlichen Menschen auf eigene Faust mit Gleichgesinnten, und an diese Blasen kommt dann gar niemand von außen mehr heran.
Wenn man also streng salafitische, aber nicht gewaltbefürwortende Moscheen offenließe, könnte man mit ihnen in einigen Bereichen pragmatisch sinnvoll zusammenarbeiten. Die Partei, die sich das auf die Fahnen schreibt, muss aber wohl erst noch gegründet werden. Salafi-Imame, die präventiv tätig sein könnten, werden nicht gewollt. Das verstehe ich aus politischer Sicht auch. Denn es kann durchaus sein, dass einzelne Imame zum Beispiel Menschen davon abhalten, in Kriegsgebiete zu gehen, dass aber der ein oder andere Imam gleichzeitig der Ansicht ist, dass demokratisches Wählen nicht gottgewollt sei. So was ist ein Dilemma.
Dem man wie entkommen könnte?
Klug wäre es, Initiativen wie Wegweiser besser zu unterstützen und auszustatten. Das ist ein Beratungsangebot, das religiöse Überzeugungen respektiert, aber dem Missbrauch religiöser Inhalte zur Rechtfertigung von Gewalt und Hass deutlich entgegentritt. Dort arbeiten viele Islamwissenschaftler, teils selbst aus muslimisch geprägten Vierteln, die sozusagen die Sprache ihrer Klienten sprechen. Die Beratenden bieten Gespräche an, sie begleiten gegebenenfalls junge Menschen auch eine Weile über eng und sie kennen sich in deren Lebenswelt und in bestimmten theologischen Argumentationsweisen gut aus.
Mira Menzfeld ist Ethnologin an der Universität Zürich und erforscht, wie Salafis in der westlich-demokratischen Gesellschaft leben. Dafür trifft sie seit Jahren die ultrakonservativen Muslime in Deutschland und der Schweiz.