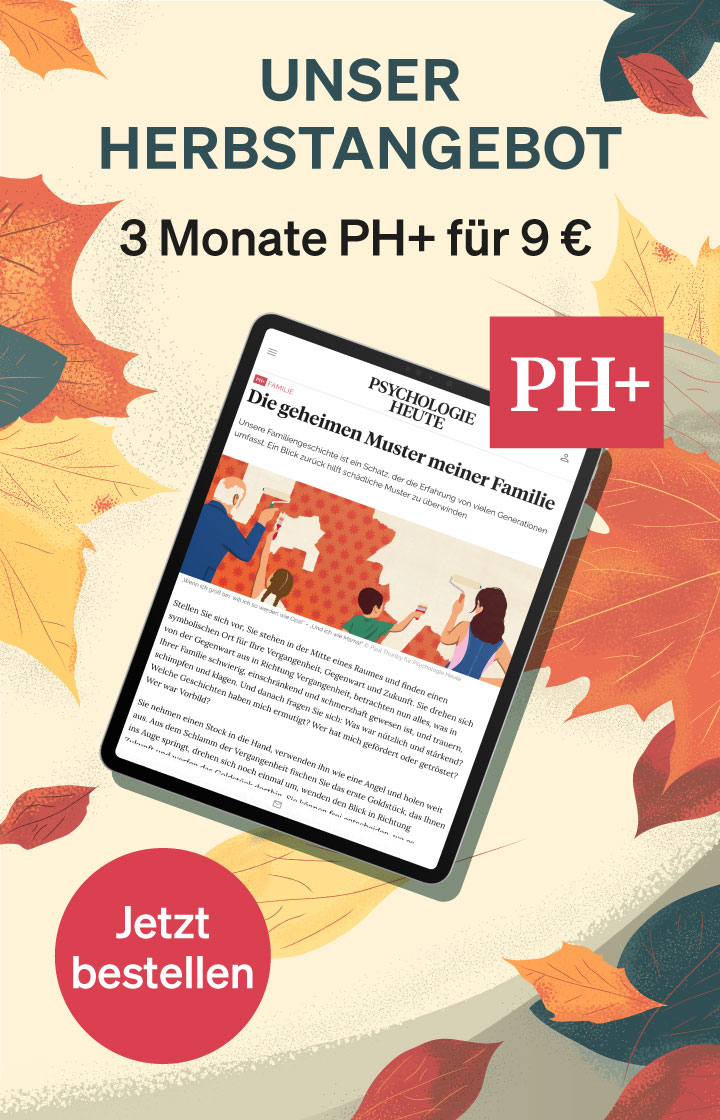„Niemand sieht, was ich leiste“
Die Situation: Ruth hat vor ein paar Monaten eine Schulklasse übernommen, in der ein Großteil der Schüler von psychosozialen Problemen belastet ist. Ihr besonderer Einsatz wird von Direktion und Kolleginnen als selbstverständlich hingenommen.
Was jetzt hilft: Am Anfang steht die Reflexion: Ruth gesteht sich ein, dass ihr Bedürfnis nach Anerkennung nicht befriedigt wird. Aber: Sind es wirklich die anderen, die ihre besondere Mühe nicht sehen – oder kann sie sich selbst den Wert ihrer Arbeit auch nicht voll eingestehen?
Nach dem Modell des „inneren Teams“, entwickelt vom Kommunikationsexperten Friedemann Schulz von Thun, tragen wir verschiedene Ich-Anteile in uns, geprägt von unseren Kindheitserfahrungen. Häufig sind es negative Stimmen wie „der innere Kritiker“ oder „die Nörglerin“, die uns an unseren eigenen Fähigkeiten zweifeln lassen. Um den wertschätzenden Stimmen mehr Raum zu geben, könnte Ruth für einige Zeit jeden Abend drei Dinge aufschreiben, die ihr in ihrer Arbeit besonders gut gelungen sind. Das schärft den Blick für die eigenen Kompetenzen, und aus dieser selbstbewussten Position heraus wird es ihr leichterfallen, ihre Leistungen anderen gegenüber ins rechte Licht zu rücken.
Darüber hinaus kann sie sich auch fragen: Mache ich Wertschätzung zu sehr abhängig von den Beziehungen am Arbeitsplatz? Kann ich stattdessen meine privaten Beziehungen so stärken, dass ich weniger angewiesen bin auf das explizite Lob von Vorgesetzten und Kolleginnen?
„Mein Job ist so sinnlos“
Die Situation: Mit zwanzig träumte Jana von einer Karriere als Musikerin, doch daraus ist nichts geworden. Nun jobbt sie in einer Logistikfirma und erstellt Lieferpläne. Sie findet: Ihre eintönige Tätigkeit könnte genauso eine KI machen. Was soll’s, die übernimmt wahrscheinlich ohnehin bald ihren Job.
Was jetzt hilft: Neben Geldverdienen, Zugehörigkeit, Struktur und sozialer Anerkennung hat Arbeit noch weitere Funktionen für unsere psychische Stabilität: Sie kann identitäts- und sinnstiftend sein. Bei manchen Tätigkeiten liegt der Sinn auf der Hand – etwa in der Krebsforschung oder auch bei künstlerischen Tätigkeiten –, bei manchen ist er weniger sichtbar. Aber die Suche lohnt sich. So empfinden Reinigungskräfte in Kliniken ihre Arbeit als sinnvoller, wenn man ihnen mithilfe von Abstrichen auf Türklinken zeigt, wie ihre Tätigkeit die Ausbreitung von gefährlichen Krankenhauskeimen verhindert. Für Jana heißt das zum Beispiel: Wenn sie ihre Arbeit gut macht, geraten Paketauslieferer weniger unter Stress, heißersehnte Waren, zum Beispiel Geburtstagsgeschenke erreichen rechtzeitig den Empfänger. Und: Sinn kann ein breites Fundament haben, nicht nur bezahlte Arbeit, auch Hobbys und Ehrenämter.
„Diese Chefin ist so ungerecht“
Die Situation: Kim ist Berater in einer IT-Firma und hat einen neuen und wichtigen Kunden angeworben. Aber dann erfährt er, dass seine Vorgesetzte einer Kollegin das Beratungsprojekt übertragen hat. Wütend stürmt er in ihr Büro.
Was jetzt hilft: Das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Angestellten ist tricky. Denn auch wenn Führungskräfte sich heute vielfach um Augenhöhe und gute Kommunikation bemühen – am Ende bleibt ein Macht- und Autoritätsgefälle. Wichtig bei Konflikten mit Vorgesetzten: immer auch den eigenen Anteil erkennen. Kim fühlt sich im Recht – aber er hat es in der Hand, ob der Konflikt eskaliert. Denn schnell geraten wir in einer solchen Situation in eine negative innere Resonanz: „Ich bin ihr wohl nicht gut genug! Wahrscheinlich bin ich bei der nächsten Kündigungswelle draußen!“ So entstehen dysfunktionale Muster, in denen sich Konflikte gegenseitig hochschaukeln.
Der bessere Ansatz: den eigenen präfrontalen Kortex regulieren, also den Teil unseres Hirns, der für die Kontrolle von impulsiven Handlungen zuständig ist. Statt spontan zu reagieren, könnte Kim Abstand zur Situation gewinnen: tief Luft holen, eine entspannte Körperhaltung einnehmen, die eigenen Gefühle – Wut, Enttäuschung – annehmen, beobachten, aber nicht werten. So legt er von sich aus den Grundstein für ein sachliches und konstruktives Gespräch: Wie kam die Chefin zu ihrer Entscheidung? Gibt es vielleicht Gründe, die nichts mit Kim zu tun haben? Und was ist seine Perspektive für neue Projekte?
„Mein Team? Alles Idioten“
Die Situation: Verlagslektorin Schirin hat mit Verve für ein Manuskript einer unbekannten Autorin plädiert, eine ältere Kollegin hat ihr den Wind aus den Segeln genommen: „Verkauft sich nicht, zu speziell.“ Wie soll man mit solchen Spaßbremsen aufregende Literatur machen?
Was jetzt hilft: Menschen in Arbeitsteams wollen einander in der Regel nicht das Leben zur Hölle machen – sie haben schlicht unterschiedliche Werte und Sichtweisen. Im besten Fall ergänzen sie sich, im schlechtesten blockieren sie einander. Schirin kann zunächst identifizieren, um welchen Grundkonflikt es geht.
Das Akronym BART steht für die Begriffe boundaries (Grenzen und Zuständigkeiten), authority (formelle und informelle Machtpositionen), roles (wer ist im Team eher die Antreiberin, wer die Skeptikerin, wer der Gewissenhafte?) und tasks, also Aufgaben. In diesem Fall geht es sowohl um einen Rollenkonflikt („Team Vorwärts“ gegen „Team Vorsicht“) als auch um einen Autoritätskonflikt: Obwohl formell auf der gleichen Stufe, hat die ältere Kollegin einen Wissens- und Erfahrungsvorsprung.
Im nächsten Schritt könnte Schirin ein offenes Gespräch suchen, wobei ihr das NURSE-Modell hilft: die Emotion benennen (naming), Verständnis für das Gegenüber zeigen (understanding), Respekt für das Gegenüber (respecting), Unterstützung anbieten (supporting) und aktives Zuhören (exploring).
„Bleiben oder gehen, das ist hier die Frage“
Die Situation: Seit einer Umstrukturierungsmaßnahme und einem Führungswechsel erkennt Khaled sein Forschungsinstitut nicht mehr wieder: Seine Herzensthemen stehen nicht mehr im Fokus, stattdessen werden bürokratische Aufgaben mehr. Und nun?
Was jetzt hilft: Wenn sich Arbeitsbedingungen zum Schlechteren ändern, ist oft schon ein Gedanke entlastend: Keiner zwingt mich, hier auszuharren. Trotzdem ist es meist keine gute Idee, impulsiv zu kündigen. Denn im nächsten Job mag einiges besser sein, dafür entstehen andere Probleme. Und es hat auch nicht jeder das finanzielle Sicherheitsnetz für dieses Risiko. Bei der Entscheidung hilft, sich klarzumachen: Welche meiner Bedürfnisse erfüllt mein jetziger Job auch unter schlechten Bedingungen?
Bei Khaled etwa: gutes Gehalt, angenehme Kollegen, Homeoffice-Möglichkeiten, kurzer Arbeitsweg. Wiegt das die Nachteile auf? Muss es eine harte Entscheidung sein oder kann er sich eine Brücke in ein anderes Berufsleben bauen, ohne das alte ganz an den Nagel zu hängen – etwa: Stunden reduzieren, nebenbei ein Buch über eines seiner Herzensthemen schreiben? Bei langfristigen Entscheidungen hilft auch, den Zeithorizont zu beachten: Wie wird sich der Schritt wohl in zehn Minuten, zehn Monaten und zehn Jahren anfühlen? Ein gedanklicher Umweg, der zu mehr Klarheit führt.
Wollen Sie mehr zum Thema erfahren? Dann lesen Sie auch folgende Artikel:
Der Druck in der Arbeitswelt versetzt uns in Stress. Wie es gelingen kann, seelisch in Balance zu bleiben, während wir auf die äußeren Geschehnisse nur begrenzt Einfluss haben lesen Sie in Heil bleiben im Beruf.
Wie man sich schützen kann, wenn nicht nur Chefs oder Kolleginnen, sondern ganze Organisationen neurotisch wirken, erklärt Prof. Dr. Stefanie Rödel im Interview in „Ungesunde Muster gehen meist vom Management aus“.
Quelle
Claas Lahmann: Wie Arbeit glücklich macht (und wann man darüber nachdenken sollte, den Job zu wechseln). Rowohlt 2024