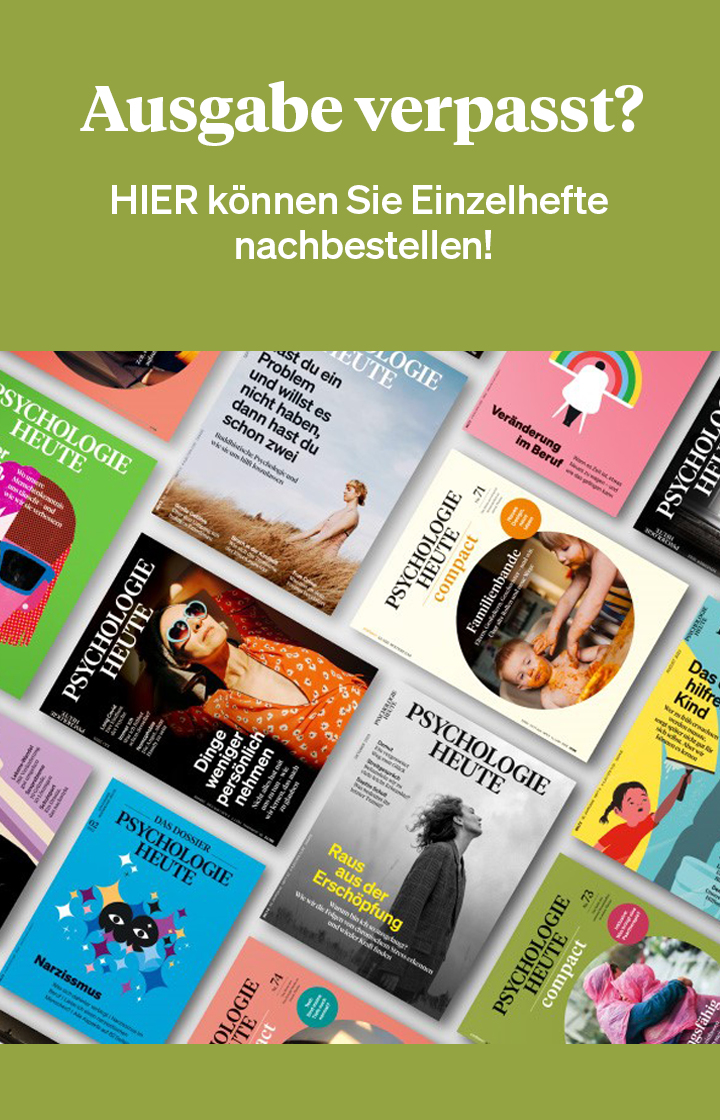Wenn eine seelische oder körperliche Störung von Jahr zu Jahr öfter diagnostiziert wird, spaltet sich die Reaktion der Öffentlichkeit. Ein Versuch der beteiligten Fachleute, Kunden zu gewinnen und ihren Umsatz zu steigern, sagen die einen; Aufmerksamkeit für ein bisher ignoriertes Problem und professioneller Einsatz, um Betroffene zu unterstützen, sagen die anderen. So lange beide Seiten argumentieren, darf man hoffen, dass sich im Diskurs die Sache klären wird.
In der Einführung zu dem Buch Hans Asperger und der Nationalsozialismus des Medizinhistorikers Herwig Czech erwähnt Peter Rödler, dass die Häufigkeit einer Autismus-Spektrum-Störung von 1970 bis 1990 mit vier Fällen auf 10000 Personen angegeben wurde. Inzwischen ist sie zu der 2006 in der britischen Zeitschrift Lancet publizierten Prävalenz von 1,16 Prozent, also rund einer Person mit einer Autismus-Spektrum-Störung auf 100 Personen angewachsen, gemessen mit der als „Goldstandard“ gerühmten Beobachtungsskala ADOS (Autism Diagnostic Obervation Schedule).
Ein heute veralteter Begriff: neutraleres Aspergersyndrom
Vielleicht lässt sich aus dem lawinenähnlichen Wachstum der Autismusdiagnose und den mit ihr verbundenen historischen Veränderungen auch das Interesse am Leben des österreichischen Kinderarztes und Heilpädagogen Hans Asperger ableiten. Er habilitierte 1944 über Die „Autistischen Psychopathen“ im Kindesalter. Aspergers autistische Psychopathie wurde im ICD-10 als neutraleres Aspergersyndrom aufgenommen, ein Begriff, der heute zunehmend als veraltet gilt und durch den „hochfunktionalen Autismus“ ersetzt wird. Wobei die Frage im Raum steht, ob eine so hohe Zahl an Personen mit psychiatrischen Einordnungen wirklich gut bedient ist.
Rödler, ein emeritierter Professor für Pädagogik und ausgewiesener Autismusexperte, stellt in seinem inhaltsreichen Text Die schiefe Ebene: Asperger heute – der viel mehr ist als ein Vorwort – der Darstellung Aspergers grundsätzliche Überlegungen voran: So weit entfernt, wie wir es erwarten, ist die neoliberale Leistungsgesellschaft nicht von der schon vor dem Nationalsozialismus existierenden Frage nach dem „lebensunwerten“, nicht „bildungsfähigen“ Leben. Bedenke man die zeitlich parallelen Überlegungen zu der Frage „Muss dieses Kind am Leben bleiben?“, so ergebe sich auch eine ganz ähnliche potenzielle Bedrohungslage wie zur Zeit Aspergers, stellt Rödler fest. Er bezieht sich damit auf ein im Jahr 1993 erschienenes, von Helga Kuhse und Peter Singer verfasstes Buch über den Umgang mit schwerstgeschädigten Neugeborenen.
Kein Mitglied der NSDAP, aber auch kein Gegner der „Euthanasie“
Czechs Dokumentation über Asperger und den Nationalsozialismus steht im Kontext des Widerspruchs zu Entlastungsbiografien, die in unterschiedlichsten Formen seit den 1960er Jahren „Verstrickungen“ in den Nationalsozialismus teils gänzlich leugnen, teils schönreden. Dazu dient nicht zuletzt das Wort „Verstrickung“ selbst, das dem Nutznießer eines Unrechtsregimes die Ausrede nahelegt, er habe sich ungeschickterweise in einer Schlinge verfangen. Asperger war kein Mitglied der NSDAP, aber durchaus Nutznießer des Systems und Mitglied anderer NS-Organisationen wie des NS-Ärztebunds. Und er war auch kein Gegner der „Euthanasie“. 1939 schrieb er:
„So wie der Arzt bei der Behandlung des einzelnen oft schmerzhafte Einschnitte machen muß, so müssen auch wir aus hoher Verantwortung Einschnitte im Volkskörper machen: wir müssen dafür sorgen, daß das, was krank ist und diese Krankheit in fernere Generationen weitergeben würde, zu des einzelnen und des Volkes Unheil, an der Weitergabe des kranken Erbgutes verhindert wird.“
Solange über Aspergers Verhalten nach dem Anschluss Österreichs nur seine eigenen Auskünfte bekannt waren, galt er als aufrechter Kämpfer für behinderte Kinder, der unter Gefahr für Leib und Leben „Euthanasie“-Praktiken bekämpfte. Czech zeichnet das historisch korrekte Bild. Er zitiert Dokumente, dass Asperger als regimekonform eingeschätzt wurde und mit der berüchtigten Anstalt „Am Spiegelgrund“ zusammenarbeitete; er muss gewusst haben, dass eine Überweisung dorthin vielfach einem Todesurteil gleichkam. Die Kinder wurden auf perfide Weise ermordet: Sie wurden mit Barbituraten ruhiggestellt, bis die Entzündung der schlecht belüfteten Lunge einen „natürlichen Tod“ zur Folge hatte.
Herwig Czech: Hans Asperger und der Nationalsozialismus. Geschichte einer Verstrickung. Psychosozial 2024, 160 S., € 19,90