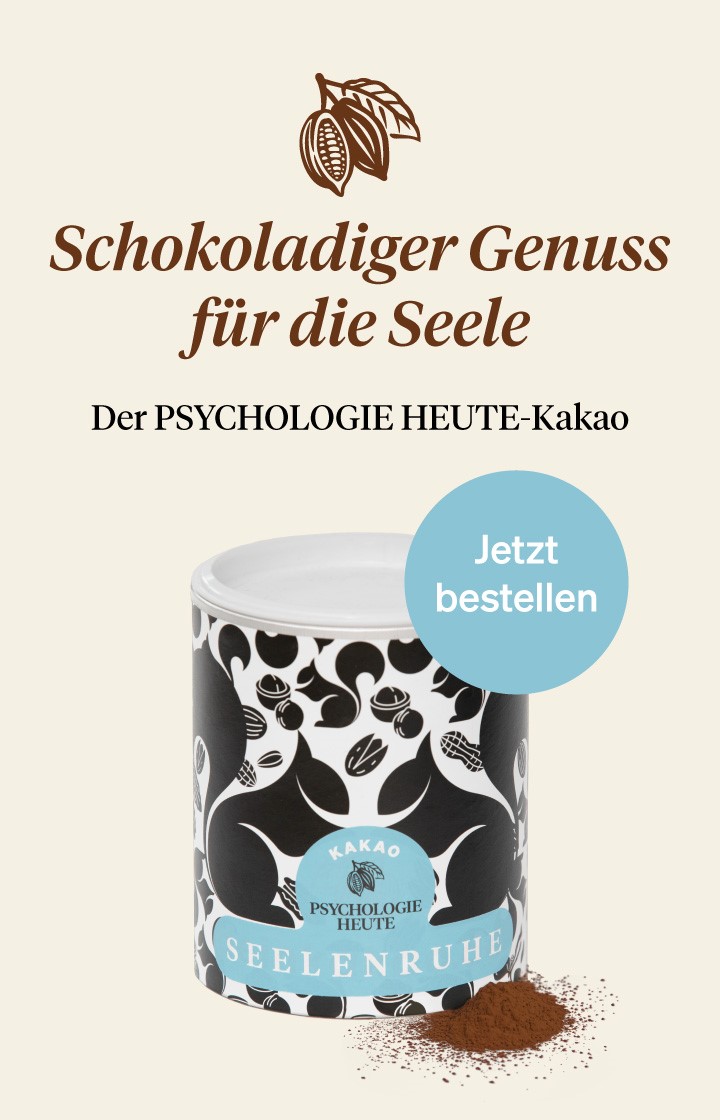Sie sagen, dass das Streben nach Erfolg und Anerkennung gut sei für eine Gesellschaft insgesamt. Wie ist das zu verstehen?
Personen, die sehr nach Status und Erfolg streben, sind ehrgeizig und leistungsbewusst, sie suchen nach anspruchsvollen, prestigeträchtigen und fordernden beruflichen Positionen. Generell definieren sie sich häufig stärker über ihren Beruf und die damit verbundenen Werte. Diese Menschen wollen ihr Statusstreben ausleben und dafür Anerkennung bekommen. Wenn sie das nicht können, geht es ihnen nicht gut. Dabei ist es ganz wichtig, zu betonen, dass das nichts Negatives und keinesfalls Pathologisches ist. Gesellschaften als Ganzes brauchen Menschen, die leistungsorientiert sind.
Aber in den Familien entstehen Konflikte, wenn ein Mitglied stark nach Status strebt.
Ja, in den Familien – besonders in wohlhabenden Ländern – verstärken sich dadurch die Konflikte, die in der sozialwissenschaftlichen Forschung als work-family conflict bezeichnet werden. Damit ist gemeint, dass es zu Spannungen zwischen den Erwartungen an Arbeitnehmer und den Erwartungen ihrer Familien kommt. So entstehen Stress und unangenehme Erfahrungen.
Hinzu kommt: Die Positionen, in denen Statusorientierte arbeiten, gehen häufig mit langen, nicht gerade familienfreundlichen Arbeitszeiten einher und sind oft mit viel Verantwortung und Druck verbunden. Das alles wirkt sich zu Hause negativ aus, vor allem wenn es mehrere Kinder gibt. Dann müssen Statusorientierte gleich zwei anspruchsvolle Rollen mit äußerst unterschiedlichen Anforderungen zusammenbringen, das kann zu Konflikten und schlechter Stimmung führen, insbesondere wenn nur ein Elternteil statusorientiert ist.
Sie schreiben, dass es bei Rollenkonflikten überwiegend die Arbeit ist, die den Familien Stress bereitet. Es sind also weniger die gesellschaftlichen Erwartungen?
Ja, das legen Studien nahe. Die Arbeit fordert die statusorientierte Person sehr, der Effekt schwächt sich aber etwas ab, wenn die Politik eine Reihe von familienfreundlichen Maßnahmen anbietet, wie etwa Elternzeit.
Sie haben sich Daten aus 26 Ländern zum Statusstreben angesehen und sie miteinander verglichen.
Ja. Generell gilt: Mit anhaltendem Wohlstand nimmt die Statusorientierung in den europäischen Ländern ab. Auch in Deutschland ist das Statusstreben insgesamt zurückgegangen. Beruflicher Erfolg ist hierzulande nicht mehr so zentral und es gilt oft als smart, für die Familie die Karriere hintanzustellen. In weniger reichen Ländern, etwa in den osteuropäischen, ist Statusstreben hingegen verbreiteter. In Polen beispielsweise, das zeigt unsere Auswertung, gibt es umso weniger Konflikte zwischen Arbeit und Familie, je stärker eine Person – meistens der Mann – nach Status und Erfolg strebt.
Stephanie Hess ist Soziologin und forscht an der Universität Magdeburg.
Quelle
Hess, S., & Schneickert, C. (2025). Status seeking and work-family conflicts: How the pursuit of wealth and success threatens family peace in 26 countries. Journal of Family and Economic Issues. DOI: 10.1007/s10834-024-09982-8