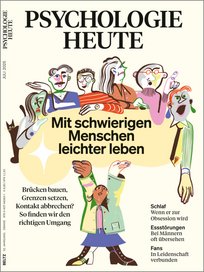Eigentlich begann die Karriere der Achtsamkeit recht unspektakulär irgendwann in den 1970er Jahren. Ein amerikanischer Molekularbiologe kehrte damals nach längeren Meditationsseminaren in Asien in seine Klinik zurück und überlegte, wie er auch seine Patienten an die gelernten Methoden heranführen könnte. Was er als hilfreich erlebt hatte, würde möglicherweise auch ihnen helfen, mit Stress und psychosomatischen Erkrankungen besser zurechtzukommen, so sein Gedanke.
Da er der Meinung war, dass sich seine…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
besser zurechtzukommen, so sein Gedanke.
Da er der Meinung war, dass sich seine Patienten wohl eher nicht tagelang auf Meditationskissen setzen würden, entwickelte er ein recht überschaubares Programm über acht Wochen, das vor allem aus Elementen der Vipassana-Meditation, Hatha-Yoga und Bewusstheitsübungen bestand. Mit den Teilnehmenden vereinbarte er ein wöchentliches Treffen und ermunterte sie, zwischen den Terminen täglich sogenannte Achtsamkeitsübungen zu praktizieren. Seine Methode nannte er akademisch-trocken MBSR – mindfulness-based stress reduction, zu Deutsch: achtsamkeitsbasierte Stressreduktion.
Lange Zeit, so erzählt Jon Kabat-Zinn, von dem hier die Rede ist, habe diese, seine erste Gruppe etwa in dem Rhythmus Nachwuchs bekommen, wie er bei Elefanten üblich ist: Alle paar Jahre wurde irgendwo ein weiteres MBSR-Training angeboten. Doch dann geschah das Unerwartete: Eines Tages vermehrten sich die Elefanten plötzlich wie die Kaninchen. Von überall auf der Welt erhielt Kabat-Zinn Anfragen, er wurde zu einem der weltweit gefragtesten Referenten. Heute ist Achtsamkeit längst zu einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen geworden.
Nicht nur MBSR-Gruppen entstanden in den vergangenen Jahren zu Tausenden überall auf der Welt, es wurden auch Dutzende von Achtsamkeitsschulungen für verschiedenste Zielgruppen entwickelt – von Eltern über Kinder zu Kindergärtnerinnen, Polizisten und so weiter. Vor allem an Schulen und im Managementbereich liegt Achtsamkeit im Trend. Das amerikanische Programm MindUP hat entsprechende Kurse bereits an mehr als 1000 Schulen durchgeführt. Besonders bekannt wurde das Google-Projekt Search inside yourself, ein Acht-Wochen-Training für Mitarbeitende des Internetriesen. Hunderte von Unternehmen haben Achtsamkeit als Ressource für ihre Mitarbeiter entdeckt; in Deutschland zählen dazu unter anderem Dax-Konzerne wie Siemens oder RWE.
Auch aus der modernen Psychotherapie und der Arbeit in psychosomatischen Kliniken ist das Konzept nicht mehr wegzudenken. Inzwischen sind Behandlungsansätze für fast alle Krankheitsbilder entwickelt worden, darunter Depressionen, Suchterkrankungen und Angststörungen. War Achtsamkeit früher eine fast schon belächelte Randerscheinung eher unbekannter Therapiemethoden wie Hakomi oder Focusing, ist sie heute Bestandteil der modernen Verhaltenstherapie, dem Inbegriff wissenschaftlich anerkannter Psychotherapie.
Dass Achtsamkeit sich als Mainstreambewegung eignet, war lange unvorstellbar. Vor 2600 Jahren von Buddha gelehrt, um eine grundlegende spirituelle Vertiefung zu erfahren, galt Achtsamkeit bis vor wenigen Jahren noch als esoterisch-anrüchig. Therapeuten, die sich mit buddhistischer Psychologie und Meditation befassten, sprachen nur hinter vorgehaltener Hand über solche Ansätze, zu groß war die Gefahr, als unwissenschaftlich disqualifiziert zu werden. Zudem ist Achtsamkeit, wenn sie richtig praktiziert wird, eine anspruchsvolle Angelegenheit, geht es doch um eine nicht bewertende Präsenz im gegenwärtigen Moment. Was zunächst fast banal klingen mag, ist bei genauerer Betrachtung ausgesprochen schwierig: Kaum jemand ist ohne Training in der Lage, längere Zeit im Augenblick zu verweilen und sich allen aufkommenden Empfindungen annehmend zu öffnen.
Die Gründe für den Achtsamkeitsboom vor allem in den westlichen säkularisierten Industrienationen sind vielfältig. Einer ist sicher die zunehmende Achtlosigkeit in unserer Kultur. Wer im Multitasking-Modus gar nicht mehr mitbekommt, wie das teure Sushi eigentlich schmeckt, der mag sich nach der Einfachheit der reinen Wahrnehmung sehnen. Daueraktivität führt zwangsläufig irgendwann zur Erschöpfung. Der Achtsamkeitsansatz ist die Gegenbewegung. Ihm zu folgen kann helfen, sich nicht länger von To-do-Listen durchs Leben jagen zu lassen, sondern wieder Zugang zur eigenen inneren Welt zu erhalten und sich vor Reizüberflutung und Beschleunigung zu schützen – eine Form der Selbstregulation in einer vom Stress übersteuerten Gesellschaft.
Vielerorts ist die Buddhafigur zum Inbegriff der Sehnsucht nach mehr Gelassenheit und Bewusstheit geworden. Aber auch spirituelle Bedürfnisse erfüllt das Achtsamkeitskonzept – und zwar ohne einen religiösen Überbau, dem viele Menschen heute keinen Glauben mehr schenken können. Meditation ist ein Ersatz für klassische christliche Rituale, zu denen sie keinen Bezug mehr haben.
Während in den USA und England bereits seit längerem kritische Stimmen zu diesem Hype um die Achtsamkeit zu hören sind, sind sie im deutschsprachigen Raum noch verhalten – doch es gibt sie. Von buddhistischer Seite wird vor allem angemerkt, dass es sich dabei auch um ein ethisches Konzept handele, das eine von Mitgefühl und Toleranz geprägte Haltung umfasst. Im Westen werde Achtsamkeit aber in erster Linie auf Entspannung und Konzentration reduziert.
Kritik kommt auch aus der Wissenschaft
Erfahrene Meditationslehrer machen darauf aufmerksam, dass es sich bei Meditation um einen sehr langwierigen und intensiven Prozess handelt. So beschreibt Andreas Remmel, der eine psychosomatische Klinik in Österreich leitet, Achtsamkeit als einen längerfristigen und anstrengenden Weg, der in der Regel mit langjähriger Praxis verbunden sei. Nicht zuletzt kommen kritische Anmerkungen von wissenschaftlicher Seite, denn die Studienlage ist alles andere als eindeutig. Zwar werden Effekte nachgewiesen, doch diese sind längst nicht so umfassend, wie teilweise suggeriert wird (siehe Interview, S. 30).
Viele hatten die Hoffnung, dass Achtsamkeit in der Lage ist, wieder die richtige Balance von Anspannung und Entspannung, Stress und Erholung, gedanklicher Aktivität und innerer Ruhe herzustellen. Doch seitdem sie nicht nur spirituelle Sucher, sondern zunehmend die Masse anspricht, ist auch ein Phänomen mit dem Spottnamen McMindfulness entstanden: Achtsamkeit ist selbst Teil der Beschleunigungs- und Selbstoptimierungskultur geworden, zu der sie ursprünglich einen Gegenpol bildete.
Achtsamkeitstrainings werden von Arbeitgebern finanziert, um die Leistungsfähigkeit ihrer Angestellten zu steigern. Achtsamkeit ist zu einem Produkt, wie jedes andere auch geworden, das konsumiert werden kann, um noch besser zu funktionieren. Die Versprechen, die sich in Seminarprospekten und auf Internetseiten finden, haben mit Achtsamkeit häufig nichts mehr zu tun.
Statt zu lernen, sich allen Empfindungen offen zuzuwenden, wird mit einem Mehr an positiven Gefühlen gelockt. Statt den eigenen Geist besser beobachten und sich so von seinen Inhalten distanzieren zu können, soll die Konzentrationsfähigkeit gefördert werden. Und das Ganze auf die Schnelle. Selbst ein Acht-Wochen-Kurs scheint mancherorts viel zu lang zu sein; stattdessen ist teilweise von Drei-Minuten-Achtsamkeit die Rede.
Der Achtsamkeitsforscher Stefan Schmidt vom Universitätsklinikum Freiburg klagt, dass Meditation für die Systemerhaltung instrumentalisiert werde und wir quasi gezwungen würden zu meditieren, um „wieder fit zu werden und den nicht menschengemäßen Takt halten zu können“. McMindfulness nutzt Achtsamkeit für die Belange der modernen Leistungsgesellschaft. Jede ethische Reflektion, jedes spirituelle Anliegen verschwindet dabei.
Vor einigen Jahren stellte das amerikanische Militär mehrere Millionen Dollar zur Verfügung, um ein Acht-Wochen-Programm für Soldaten zu entwickeln. Das sogenannte Mindfulness-based Mind Fitness Training (MMFT) hat nicht nur das Ziel, die psychische Widerstandskraft von Soldaten zu fördern und posttraumatischen Belastungsstörungen vorzubeugen; auch die Leistungsfähigkeit im Kampfeinsatz soll so verbessert werden. Spätestens bei diesem Ansatz dürfte manchem Achtsamkeitslehrer mulmig zumute werden.
Andreas Knuf ist als Psychologischer Psychotherapeut in eigener Praxis in Konstanz tätig. Daneben bildet er Mitarbeitende psychiatrischer Einrichtungen unter anderem in Achtsamkeitskonzepten aus. Er ist Autor des Buches Ruhe da oben! Der Weg zu einem gelassenen Geist (Arbor 2010).
LITERATUR
Chade-Meng Tan: Search Inside Yourself: Optimiere dein Leben durch Achtsamkeit. Goldmann 2015
Stefan Schmidt: Vom Meditieren in der beschleunigten Leistungsgesellschaft. Kulturveränderung oder Konsumprodukt? Buddhismus aktuell, 2, 2015, 22–25
Was bezeichnet Achtsamkeit genau?
Der Begriff Achtsamkeit ist die Übersetzung desenglischen Wortes mindfulness und darf nicht mitunserem umgangssprachlichen Verständnis vonAchtsamkeit im Sinne von „vorsichtig“, „konzentriert“ oder auch „respektvoll“verwechselt werden.In Achtsamkeitstrainings lernen die Teilnehmenden, bei dem zu verweilen, was sie in dem Moment,jetzt gerade wahrnehmen, auch wenn es ein unangenehmes Gefühl oder Langeweile sein mag. Siewenden sich also genau demzu, was in einer beschleunigten und reizüberfluteten Gesellschaftmeist vermieden wird: dem Jetzt.Sie lernen, Tätigkeiten wie Treppensteigen oder Essen achtsam, also bewusst auszuführen, ohne dabeizu telefonieren oder den morgigen Tag zu planen.Aber auch Gedanken oder Gefühle sollen sie wahrnehmen, ohne sie sofortmit Fernsehkonsum oderInternetshopping zu unterdrücken.Das Ziel der Übungen ist, sich den eigenen Empfindungen annehmend und offen zuzuwenden, ohnesie zu bewerten oder sofort verändern zu müssen.Achtsamkeit soll unter anderem zu mehr innererGelassenheit und Gleichmutführen. Die Identifikation mit Gedanken nimmt im Idealfall ab, unangenehme Gefühle lassen sich leichter ertragen, unddie Körperwahrnehmung verbessert sich.