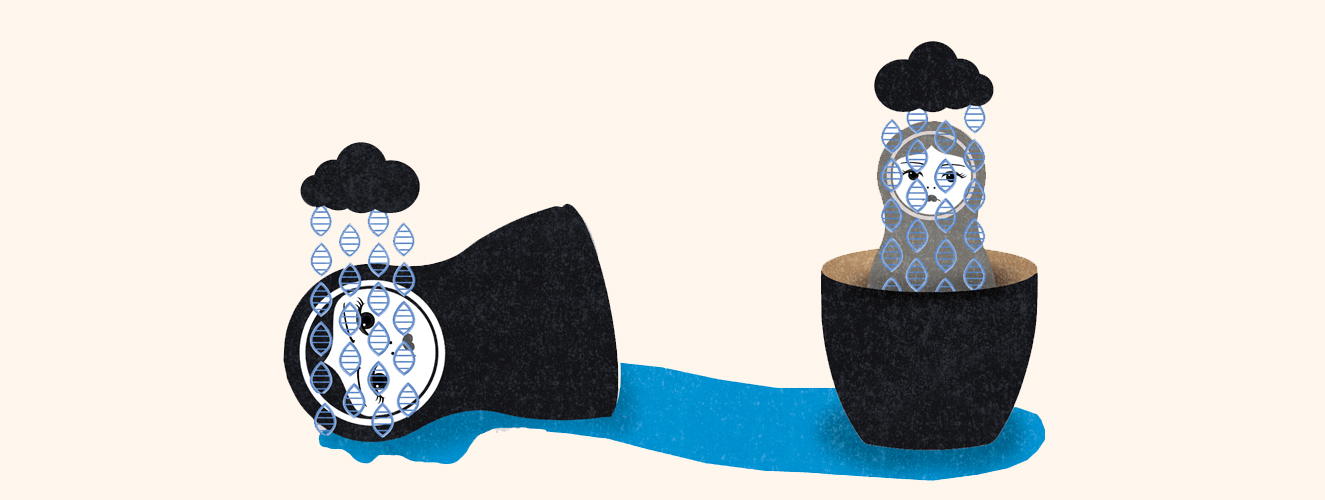Im Herbst 2018 veröffentlichten drei US-Wissenschaftlerinnen einen bemerkenswerten Befund. Sie hatten die Familiengeschichte von Männern unter die Lupe genommen, die in den 1860er Jahren im Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südstaaten gekämpft hatten. Ein Teil der Soldaten war in dieser Zeit in Gefangenschaft geraten – sie hatten dort unter oft menschenunwürdigen Bedingungen vegetiert.
Diese traumatische Erfahrung hatte generationenübergreifende Folgen: Wenn ehemalige Kriegsgefangene nach der Rückkehr zu ihren…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
zu ihren Familien Söhne zeugten, wurden diese oft nicht alt. Gegenüber vor dem Krieg geborenen Brüdern verstarben sie mehr als doppelt so häufig vor Erreichen ihres 45. Lebensjahres. Ursache war ein erheblich erhöhtes Risiko für Hirnblutungen und Krebserkrankungen. Bei den Töchtern fand sich diese Auffälligkeit nicht, ebenso wenig bei Kindern (Mädchen oder Jungen) von Soldaten, die nicht in Feindeshand geraten waren.
Es sieht fast so aus, als hätten die Ex-Gefangenen ihre Traumatisierung weitervererbt. Und zwar ausschließlich an ihre Söhne, die dadurch anfälliger für lebensbedrohliche (und möglicherweise stressbedingte) Erkrankungen wurden. Diese These vertreten jedenfalls die Autorinnen: „Unsere Beobachtungen passten am besten zu einer epigenetischen Erklärung“, schreiben sie.
In den Kinderschuhen
Die Epigenetik ist ein noch junges Forschungsfeld. Der Wortzusatz epi (Altgriechisch: danach, dazu, außerdem) signalisiert, dass die Wissenschaft hier gerade eine Art Anhang zur Genetik schreibt. Die Epigenetik rüttelt an der klassischen genetischen Sicht, wonach sich persönliche Lebenserfahrungen, so dramatisch sie auch sind, nie auf die Gene auswirken. Ein Mensch verändert sich, sein Genom aber bleibt (von zufälligen Mutationen abgesehen) nach klassischer Lesart stets dasselbe.
Dieser Grundsatz gilt zwar nach wie vor als zutreffend, doch mit einem Postskriptum, das die Epigenetik hinzugefügt hat: Menschliche Erfahrungen – hier insbesondere lebensbedrohliche Erlebnisse – drücken unserem Erbgut durchaus ihren Stempel auf. Doch nicht dadurch, dass sie unsere Gene verändern, sondern indem sie beeinflussen, welche dieser Gene aktiviert werden können und welche nicht.
Dadurch können Umwelteinflüsse das Muster der aktiven Gene verändern, und das sogar langfristig – mit erheblichen Auswirkungen auf den ganzen Organismus und damit wahrscheinlich auch auf die Psyche. Diese genetischen Schalterstellungen werden durch chemische Modifikationen – Experten sprechen auch von epigenetischen Markern – in unser Genom „eingraviert“. Immer mehr Studien scheinen zudem zu belegen, dass wir dieses Muster (unsere „epigenetische Programmierung“) an unsere Nachkommen weitergeben können.
Falls das stimmt, vererben wir mit der Eizelle oder dem Spermium also auch ein Stück unserer Erfahrungen. Tatsächlich ist bekannt, dass Kinder von traumatisierten Vätern oder Müttern häufiger ihrerseits unter Depressionen oder Angsterkrankungen leiden. Die Züricher Wissenschaftlerin Isabelle Mansuy sieht am Horizont bereits neue Möglichkeiten zur Traumabehandlung aufziehen – etwa eine „epigenetische Prophylaxe“ bei Personen und ihren Nachkommen, die traumatischem Stress ausgesetzt waren: Man könnte solchen gefährdeten Personen zum Beispiel Programme zur Stärkung ihrer psychischen Widerstandskraft anbieten.
Überinterpretierte Studie der Woche
„Alles großer Quatsch“, kommentiert Bernhard Horsthemke, Humangenetiker an der Universität Duisburg-Essen, der seit drei Jahrzehnten im Bereich Epigenetik forscht. Zwar weiß man, dass sich manche epigenetische Schalterstellungen infolge von Umwelteinflüssen ändern. Völlig uneins sind sich Experten aber in der Frage, ob diese Modifikationen bei der Zeugung an nachfolgende Generationen weitergegeben werden können.
Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Studien, die dieser These nachgehen. Leider lassen sich ihre Ergebnisse aber oft nicht eindeutig interpretieren. Ein Beispiel dafür ist eine Arbeit, die vor gut drei Jahren für Schlagzeilen sorgte. Die israelische Wissenschaftlerin Rachel Yehuda hatte darin – unter anderem zusammen mit Kollegen des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München – nach epigenetischen Spuren des Holocausts gesucht. Studienteilnehmer waren jüdische Frauen und Männer, die während des Zweiten Weltkriegs in einem Konzentrationslager gefangen waren oder gefoltert wurden oder sich verstecken mussten.
Die Forscher untersuchten, ob diese traumatischen Erlebnisse Spuren im Erbgut ihrer Probanden sowie von deren Kindern hinterlassen hatten. Dabei konzentrierten sie sich auf eine Erbanlage, die bei der Stressregulation eine wichtige Rolle spielt. Diese wird ihrerseits unter anderem über epigenetische Schalter gesteuert. Tatsächlich war bei Holocaustüberlebenden die Stellung dieser Schalter gegenüber Kontrollpersonen verändert und bei den Kindern der Betroffenen fand sich ebenfalls eine Abweichung von der Norm. In beiden Generationen zeigten sich zudem psychische Auffälligkeiten: Während die Hälfte der Eltern unter einem posttraumatischen Stresssyndrom litt, klagten ihre Kinder häufig über Angststörungen.
Der britische Guardian feierte die Studie als „klares Beispiel“ dafür, dass Umweltfaktoren die Gene unserer Kinder beeinflussen können. Allerdings spricht das Max-Planck-Institut selbst in einer Pressemitteilung etwas vorsichtiger von einem „Hinweis“ auf epigenetische Vererbung. Fachkollegen zeigten sich dagegen erheblich skeptischer. Der Epigenetiker John Greally vom Albert Einstein College of Medicine in New York bezeichnete die Arbeit in einem Blog-Artikel gar abwertend als „überinterpretierte epigenetische Studie der Woche“. Der Essener Forscher Bernhard Horsthemke sieht das ähnlich: „Die Studie ist ein Beispiel dafür, was man alles verkehrt machen kann.“
Verschiedene Zellen trotz identischer Gene
Um diese Kritik zu verstehen, muss man ein wenig in die Grundlagen der Genregulation einsteigen. Im Körper gibt es tausende unterschiedliche Zelltypen, die jeweils auf verschiedene Aufgaben spezialisiert sind. Eine Nervenzelle im Gehirn etwa erfüllt eine ganz andere Funktion als eine Fresszelle des Immunsystems oder eine Leberzelle. Das ist zunächst einmal erstaunlich, denn genetisch sind diese Zellen identisch: Sie sind letztlich alle aus derselben befruchteten Eizelle hervorgegangen.
Doch warum sind diese genetisch identischen Zellen dann so unterschiedlich? Erreicht wird diese Differenzierung unter anderem dadurch, dass während der Entwicklung des Embryos in verschiedenen Zellpopulationen unterschiedliche Erbanlagen aktiviert werden. Bei diesem Prozess spielt die Epigenetik eine wichtige Rolle.
Diversität und ihre Folgen
So hat eine Nervenzelle ein ganz anderes Muster epigenetischer Marker (oder auch „Schalterstellungen“) als eine Immunzelle. Um zu untersuchen, ob diese Marker an die nächste Generation vererbt werden, muss man also bei Eltern und Kindern Zellen eines bestimmten Typs miteinander vergleichen. Sonst überlagern die interzellulären Unterschiede die Ergebnisse.
Rachel Yehuda und ihre Kollegen haben ihre Analysen an Blutproben durchgeführt. Blut besteht aber aus einer ganzen Palette verschiedener Zellen, deren Anteile sich zudem von Person zu Person unterscheiden können. „Darüber hinaus kann ein Infekt diese Mengenverhältnisse noch einmal verschieben“, erklärt Jörn Walter, der an der Universität des Saarlandes die Arbeitsgruppe Epigenetik leitet. „Die epigenetischen Unterschiede, die wir in Blutproben finden, verschwinden daher häufig, sobald wir nach Zelltypen differenzieren.“
Erschwerend kommt hinzu, dass Menschen per se genetisch unterschiedlich sind (zumindest wenn es sich nicht um Zwillinge handelt). Diese Diversität hat ebenfalls Auswirkungen auf die epigenetischen Marker. „Je genauer wir alle Variablen in die Analyse miteinbeziehen, desto öfter müssen wir feststellen, dass anfangs gezogene Schlüsse oft nicht zu halten sind“, sagt Walter.
Mäuse mit Depressionen
Sein Kollege Bernhard Horsthemke sieht das ähnlich. Fast noch wichtiger ist ihm aber ein weiterer Punkt: Spricht es wirklich zwingend für eine Vererbung im genetischen Sinne, wenn man bei Kindern von Holocaustüberlebenden ähnliche epigenetische Muster findet wie bei ihren Eltern? Oder kann es nicht auch sein, dass die Traumatisierung der Eltern auch ihre Töchter und Söhne geprägt hat, etwa durch Verhaltensänderungen der Eltern aufgrund ihrer Stresserkrankung, die sich womöglich auf den Erziehungsstil auswirkte – oder durch Erzählungen und Rituale?
Dass es also die Last ihrer Familiengeschichte ist, die bei den Nachkommen der Traumatisierten als Reaktion wiederum epigenetische Änderungen hervorgerufen hat? „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht nur unsere Gene, sondern auch unsere Kultur und Umwelt an unsere Nachkommen weitergeben“, betont Horsthemke. Auch die Autorinnen der eingangs erwähnten Kriegsgefangenenstudie geben zu, psychologische oder kulturelle Effekte als Grund ihrer Befunde nicht völlig ausschließen zu können.
Bei Menschen ist es kaum möglich, solche Einflussfaktoren komplett zu eliminieren. Die belastbarsten Hinweise darauf, dass Traumatisierung vererbt werden kann, finden sich denn auch nicht beim Homo sapiens, sondern bei der Maus. Eine vielzitierte Studie dazu erschien Anfang 2014. Die Züricher Wissenschaftlerinnen Isabelle Mansuy und Katharina Gapp hatten neugeborene Mäuse phasenweise von ihren Müttern getrennt und so unter Stress gesetzt. Als ausgewachsene Tiere zeigten sie daraufhin unter anderem Verhaltensauffälligkeiten, die denen einer Depression ähnelten.
Schaltermoleküle
Diese Symptome ließen sich auch noch bei der Enkelgeneration nachweisen. Möglicherweise waren sie also die Folge einer epigenetischen Vererbung. Doch wie wurde diese Information übertragen? Um diese Frage zu beantworten, nahmen Mansuy und Gapp die männlichen Nachkommen gestresster Mäuse unter die Lupe. Genauer gesagt: ihre Spermien.
Und tatsächlich fanden sie dort eine Auffälligkeit: Die Samenzellen enthielten bestimmte „Schaltermoleküle“, sogenannte sncRNAs, die sich bei Kontrolltieren deutlich seltener fanden. Die Forscherinnen isolierten diese RNAs und spritzten sie in die befruchtete Eizelle normal aufgewachsener Mäuse. Die Tiere, die daraus hervorgingen, zeigten daraufhin ähnliche Depressionssymptome wie die Enkel gestresster Nager.
Diese Studie ist ein Hinweis darauf, dass die Folgen eines Traumas in Form epigenetischer Marker an die Nachkommen weitergegeben werden können – zumindest bei Mäusen. Von einem Beweis will aber selbst Katharina Gapp nicht sprechen. „Die Belege, die wir haben, sind sicher nicht schlecht“, sagt sie. „Insgesamt gibt es bei der Frage, ob stressbedingte Verhaltensänderungen vererbt werden können, aber noch zu wenig Folgestudien.“ Wenn sich die Ergebnisse erhärten, spricht das aus ihrer Sicht aber für die Annahme, dass es auch beim Menschen so sein könnte.
Ungeklärte Mechanismen
Über welche Mechanismen eine solche Weitergabe stattfinden könnte, ist allerdings noch offen. Denn eigentlich kommt es nach der Befruchtung der Eizelle zu einer Art „epigenetischem Reset“. Dabei werden nahezu alle Marker gelöscht. So ist gewährleistet, dass sich die Zellen des entstehenden Embryos in alle unterschiedlichen Gewebetypen verwandeln können. Jede Art von Programmierung, die sie auf ein bestimmtes Schicksal festlegen würde, muss dazu entfernt werden.
Zwar gibt es erste Hinweise darauf, dass manche Schalterstellungen diesen Reset überleben können. Außerdem existieren vermutlich noch weitere Möglichkeiten, mit denen epigenetische Informationen in die befruchtete Eizelle gelangen und dort überdauern können. Die von Katharina Gapp untersuchten sncRNAs sind dafür ein Beispiel. Dennoch ist der Vererbungsmechanismus alles andere als geklärt.
Wenn Forschung sexy sein soll
Horsthemke sieht daher noch viele offene Fragen. „Leider wird das Thema aber momentan gehypt, selbst in den großen Wissenschaftszeitschriften wie Nature oder Cell“, beklagt er. „Entsprechend leicht haben es solche Studien manchmal, veröffentlicht zu werden. Und dann stehen die Ergebnisse in der Literatur und man kann kaum noch dagegen ankämpfen.“
Der Humangenetiker hat kürzlich einen kritischen Artikel zur epigenetischen Vererbung veröffentlicht, gegen erheblichen Widerstand. „Dabei habe ich das Gebiet gar nicht verteufelt, sondern nur die Kriterien dargelegt, an denen die Studien sich in Zukunft ausrichten sollten.“
„Wir werden durch die Publikationsindustrie angetrieben, immer so sexy wie möglich zu schreiben“, kritisiert auch Katharina Gapp. Sie hält es für äußerst wichtig, die vorhandenen Befunde zu überprüfen – und zwar möglichst mit größeren Fallzahlen. So basieren die Ergebnisse von Rachel Yehuda und ihren Kollegen (verständlicherweise) lediglich auf Daten von 32 Holocaustüberlebenden und 22 Nachkommen.
So bleibt einstweilen offen, ob, wie und in welchem Ausmaß Traumatisierungen auf epigenetischem Weg an die Nachkommen weitergereicht werden. „Ich kann nicht ausschließen, dass es diesen Mechanismus gibt“, betont Bernhard Horsthemke. „Ich vermute aber, dass seine Auswirkung im Vergleich zur kulturellen Vererbung minimal ist. Und ich bin skeptisch, ob wir diese Zusammenhänge jemals sauber auseinanderhalten können.“
Epigenetik
Was ist Epigenetik?
Der Begriff Epigenetik wurde 1942 von dem englischen Entwicklungsbiologen Conrad Waddington geprägt. Er verwandte ihn für das Teilgebiet der Biologie, das sich mit den kausalen Zusammenhängen zwischen den Erbanlagen eines Organismus (seinem Genotyp) und seinem Erscheinungsbild (dem Phänotyp) beschäftigt. Heute wird der Begriff Epigenetik oft in einem engeren Sinn verstanden: als Studium der Erbgut-Modifikationen, die dazu führen, dass Gene häufiger oder seltener abgelesen werden.
Wie funktioniert die epigenetische Programmierung?
Unser Erbgut ist vergleichbar mit einer riesigen Bibliothek. Die einzelnen Bücher sind die Gene. Jedes dieser Bücher enthält die Bauanleitung für ein bestimmtes Molekül, etwa ein Enzym. Wenn die Zelle dieses Enzym benötigt, bestellt sie in der Bibliothek eine Abschrift des entsprechenden Buchs. Epigenetische Änderungen sorgen etwa dafür, dass manche Bücher dauerhaft unter Verschluss gehalten werden, während andere besonders leicht entliehen werden können. Der Mechanismus, der das bewerkstelligt, beruht auf chemischen oder strukturellen Modifikationen des Erbguts, die in ihrer Gesamtheit als Epigenom bezeichnet werden.
Was ist transgenerationale epigenetische Vererbung?
Durch Umwelteinflüsse – von frühkindlichen Traumata bis schädlichen Verhaltensgewohnheiten wie Rauchen – kann sich das Epigenom bestimmter Körperzellen ändern. Manche Studien deuten darauf hin, dass diese Änderungen über die Spermien des Mannes oder die Eizelle der Frau an nachfolgende Generationen weitergegeben werden können. Beim Menschen ist es schwierig, eine solche transgenerationale epigenetische Vererbung sauber nachzuweisen. So kann Rauchen in der Schwangerschaft nicht nur das Epigenom der Mutter, sondern (über die Gebärmutter) auch das des werdenden Kindes beeinflussen – und zwar auf direktem, nicht auf „vererbtem“ Weg.
Zum Weiterlesen
Bernhard Horsthemke: A critical view on transgenerational epigenetic inheritance in humans. Nature Communications, 9, 2018. DOI: 10.1038/s41467-018-05445-5
Dora L. Costa u.a.: Intergenerational transmission of paternal trauma among US Civil War ex-POWs. PNAS, 115/44), 2018, 11215–11220. DOI: 10.1073/pnas.1803630115
Ute Deichmann: Epigenetics: The origins and evolution of a fashionable topic. Developmental Biology, 416/1, 2016, 249–254. DOI: 10.1016/j.ydbio.2016.06.005
Katharina Gapp u.a.: Implication of sperm RNAs in transgenerational inheritance of the effects of early trauma in mice. Nature Neuroscience, 17, 2014, 667–669. DOI: 10.1038/nn.3695
Bernhard Horsthemke: A critical view on transgenerational epigenetic inheritance in humans. Nature Communications, 9, 2018. DOI: 10.1038/s41467-018-05445-5
Ali Jawaid u.a.: Transgenerational epigenetics of traumatic stress. Progress in Molecular Biology and Translational Science, 158, 2018, 273–298. DOI: 10.1016/bs.pmbts.2018.03.003
Ksenia Skvortsova u.a.: Functions and mechanisms of epigenetic inheritance in animals. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 19, 2018, 774–790. DOI: 10.1038/s41580-018-0074-2
Rachel Yehuda u.a.: Holocaust exposure induced intergenerational effects on FKBP5 methylation. Biological Psychiatry, 80/5, 372–380. DOI: 10.1016/j.biopsych.2015.08.005