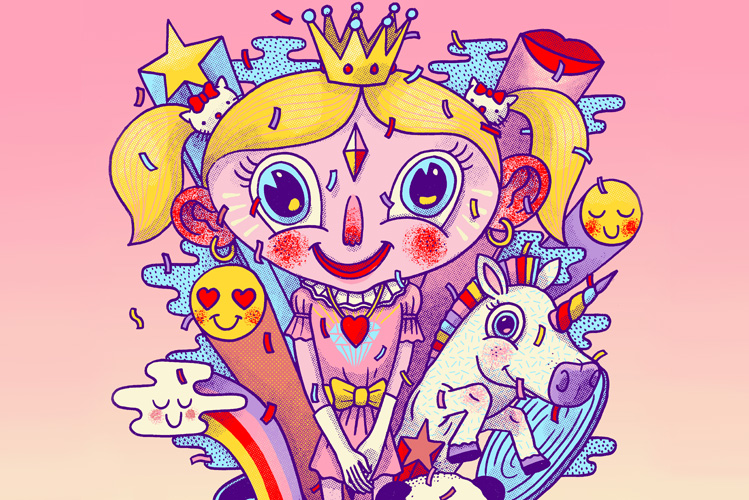Nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht? Keineswegs. Im Spätsommer 2019 ereignete sich im Berliner Zoo überaus Erfreuliches: Die Bärendame Meng Meng brachte am 31. August Zwillinge zur Welt – „die erste Panda-Geburt in Berlin“, wie die Hauptstadtpresse stolz vermeldete. Die frohe Botschaft verbreitete sich rasend schnell – wer bei Google „meng meng twins“ eingibt, dem liefert die Suchmaschine mehr als 15 Millionen Treffer. Doch warum üben die schwarzweiß gefleckten Tiere eine solche…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
die schwarzweiß gefleckten Tiere eine solche Faszination aus?
Es sind wohl verschiedene Punkte, die zur Popularität von Ailuropoda melanoleuca, so der wissenschaftliche Name des Riesenpandas, beitragen: seine Seltenheit – weltweit existieren nach chinesischen Angaben nur noch 1864 freilebende Exemplare. Der Umstand, dass die Weibchen nur wenige Tage im Jahr paarungsbereit sind. Vor allem aber wohl die Tatsache, dass viele Menschen Pandas auf fast unwiderstehliche Weise niedlich finden: ihre pummelige Gestalt; den großen Kopf mit den schwarzen Augenflecken, die ihre Augen riesig erscheinen lassen; ihre Fähigkeit, auf den Hinterbeinen zu laufen und sogar Purzelbäume zu schlagen.
Konrad Lorenz prägte für diese Merkmale bereits in den 1940er Jahren den Begriff „Kindchenschema“ – und lieferte zusätzlich eine Erklärung, warum wir uns von ihnen so angesprochen fühlen. Ihm war aufgefallen, dass menschliche Säuglinge, aber auch viele Jungtiere charakteristische Eigenschaften aufweisen: eine kleine Nase, ein rundliches Gesicht, große Augen, unbeholfene Bewegungen.
Der „Kümmer-Instinkt“
Lorenz stellte die These auf, dass diese Merkmale bei erwachsenen Tieren einen „Kümmer-Instinkt“ auslösen. „Kinder signalisieren damit, dass sie hilflos sind“, erklärt Judith Burkart, Anthropologieprofessorin an der Universität Zürich. „Erwachsene reagieren auf solche Signale in der Regel sehr stark. Aus evolutionsbiologischer Sicht ist das natürlich ein ausgesprochen sinnvoller Mechanismus.“
Es gibt eine ganze Reihe von Befunden, die diese Interpretation stützen. So legten in einer 2001 erschienenen Studie Säuglinge auf einer Frühgeborenenstation umso mehr an Gewicht zu, je süßer sie waren – vermutlich weil die Pfleger sich besser um sie kümmerten. Vor eine (hypothetische) Adoptionsentscheidung gestellt, bevorzugen Versuchspersonen zudem regelmäßig niedliche Kinder gegenüber weniger niedlichen.
In eine ähnliche Richtung deuten Ergebnisse des Schweizer Sozialpsychologen Janek Lobmaier: Er präsentierte Frauen zwei Varianten eines Kleinkindgesichts. Eine davon hatte er zuvor am Computer niedlicher gemacht, indem er die Augen vergrößert und die Wangen etwas gerundet hatte. Die Teilnehmerinnen sollten nun angeben, welches der Kinder sie lieber babysitten würden.
Meist entschieden sie sich für das süßere der beiden. „Die Natur hat es offenbar so eingerichtet, dass wir auf Niedlichkeitsmerkmale besonders abfahren und uns um ein kleines hilfsbedürftiges Wesen besonders kümmern“, sagt er. „Es ist leider so – und das ist sicher ein bisschen unfair –, dass niedliche Kinder es im Leben einfacher haben, weil ihnen mehr Zuneigung entgegengebracht wird.“
Niedlichkeit als Trigger
Tatsächlich scheinen uns süße Babygesichter ebenso anzufixen wie eine Tafel unserer Lieblingsschokolade: Hirnscanstudien zufolge aktivieren sie in unserem Gehirn das Belohnungssystem – ein Netzwerk von Nervenzellen, die Verlangen und Motivation steuern. Und das ausgesprochen flott, wie der Oxforder Neurowissenschaftler Morten Kringelbach zeigen konnte: Bereits eine Siebtelsekunde nach dem Anblick eines Säuglings liefen bei seinen Probanden bestimmte Hirnbereiche zur Hochform auf. Bei Erwachsenengesichtern blieb diese Reaktion dagegen aus.
Es löst in vielen Menschen also einfach gute Gefühle aus, wenn sie ein Kleinkind auf dem Schoß der Eltern oder beim Spiel in der Sandkiste beobachten. Manche Wissenschaftler gehen aber inzwischen davon aus, dass das gar nicht so viel mit elterlichen Instinkten zu tun hat, wie Konrad Lorenz annahm. Die US-Psychologen Gary Sherman und Jonathan Haidt etwa sehen Niedlichkeit ganz allgemein als Trigger sozialer Kontaktaufnahme.
Für diese These spricht unter anderem, dass es meist gar nicht die Neugeborenen sind, die uns besonders ansprechen, obwohl sie ja am hilfsbedürftigsten sind. Stattdessen finden wir Kleinkinder bis zu einem Alter von rund neun Monaten zunehmend niedlicher; danach bleiben sie einige Jahre auf diesem Niveau.
Zeichen sozialer Toleranz
Für Joshua Paul Dale, Kulturwissenschaftler an der Gakugei-Universität in Tokio und Mitherausgeber des Buches The Aesthetics and Affects of Cuteness, greift der Erklärungsansatz von Lorenz denn auch zu kurz. Er beruft sich dabei unter anderem auf die sogenannte „Selbstdomestikationshypothese“. Ihr zufolge hat der Homo sapiens sich im Laufe der Evolution gewissermaßen selbst „domestiziert“ und ist so sanftmütiger und kooperativer geworden.
Gleichzeitig änderte sich auch sein Aussehen: Die mächtigen Augenwülste verschwanden ebenso wie der ausladende Kiefer; sein Gesicht wurde rundlicher, seine Gestalt insgesamt kindlicher. Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von Neotenie oder „Verjugendlichung“ – ein Prozess, der bei der Domestikation von Tieren häufig zu beobachten ist.
Möglicherweise seien es gerade diese Merkmale des domestizierten Menschen gewesen, die den sozialen Austausch mit Fremden ermöglicht oder zumindest erleichtert hätten, schlug unlängst der Paläobiologieprofessor Marcelo Sánchez vor: Sie könnten als Zeichen „sozialer Toleranz und Freundlichkeit“ gedient haben – nach dem Motto: Ich sehe nett aus, also geht von mir keine Gefahr aus. Vielleicht sind manche der Merkmale, die wir heute mit Niedlichkeit assoziieren, also die Basis unseres ausgeprägten Hangs zu Vertrauen und Kooperation.
Sánchez spricht dabei auch von einem „ehrlichen“, also nicht fälschbaren Signal für Vertrauenswürdigkeit, denn wir können unseren Körperbau nur in engen Grenzen willentlich ändern. Das schließt nicht aus, dass wir uns gezielt „süß“ verhalten, um weniger bedrohlich zu erscheinen oder unsere Ziele durchzusetzen.
Ein Beispiel dafür ist ein Phänomen, das in Südkorea unter der Bezeichnung aegyo bekannt ist: Junge Frauen stampfen gespielt trotzig mit den Füßen auf, wenn ihnen ein Wunsch verwehrt wird; sie sprechen kindlich, ziehen eine Schnute oder verbergen ihr Gesicht hinter den Händen, wenn ihnen etwas peinlich ist.
Süß sein, um etwas zu bekommen
Dieses Verhalten beschränkt sich nicht auf die Beziehung zu Freunden oder Partnern, sondern wird – in abgemildeter Form – auch am Arbeitsplatz praktiziert: Sich süß, unschuldig und hilfsbedürftig zu geben ist eine Möglichkeit, sich in einer männerdominierten Gesellschaft durchzusetzen. In einer unlängst erschienenen Feldstudie der Wissenschaftlerin Yewon Hong gaben 40 Prozent der Befragten in Südkorea an, Frauen, die sich auf diese Weise verhielten, hätten sowohl im Privatleben als auch im Beruf Vorteile. Gerade Männer bewerteten es positiv, wenn sich Kolleginnen auf diese Weise „klein machten“.
Nicht nur Feministinnen dürfte bei diesen Ergebnissen das Gruseln kommen… Aber auch unserem Kulturkreis ist diese Strategie vertraut. „Kinder lernen solche Verhaltensweisen sehr schnell, weil sie merken, dass sie wirken“, glaubt der Sozialpsychologe Janek Lobmaier. „Weil sie die Schokolade eben eher bekommen, wenn sie süß lächeln, anstatt zu quengeln.“ Erwachsene setzten manchmal den Hundeblick auf, um zu erreichen, was sie wollen.
Das gelte nicht nur für Frauen, auch wenn diese sich aufgrund tradierter Geschlechterrollen möglicherweise häufiger als Männer so verhielten. Lobmaier spricht von einer „spielerischen Form der nonverbalen Kommunikation“, bei der allen Beteiligten ganz klar sei, was damit erreicht werden solle.
Viele Koreanerinnen sehen in Aegyo einfach eine Möglichkeit, eine Situation aufzulockern und soziale Nähe oder Wärme zu schaffen – auch das ein Ergebnis von Hongs Feldstudie. Ohnehin scheint das Niedliche gerade in den ostasiatischen Ländern mit ihren oft streng hierarchischen Gesellschaften besonders erfolgreich zu sein. Als Epizentrum dieser Entwicklung gilt Japan, wo Produkte wie Hello Kitty, das Pokémon Pikachu oder süße Modeartikel inzwischen ein fester Bestandteil der Kultur sind.
Dieser Lebensstil trägt einen Namen, der zunehmend auch im Westen geläufig ist: kawaii. „Anders als Aegyo ist Kawaii keine Strategie, um etwas zu bekommen, was man haben möchte“, betont der Kulturwissenschaftler und Niedlichkeitforscher Joshua Paul Dale. „Kawaii ist das reine und unverfälschte Gefühl, das wir erleben, wenn wir etwas süß finden. Die japanische Kawaiikultur hat die Gelegenheiten maximiert, diese Erfahrung zu machen.“
Etwas Beunruhigendes schwingt mit
Für Joshua, anders als bei Jugendkulturen wie dem Rock’n’Roll oder Punk, seien die treibenden Kräfte hinter Kawaii Frauen gewesen, sagt Dale. Daher basiere Kawaii auch nicht auf Coolness und Distanz: „Im Gegenteil – wenn wir etwas süß finden, wollen wir uns ihm nähern.“ Für Dale erklärt sich daraus zumindest zum Teil der Siegeszug des Niedlichen, der inzwischen auch in Ländern des Westens zu beobachten ist.
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist sicher, dass sich die Kawaiikultur immer wieder neu erfindet. Beispielsweise mischen japanische Designer heute ohne Hemmungen süße und eher verstörende Design-Elemente – etwa indem sie Hello Kitty im Gothicstil kleiden. Ein ähnlich gelagertes Beispiel ist der große Erfolg von Girlbands, die statt J-Pop Heavy Metal spielen. Der britische Philosoph Simon May sieht diese Brüche, wenn auch in abgeschwächter Form, in vielen niedlichen Objekten: Oft schwinge neben dem vordergründig Süßen noch etwas Merkwürdiges, Beunruhigendes mit.
Und gerade diese Doppelbödigkeit sei es, die einen Teil der Attraktivität ausmache. Als Beispiel nennt er das Katzenmädchen Hello Kitty, das keinen Mund hat. Wie die Erfinderin von Hello Kitty einmal erklärte, eigne sich das Kätzchen gerade deshalb als Projektionsfläche für alle erdenklichen Gefühle.
Der Siegeszug der Emojis
Auch im Westen haben Produktdesigner die Macht des Süßen schon seit langem erkannt. Nicht umsonst spricht uns der „Mini“ mit seinen großen runden Scheinwerferaugen und der pausbäckigen Motorhaube emotional so sehr an. „Diese Reaktion auf niedliche Merkmale ist in unseren Gehirnen fest verdrahtet, einfach weil sie für uns so wichtig ist“, sagt der Berner Sozialpsychologe Janek Lobmaier. Herzige Fotos oder putzige Tiervideos sorgen daher nahezu unweigerlich für ein „Oh, wie süüüß“-Gefühl.
Dass sich diese Ästhetik gerade in den letzten Jahren so massiv ausbreitet, dürfte auch an den technischen Möglichkeiten liegen: Was gibt es Schöneres, als Freunde und Bekannte via Facebook und WhatsApp an dem emotionalen Kick partizipieren zu lassen? Selbststilisierte Grafiken appellieren an diesen uralten Mechanismus; davon zeugt nicht zuletzt der Siegeszug der Emojis.
Niedlichkeit als politisches Instrument
Die Volksrepublik China nutzt den Panda seit einigen Jahrzehnten sehr erfolgreich als informellen Botschafter, um ihr Image im Ausland zu verbessern. Auch die Berliner Bärendame Meng Meng ist eine Leihgabe aus dem Reich der Mitte. Der deutsche Sinologe und Kommunikationswissenschaftler Falk Hartig hat vor einigen Jahren in einem Zeitschriftenaufsatz ausgeführt, dass Zoos für diese Ehre sehr viel Geld an China bezahlen müssen.
Und trotzdem buhlen Zoos rund um den Globus um die seltenen Pandas, vermutlich wegen des enormen PR-Effekts, den sie für die Tierparks generieren. So wurden schon vor der Geburt der Zwillinge in Berlin in deutschen Medien alle Themen rund um Meng Mengs Schwangerschaft diskutiert: Sei es, dass die Ursache für deren längeres Nichtzustandekommen in ihrem zurückhaltenden Partner gesehen wurde („Ist Jiao Qing Meng Meng zu schüchtern?“), sei es, dass niemand etwas von einer vielleicht doch vorhandenen Schwangerschaft erfuhr, weil die Panda-Lady womöglich „keine Lust auf Ultraschall“ hatte.
Und natürlich wird die Öffentlichkeit seit der Geburt permanent weiter über das Leben der Zwillinge auf dem Laufenden gehalten – die Pandas sind aber auch zu niedlich!
Literatur
Simon May: The power of cute. Princeton University Press, Princeton 2019
Marcelo R. Sánchez-Villagra, Carel P. van Schaik: Evaluating the self-domestication hypothesis of human evolution. Evolutionary Anthropology, 28/3, 2019, 133–143. DOI: 10.1002/evan.21777
Gary D. Sherman, Jonathan Haidt: Cuteness and disgust: The humanizing and dehumanizing effects of emotion. Emotion Review, 3/3, 2011, 245–251. DOI: 10.1177/1754073911402396
Joshua Paul Dale: Cute studies: An emerging field. East Asian Journal of Popular Culture, Band 2, Ausgabe 1, 2016, S. 5-13. DOI: 10.1386/eapc.2.1.5_2
Joshua Paul Dale u. a.: The Aesthetics and Affects of Cuteness. Routledge, New York, 2016. DOI: 10.4324/9781315658520
Melanie L. Glocker u. a.: Baby schema modulates the brain reward system in nulliparous women. PNAS, Band 106, Ausgabe 22, 2009 S. 9115–9119. DOI: 10.1073/pnas.0811620106
Falk Hartig: Panda Diplomacy: The Cutest Part of China’s Public Diplomacy. The Hague Journal of Diplomacy, Band 8, 2013, S. 49-78. DOI: 10.1163/1871191X-12341245
Morten L. Kringelbach u. a.: A Specific and Rapid Neural Signature for Parental Instinct. PLoS ONE, Band 3, Ausgabe 2, 2008. DOI: 10.1371/journal.pone.0001664
Janek S. Lobmaier u. a.: Menstrual cycle phase affects discrimination of infant cuteness. Hormones and Behavior, Band 70, 2015, Seiten 1-6. DOI: 10.1016/j.yhbeh.2015.02.001
Simon May: The Power of Cute. Princeton University Press, Princeton, 2019
Aljosa Puzar und Yewon Hong: Korean Cuties: Understanding Performed Winsomeness (Aegyo) in South Korea. The Asia Pacific Journal of Anthropology, Band 19, Ausgabe 4, 2018, S. 333-349. DOI: 10.1080/14442213.2018.1477826
Marcelo R. Sánchez-Villagra und Carel P. van Schaik: Evaluating the self-domestication hypothesis of human evolution. Evolutionary Anthropology, Band 28, 2019, S. 133-143. DOI: 10.1002/evan.21777
Gary D. Sherman und Jonathan Haidt: Cuteness and Disgust: The Humanizing and Dehumanizing Effects of Emotion. Emotion Review, Band 3, Ausgabe 3, 2011, S. 245–251. DOI: 10.1177/1754073911402396
Lyudmila Trut u. a.: Animal evolution during domestication: the domesticated fox as a model. Bioassays, Band 31, Ausgabe 3, 2009, S. 349-360. DOI: 10.1002/bies.200800070