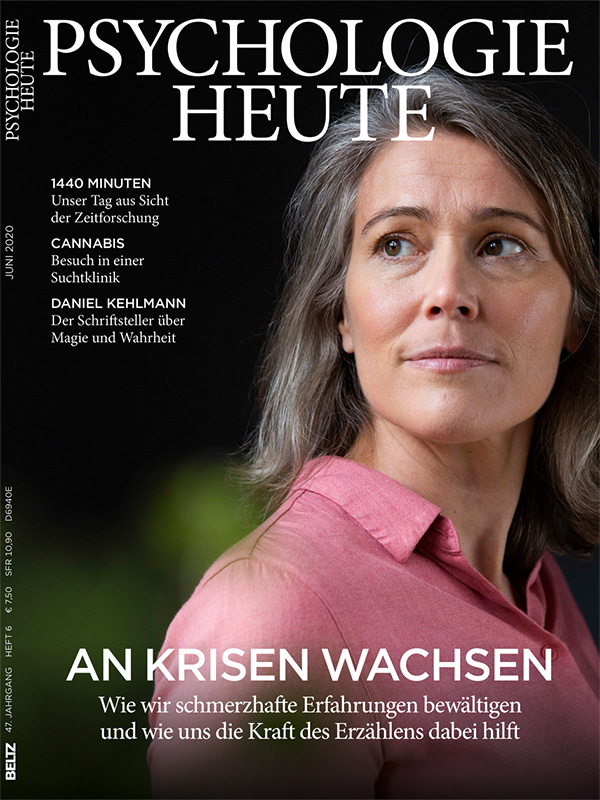Herr Knipphals, ein Leben ganz ohne Krisen, wäre das nicht wunderbar?
Das wäre ein Leben wie im Märchen: „Und dann lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage.“ Ich habe aber den Verdacht, das wäre kein reales Leben – und auch kein wünschenswertes. Viele Menschen, die ich kenne, haben doch den Anspruch, das Leben ganz kennenzulernen, alles Mark des Lebens auszusaugen, wie es in Henry Thoreaus berühmten Buch Walden heißt. Und zum Leben gehören eben auch die Tiefen.
Was ist gegen ein von außen gesehen „fades“…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
Buch Walden heißt. Und zum Leben gehören eben auch die Tiefen.
Was ist gegen ein von außen gesehen „fades“ Leben ohne große Höhen und Tiefen einzuwenden? Ein Leben, in dem man sich häuslich auf Dauer eingerichtet hat: Familie, täglich zur Arbeit fahren, am Wochenende Gärtchen, Freude auf den nächsten Urlaub.
Wer Lust darauf hat: gern. Ich habe damit keine Probleme, aber eine gewisse Skepsis, dass das so klappen kann. Denn zu einem solchen Leben gehören ja mindestens zwei, und nicht jeder möchte seine Konflikte verdrängen. In den fünfziger und sechziger Jahren hatten wir homogene, sittsame Lebensentwürfe dieses Zuschnitts. Wer sich da nicht anpassen wollte oder konnte, wer nicht die Glücksvorstellungen der Mehrheitsgesellschaft traf, hatte das Gefühl, dass bei ihm irgendetwas falsch im Kopf sein müsse. Wer etwa schwul war, war ausgeschlossen. Ein genormtes Leben produziert Zwang und manchmal Neurosen.
Produziert unser modernes Leben nicht ebenfalls Neurosen, nämlich solche, die aus Überforderung entstehen? Wir haben ja nicht nur die Freiheit, sondern auch den ständigen Druck, unser Leben selbst gestalten zu müssen.
Natürlich bringt der Druck, sich verwirklichen zu müssen, neue Probleme mit sich. Aber ich finde: Diese neuen Probleme sind doch so viel interessanter als die alten! Mit unserem Leben sind auch die Lebenskrisen komplizierter geworden.
„Warum Lebenskrisen unverzichtbar sind“ lautet der Untertitel Ihres Buchs Die Kunst der Bruchlandung. Wozu taugen Krisen?
Ohne Lebenskrisen wäre die Vorstellung eines eigenen Lebens nicht denkbar. Denn sobald man ein eigenes, vor allem ein intensives Leben führt, kann dies eben auch missglücken – etwa wenn zwei Lebenspartner feststellen, dass sie miteinander nicht mehr glücklich sind. Dann ist eine Lebenskrise unvermeidlich. Eine solche Krise kann etwas sehr Kreatives sein. Sie kann einen zum Beispiel anspornen, trotz aller Rückschläge an seinem Ziel festzuhalten.
Krisen können aber auch ein Anstoß sein, sein Leben neu auszurichten, statt im Unglück steckenzubleiben. Krisen halten uns lebendig, denn in der Krise spürt man den Widerstand des Materials des Lebens selbst. Woraus ist ein Leben gemacht? Das sind zum einen die eigenen Wünsche und was man damit anstellt, und das sind zum anderen menschliche Beziehungen. Und menschliche Beziehungen sind nun einmal nicht immer stabil, weder die zum Partner noch die zu den Eltern, den Kindern, den Kollegen. Man selbst ist auch nicht immer so hart und stabil, wie man denkt. In Krisen kommt etwas in Bewegung.
Übertreiben wir es nicht mit dem Krisenkult? Sie zählen in Ihrem Buch typische Krisen auf, denen Menschen heute ausgesetzt sind: Überforderungskrisen, Sinnkrisen, Beziehungskrisen, Selbstoptimierungskrisen, Identitätskrisen. Klingt das nicht nach Luxuskrisen für Leute, die sonst keine Sorgen haben?
Für mich nicht. Früher wurden Krisen verleugnet und ausgegrenzt. Eine Sinnkrise zu haben galt als „Charakterfehler“, das wurde allenfalls Künstlern zugestanden. Vielleicht haben wir in der Gegenbewegung tatsächlich eine Zeitlang zu viel über Krisen geredet oder in falschen Begriffen wie „Selbstoptimierung“ oder „Krisenmanagement“. Das klingt, als ob es hier ums Wirtschaften ginge. Es geht aber um uns. Krisen sind nichts Technisches, sie sind das Leben selbst.
Frühere Generationen haben elementarere Sorten von Krisen erlebt: verheerende Kriege, Hungersnöte, Seuchen. Haben wir durch Corona eine Ahnung davon bekommen, welche Schockwellen eine „echte“, eine umfassende Krise werfen kann?
Ja, das war ein Krisenschock. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass wir als Gesellschaft besser mit einer solchen Krise umzugehen gelernt haben als frühere Generationen. Nehmen Sie die „Spanische Grippe“, die zum Ende des Ersten Weltkriegs weltweit mehr Tote hervorbrachte als der Krieg. Diese Pandemie hat im kollektiven Gedächtnis kaum Spuren hinterlassen – welch eine Verdrängungsleistung, die den Menschen damals auferlegt wurde! Heute hingegen leben wir, wie die Kanzlerin sagte, in dem Bewusstsein: „Es geht um jeden einzelnen Menschen!“ Die Gesellschaft kämpft als ganze darum, dass so wenig Menschen wie möglich an dieser Infektion sterben.
Können solche großen Krisen, die alle um uns herum betreffen, vielleicht sogar entlastend sein, weil sie uns so in Beschlag nehmen, dass unsere persönlichen Sorgen in den Hintergrund treten?
Meine persönlichen Erfahrungen gehen in die umgekehrte Richtung: Wer Lebenskrisen hat, hat sie jetzt noch mehr. Eine umfassende Krise wie Corona löst ja nicht die persönlichen Krisen. Zwar muss man jetzt mit Einschränkungen kämpfen, wie man sie sich nie hat vorstellen können. Aber das ist keine Entlastung, sondern eine zusätzliche Bürde.
Krisen sind schmerzhaft. Kann der Schmerz zu etwas gut sein?
Was wäre die Alternative zum Schmerz? Entweder Verleugnung, so wie in der Generation meines Großvaters: „Ein Indianer kennt keinen Schmerz.“ Oder die andere Alternative: in ein Loch fallen. Schwärze. Depression. Ob der Schmerz für etwas gut ist, weiß ich nicht. Aber man sollte lernen, ihn anzunehmen und zu leben. Bis hoffentlich das Licht am Ende des Tunnels in Sicht kommt.
Reifen wir an Krisen? Haben wir mit jeder überwundenen Krise einen immer praller gefüllten Kasten an Bewältigungswerkzeugen, die uns zur Verfügung stehen, wenn die nächste Krise naht?
Ach, jede neue Krise kann einem die Füße wegziehen. Selbst etwas so zum Klischee Gewordenes wie die Midlife-Crisis hat etwas Brutales, wenn sie einen erwischt. Da hilft es einem dann auch nicht, wenn man damals die Pubertätskrise erfolgreich gemeistert hat. Aber der gesellschaftliche Werkzeugkasten zum Umgang mit Krisen ist heute besser gefüllt. Es gibt Therapien und Selbsthilfe. Das wichtigste Werkzeug ist: Man kann heute über Krisen reden, weil man sich Krisen zugesteht.
Dirk Knipphals, studierter Literaturwissenschaftler und Philosoph, ist Literaturredakteur bei der tageszeitung in Berlin. Sein Sachbuch Die Kunst der Bruchlandung. Warum Lebenskrisen unverzichtbar sind erschien bei Rowohlt Berlin.
Wollen Sie mehr zum Thema erfahren? Dann lesen Sie auch, wie wir neben Krisen in der Welt auch in normalen Zeiten Herausforderungen durchstehen – eine schwere Krankheit, eine Scheidung, den Verlust des Arbeitsplatzes – in An Krisen wachsen.