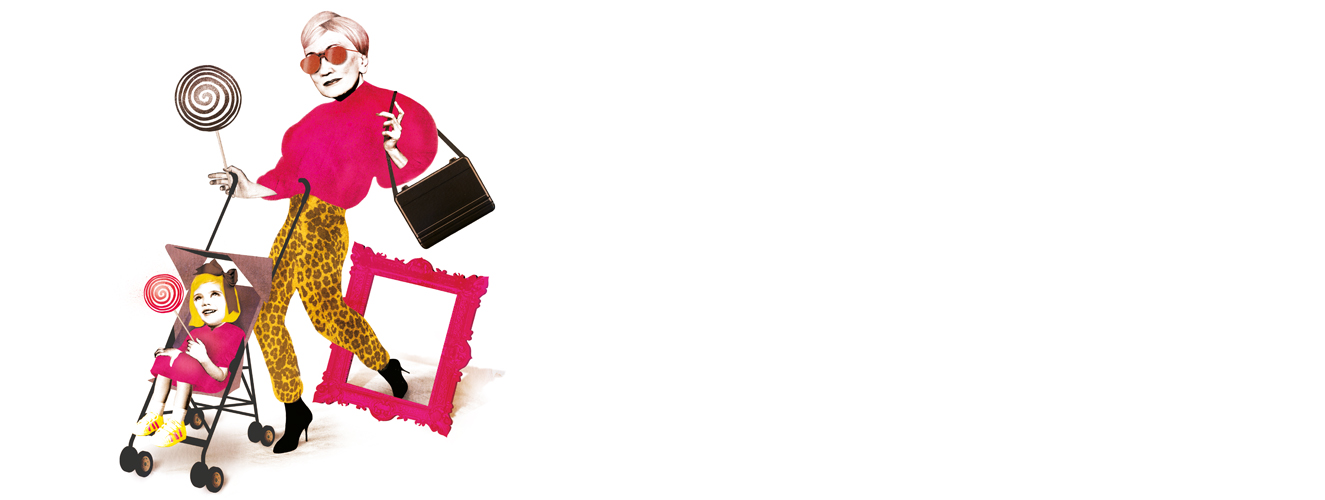Jedes Wort, das sie sprach, war voll Güte und Anstand, Duldung und Liebe“, so schrieb der Dichter und Politiker Gottfried Keller im 19. Jahrhundert über seine Großmutter. Auch andere große Literaten haben ihren Großeltern ein Denkmal gesetzt, etwa Johann Wolfgang von Goethe, Jean-Paul Sartre oder Thomas Bernhard. Oft transportieren ihre Zeilen ein klassisches Bild: von der gutmütigen, großherzigen Oma, die den Kindern Geschichten vorliest und heiße Suppe serviert. Von dem weisen, gelassenen Opa, der seinem…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
gelassenen Opa, der seinem Enkel eine Angelrute schenkt und die Welt erklärt.
Dieser Blick hat sich im 21. Jahrhundert wenig verändert: Noch immer wird kaum eine Bevölkerungsgruppe auf so hartnäckige Stereotype reduziert. „Es dominiert ein rosarotes Zuckerbäckerbild, das immer noch vom Biedermeier geprägt und extrem traditionell ist“, sagt der emeritierte Soziologieprofessor François Höpinger. „Die Großelternschaft wird, wenn man etwas übertreibt, als die letzte Säule des klassisch-bürgerlichen Familienmodells hochgehalten.“ Dabei habe die Diversifizierung von Lebensformen auch zu diverseren Stilen von Großelternschaft geführt. Patchwork-Konstellationen, gleichgeschlechtliche Eltern oder Scheidungen im späten Lebensalter verändern die Familienlandschaft. Und damit auch die Rolle der Großeltern.
Platz vier für die Enkel
Die Rahmenbedingungen für einen bereichernden Austausch zwischen Jung und Alt könnten in Deutschland kaum besser sein. Zwar werden Frauen heutzutage immer später Mutter (erst mit durchschnittlich 29,8 Jahren), zwar verschiebt sich die Geburt des ersten Enkels immer weiter nach hinten (auf ein Alter von durchschnittlich 52,6 Jahren), zwar kamen noch nie so viele Omas und Opas auf so wenige Enkelkinder (3,0 im Schnitt) – und dennoch: Die Psychologinnen Carolin Seilbeck und Alexandra Langmeyer vom Deutschen Jugendinstitut haben festgestellt, dass die demografische Entwicklung mehr Kontakt und erfülltere Beziehungen zwischen den Generationen ermöglicht.
„Die gemeinsam verbrachte Lebenszeit von Großeltern des Jahrgangs 1940 mit dem ersten Enkelkind beträgt im Durchschnitt 30 Jahre für Großmütter beziehungsweise 26 Jahre für Großväter“, schreiben die Wissenschaftlerinnen. „Dadurch können Großeltern ihre Enkelkinder einen längeren Teil ihres Lebensweges begleiten.“
Hinzu kommt, dass die älteren Jahrgänge in dieser Zeit noch nie so fit waren wie die rund 12 Millionen Großeltern von heute. Ein großer Teil der Nachkriegsjahrgänge habe vom wirtschaftlichen Aufschwung und der Bildungsexpansion der letzten Jahrzehnte profitiert, berichtet François Höpinger in seinem Aufsatz Großelternschaft im Wandel. Mit dem allgemeinen Wohlstand, der sozialen Absicherung und dem medizinischen Fortschritt sei auch die Zahl der gesunden Lebensjahre gestiegen.
„Das erleichtert den Kontakt zu Enkelkindern.“ Und verringert zugleich deren Bedeutung für den Alltag. So geben angehende Ruheständler in einer Erhebung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung erst einmal Pläne außerhalb der Familie für ihre Rente an: Reisen, Hobbys und Ehrenamt. Erst auf Rang vier landet der Wunsch, sich um die Enkelkinder zu kümmern.
Eine neue Schublade
Susanne Gutsch würde für sich eine etwas andere Reihenfolge aufstellen: „Den ersten Platz müssten sich Hobbys und Enkel teilen, danach käme der ganze Rest.“ Die Münchnerin, die mit ihrem asymmetrischen Kurzhaarschnitt, der roten Outdoorjacke und der sportlichen Figur dem Bild der tattrigen Oma klar widerspricht, will noch zwei Jahre arbeiten. Dann wird zusätzliche Zeit frei für ihre einjährige Enkeltochter und ihren dreijährigen Enkelsohn. Aber auch für das Ehrenamt in einer Partei, die Pilatesgruppe, die Radreisen mit ihrem Mann. „Die Zeit mit meinen Enkeln ist mir sehr wichtig, aber ich stelle mein restliches Leben dafür nur in Notfällen zurück.“
Intimität auf Distanz
Unabhängigkeit, wie sie am Beispiel Susanne Gutschs deutlich wird, ist eine der drei übergreifenden Entwicklungen, die die Forschung trotz der Vielfalt der modernen Großeltern benennen kann. „Eltern weisen Eingriffe der Großeltern in die Erziehung zurück“, weiß François Höpflinger. „Umgekehrt pochen auch die Großeltern auf ihre Autonomie.“ Überdies leben die verschiedenen Genrationen mittlerweile meist in getrennten Haushalten.
Die zweite übergreifende Entwicklung ist, dass die ältere der jüngeren Generation nur noch in Ausnahmefällen dabei helfe, ihren Alltag zu stemmen. Sie unterstütze flexibel und in besonderen Situationen: wenn die Kita Ferien macht, die Mutter auf Geschäftsreise ist oder der Vater mit Grippe auf dem Sofa döst. Damit existieren – drittens – keine klar formulierten Rechte und Pichten der Großeltern mehr. Die Beziehung zu ihren Enkelkindern ist freiwillig und individuell. „All diese Faktoren wirken sich positiv auf die Beziehungsqualität aus, weil dadurch viele Spannungen und Konfliktherde wegfallen“, so Höpflinger.
Enkel und Großeltern bilden heute also weit mehr als eine Zweckgemeinschaft. Zuneigung und emotionale Verbundenheit sind Studien zufolge die wichtigsten Triebfedern ihrer Beziehung. Wie bei Susanne Gutsch: „Vor allem wenn die Kinder klein sind, entsteht eine besondere Nähe. Sie lassen sich noch für fast alles begeistern: im Garten buddeln, Verstecken spielen, Lager bauen.“ Weil ihre Enkel fast 200 Kilometer entfernt leben, ist die Zeit begrenzt, in der sie gemeinsam die Welt erkunden können.
„Manchmal finde ich es sehr schade, dass wir weiter auseinander wohnen und Besuche immer mit längeren Fahrzeiten und Übernachtungen verbunden sind“, erzählt sie. „Aber die Entfernung hat natürlich auch ihre Vorteile: So rücken einem die Kinder nicht permanent auf die Pelle.“
Nur 36 Prozent der Enkelkinder leben heute im gleichen Ort wie Oma und Opa, das zeigen Daten des Deutschen Alterssurveys. Smartphones, Tablets und Skype ermöglichen, dass Großeltern trotzdem am Leben der Enkelkinder teilnehmen. Von einer „Intimität auf Distanz“ sprechen Soziologen deshalb, wenn sie moderne Großelternschaft beschreiben. Sie beobachten, dass sich mit den sozialen, wirtschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen auch die Rolle der Großeltern verändert.
Mehr Spaß als Pflicht
„Die verschiedenen Generationen sind sich in ihren Ansichten und Werthaltungen näher denn je“, sagt François Höpflinger. „Die Differenzen haben sich reduziert, weil sich die Älteren an neue Entwicklungen angepasst haben.“ Sie sind weniger regelkonform und konservativ als ihre Vorgänger, treten seltener als Erzieher auf und sie fühlen sich eher für den Freizeitspaß zuständig als für die Tischmanieren.
Mit Vorzügen und Nachteilen: Einerseits zanken sich die Großeltern seltener mit den Kindeseltern, andererseits lassen sie sich weniger stark in die Pflicht nehmen. „Ihre Rolle wird zum Aushandlungsgegenstand“, sagt der Soziologe.
Neue Rollen, alte Themen
Die Zeit der Rollenfindung fällt in eine Phase, die viele ältere Menschen ohnehin fordert. Der Eintritt in die Großelternschaft werde oft als unvergessliche Zäsur erlebt, meint Anton Bucher, Professor für Religionspädagogik an der Universität Salzburg, „als der Beginn eines neuen Lebensabschnitts“. Der Familienzuwachs kann dabei große Gefühle mit sich bringen – Vorfreude, Glück, Rührung –, aber auch Stress. Etwa wenn die werdenden Eltern noch Teenager sind, finanzielle Sorgen quälen oder das Enkelkind nicht gesund zur Welt kommt.
Nebenbei muss sich das Verhältnis zu den Kindern, deren Lebensgefährten und vielleicht auch dem eigenen Partner neu sortieren. Denn mit der Geburt eines Enkelkindes kommt das ganze Familiensystem in Bewegung, weiß die Familientherapeutin Marion Herrmann-Purkl. „Sichtweisen werden verändert, Rollen neu sortiert und die Aufmerksamkeit der Familienmitglieder verschiebt sich.“
Besonders herausfordernd wird es für alle Beteiligten, wenn das Verhältnis der Großeltern- und Elterngeneration belastet ist. „Dann wird das Enkelkind manchmal zum Brückenbauer“, sagt Marion Herrmann-Purkl. Der Familienzuwachs liefert neue gemeinsame Themen und einen Grund, sich öfter zu sehen.
Die Sozialpädagogin findet diese Entwicklung grundsätzlich positiv, „solange die Spannungen nicht vor dem Kind ausgetragen werden und das Kind nicht als Druckmittel eingesetzt wird“. Wenn die Beziehung stärker zerrüttet ist, können Enkelkinder das Verhältnis natürlich auch nicht kitten. „Ohne Aussprache und Bewältigung kann ein neues Familienmitglied nichts verändern. Vorwürfe müssen auf der Ebene der Erwachsenen bearbeitet werden – dort, wo sie hingehören.“
Dass Konflikte aus der Vergangenheit in neuer Konstellation aufbrechen, hat die systemische Familientherapeutin oft erlebt. „Durch die Geburt eines Enkelkindes kommen alte Themen an die Oberfläche. Die aktuellen Erfahrungen docken an vergangene Erlebnisse in der Familie an – sowohl bei den Großeltern als auch bei den Eltern.“ Diese Dynamik bringe Belastungen mit sich, eröffne aber gleichzeitig Chancen. So könne sich durch die eigene Mutter- oder Vaterschaft der Blick auf die Eltern verändern und ein größeres Verständnis entstehen. Auf der anderen Seite begegneten viele Großeltern ihren Kindern stärker auf Augenhöhe und spürten eine größere Verbundenheit, jetzt, wo aus den Kleinen selbst Mütter und Väter geworden sind.
Neues Leben kommt, altes vergeht
Mit den Umbrüchen im Familiengefüge gelte die Geburt der nächsten Generation als ein „zentrales familiäres Ereignis in der zweiten Lebenshälfte“, wie es in einem Bericht des Deutschen Zentrums für Altersfragen heißt, und die Großelternschaft als eine soziale Rolle mit „spezifischen Entwicklungsaufgaben für älter werdende Menschen“. Das hat auch Bärbel Sturm erlebt. „Ich war sehr aufgeregt, als ich erfahren habe, dass ich Oma werde“, erzählt die 74-Jährige. Sie arbeitet als Coach und Supervisorin in Nürnberg und engagiert sich als Vorstand bei Großeltern stiften Zukunft, einem Verein, der Enkel und Wunsch-Großeltern zusammenbringt.
Solche Zusammenschlüsse gibt es mittlerweile in vielen Kommunen, sie tragen zum intergenerationalen Austausch bei und sollen Kinder unterstützen, die keine Großeltern haben – oder keine in der Nähe. Zusammen mit ihrer Lebensgefährtin kommt Bärbel Sturm inzwischen auf sechs eigene Enkel zwischen einem und zwölf Jahren. In ihrem Bekanntenkreis und Vereinsumfeld erlebe sie immer wieder, dass das Großelternwerden auch Ängste auslösen kann: „Manche konfrontiert die Veränderung mit dem Alter und der Vergänglichkeit. Der Tod rückt dadurch näher.“
Auch abseits solch existenzieller Fragen stehen viele der Großeltern vor Herausforderungen. Die Häufigkeit, mit der sie die Kinder betreuen sollen, kann dabei ebenso zur Belastung werden wie die Ausgestaltung dieser Zeit. Nicht immer decken sich die eigenen Vorstellungen mit denen der Eltern. Wie viel Limo ist am Mittagstisch erlaubt? Darf das Kind zu oft vor dem Fernseher sitzen?
Eine Beziehung über drei Generationen
Konflikte offen auszutragen fällt vielen Großeltern allerdings schwer. Ist das Verhältnis zu den Enkelkindern doch immer Teil einer Drei-Generationen-Beziehung. Weil es in Deutschland – im Gegensatz zu den USA – keine formalen Besuchsrechte für die Großeltern gibt, sind sie abhängig vom Wohlwollen der Kindeseltern. Kritisch wird das vor allem im Scheidungsfall – wie die australischen Forscher Margaret Sims und Maged Rofail herausgefunden haben. Nach einer Trennung der Großeltern haben vor allem die Opas väterlicherseits weniger Kontakt zu ihren Kindern und Kindeskindern.
Aber auch eine Scheidung der Eltern kann die Beziehung zwischen der jüngeren und der älteren Generation gefährden – vor allem für die Großeltern väterlicherseits und vor allem dann, wenn die einstige Schwiegertochter das alleinige Sorgerecht bekommt. Daneben können Erbstreitigkeiten, der Tod eines Elternteils, Konflikte mit Schwiegersöhnen und -töchtern oder ein Streit mit den eigenen Kindern der Grund dafür sein, dass das Verhältnis ins Wanken gerät.
Während jugendliche oder erwachsene Enkel in diesen Fällen selbst den Kontakt zu den Großeltern suchen können, verschwinden jüngere Kinder manchmal ganz aus deren Leben. Mit schlimmen Folgen für die abgekanzelte Partei: „Eingeschränkte, schlimmstenfalls verweigerte Großelternschaft kann sich verheerend auswirken“, meint Anton Bucher. „Die Enkel sind zwar physisch nicht mehr präsent, aber psychisch noch lebendiger: als erinnertes Glück, Lebensernte, Stolz und zugleich als Hoffnung, sie wieder in die Arme schließen zu dürfen.“
Zur Sorge um die Enkel geselle sich der Schmerz um die verlorene Großelternrolle. Besonders schlimm ist die Trauer dann, wenn der Kontaktabbruch nicht durch Scheidung oder Streit verursacht wird, sondern den Tod eines Enkels. Studien zeigen, dass verwaiste Großeltern nicht selten unter posttraumatischen Störungen, Symptomen einer Depression oder schwerwiegenden körperlichen Problemen leiden.
Die Enkel als Jungbrunnen
Diesen Risiken und Nebenwirkungen steht eine ganze Palette an erfreulichen Erscheinungen gegenüber. Nicht umsonst wird die Großelternrolle von über 80Prozent der Omas und Opas als überaus positiv erlebt; das zeigen die repräsentativen Ergebnisse der Langzeitstudie pairfam. Einen Aspekt, der das erklären könnte, beschreibt auch Bärbel Sturm: „Mit Enkeln taucht man ein in eine Kinderwelt und wird dabei selbst wieder zum Kind.“ Womöglich teilte Victor Hugo diese Erfahrung, als er schrieb: „Enkelkinder sind die Morgenröte des Alters.“ Im Kontakt mit der jüngeren Generation bleiben die Älteren geistig und körperlich aktiv. Gebraucht zu werden und Erfahrungen weiterzugeben kann sie mit Stolz erfüllen. Bei den Jüngsten können sie außerdem nachholen, was sie als Eltern vielleicht verpasst haben.
Anton Bucher kommt deshalb zu dem Schluss: „Aktive Großelternschaft, zumal wenn sie freiwillig ist, kann ein Jungbrunnen sein, wird als belohnend erlebt, stärkt Bindungen, auch die zu den eigenen Kindern, schafft Sinn und nährt ein Gefühl des Dazugehörens, das eines der tiefsten menschlichen Bedürfnisse ist, aber auch ein Empfinden für die Beständigkeit des Lebens.“ Diesen „Verjüngungseffekt“ belegen zahlreiche Studien: Sie bescheinigen Großeltern bessere kardiovaskuläre Werte und ein kleineres Risiko für Demenz, außerdem ein höheres Wohlbefinden, ein ausgeprägteres Selbstwertgefühl und geringere Depressivität.
Wie Großelternschaft wirkt, hängt aber vor allem davon ab, wie sie gelebt wird „Es ist wichtig, die Erwartungen, Sorgen und Wünsche des jeweils anderen zu kennen“, weiß Bärbel Sturm. Sie hat sich vor der Geburt des ersten Enkels bewusst vorbereitet. „Ich habe einige Biografien gelesen und mit befreundeten Großeltern gesprochen. Die Erfahrungen der anderen haben mir geholfen, ein Bild meiner eigenen Rolle zu finden.“ Herausgefunden, welche Oma sie sein möchte, hat sie dann aber vor allem durch drei Dinge: beobachten, tun, reflektieren. Wer die Reaktionen des Kindes beachte, könne gar nicht so viel falsch machen.
Zum Weiterlesen
Anton A. Bucher: Lebensernte: Psychologie der Großelternschaft. Wiesbaden: Springer-Verlag, 2019
François Höpflinger u.a. : Enkelkinder und ihre Großeltern. Intergenerationelle Beziehungen im Wandel. Zürich: Seismo, 2006
Günter Heisterkamp: Vom Glück der Großeltern-Enkel-Beziehung. Wie die Generationen sich wechselseitig fördern. Gießen: Psychosozial-Verlag, 2015
Quellen
Robert M. Beland, Terry L. Mills: Positive portrayal of grandparents in current children's literature. Journal of Family Issues, 22/5, 2001, 639-651.
Valeria Bordone, Bruno Arpino: Do grandchildren influence how old you feel? Journal of aging and health, 28/6, 2016, 1055-1072.
Anton A. Bucher: Lebensernte: Psychologie der Großelternschaft. Wiesbaden: Springer-Verlag, 2019
Linda M. Drew, Merril Silverstein: Grandparents' psychological well-being after loss of contact with their grandchildren. Journal of Family Psychology, 21/3, 2007, 372.
Anne Gauthier: The role of grandparents. Current Sociology, 50/2, 2002, 295307.
Giorgio Di Gessa u.a.: The impact of caring for grandchildren on the health of grandparents in Europe: A lifecourse approach. Social Science & Medicine, 152, 2016, 166175.
Emily M. Grundy u.a.: Grandparenting and psychosocial health among older Chileans: A longitudinal analysis. Aging & mental health, 16/8, 2012, 10471057.
Günter Heisterkamp: Vom Glück der Großeltern-Enkel-Beziehung. Wie die Generationen sich wechselseitig fördern. Gießen: Psychosozial-Verlag, 2015
Sonja Hilbrand u.a.: Caregiving within and beyond the family is associated with lower mortality for the caregiver: A prospective study. Evolution and Human Behavior, 38/3, 2017, 397403.
François Höpflinger u.a.: Enkelkinder und ihre Großeltern. Intergenerationelle Beziehungen im Wandel. Zürich: Seismo, 2006
François Höpflinger: Großelternschaft im Wandel – neue Beziehungsmuster in der modernen Gesellschaft. Konrad-Adenauer-Stiftung: Analysen & Argumente 209, 2016, 114.
Mary E. Hughes u.a.: All in the family: The impact of caring for grandchildren on grandparents' health. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 62/2, 2007, 108119.
Linda M Janelli: Depictions of grandparents in children's literature. Educational Gerontology: An International Quarterly, 14/3, 1988, 193202.
Linda M. Janelli: Grandparent’s depictions in children’s literature: A revisit. Gerontology and Geriatrics Education, 14, 1994,43–-52.
Linda M. Janelli u.a.: Portrayal of grandparents in children’s storybooks. Gerontology and Geriatrics Education, 22, 2002, 69–88.
Gayle Kaufman, Glen H. Elder: Grandparenting and age identity. Journal of Aging Studies, 17/3, 2003, 269–282.
Toshinori Kitamura u.a.: Intergenerational transmission of parenting style and personality: Direct influence or mediation? Journal of Child and Family Studies, 18/5, 2009, 541556.
Edward Kruk, Barry L. Hall: The disengagement of paternal grandparents subsequent to divorce. Journal of Divorce & Remarriage, 23/1-2, 1995, 131148.
Kurt Lüscher: Großelternschaft. Facetten und Ambivalenzen. Frühe Kindheit, 5, 2017
Katharina Mahne, Daniela Klaus: Zwischen Enkelglück und (Groß-)Elternpflicht – die Bedeutung und Ausgestaltung von Beziehungen zwischen Großeltern und Enkelkindern. In: Mahne, K. et al. (Hrsg.). Altern im Wandel. Zwei Jahrzehnte Deutscher Alterssurvey (DEAS). Wiesbaden, 2017, 231–245.
Erhard Olbrich: Das Alter: Generationen auf dem Weg zu einer neuen Altenkultur‘?, In: Liebau, Eckart (Hrsg.) Das Generationenverhältnis. Über das Zusammenleben in Familie und Gesellschaft. Weinheim: Juventa 1997, 175194.
Donald C. Reitzes, Elizabeth J. Mutran: Grandparenthood. Factors influencing frequency of grandparent–grandchildren contact and grandparent role satisfaction. In: The Journals of Gerontology, 59/1, 2004, 9–16.
Ines Sackreuther u.a.: (Un-)Ruhestände in Deutschland. Übergänge, Potenziale und Lebenspläne älterer Menschen im Wandel. Transitions and Old Age Potential. Wiesbaden: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 2017
Carolina Sciplino u.a.: Representations of grandparents in children's books in Britain, Italy, Greece, Finland, and Poland. Journal of Intergenerational Relationships, 8/3, 2010, 298316.
Carolin Seilbeck, Alexandra Langmeyer: Ergebnisse der Studie „Generationenübergreifende Zeitverwendung: Großeltern, Eltern, Enkel. Deutsches Jugendinstitut, 2018
Margaret Sims, Maged Rofail: The experiences of grandparents who have limited or no contact with their grandchildren. Journal of Aging studies, 27/4, 2013, 377386.
Peter. K. Smith: The study of grandparenthood. In: Smith, P. K. The psychology of grandparenthood: An international perspective. Routledge, 2003, 1-16.
Statistisches Bundesamt (2016): Ältere Menschen in Deutschland und der EU, Wiesbaden.
Ruth Staples, June Warden Smith: Attitudes of Grandmothers and Mothers toward Child Rearing Practices. Child Development. 25/2, 1954, 9197.
Anja Steinbach, Karsten Hank: Familiale Generationenbeziehungen aus bevölkerungssoziologischer Perspektive, in: Niephaus Yasemin, Kreyenfeld Michaela, Sackmann Reinhold (Hrsg.) Handbuch Bevölkerungssoziologie, Wiesbaden: Springer, 2016, 367391.
Joseph H Stevens: Black grandmothers' and Black adolescent mothers' knowledge about parenting. Developmental Psychology, 20/6, 1984,10171025.
Ben-Ari Taubmann, Ben Shlomo: Measuring personal growth of new grandparents: A practical tool for social workers. Research on Social Work Practice, 26, 2016, 704–711.
Ben-Ari Taubmann u.a.: First-time parents’ and grandparents’ perceptions of personal growth: A dyadic approach. Journal of Family Social Work, 17, 2014, 229–250.