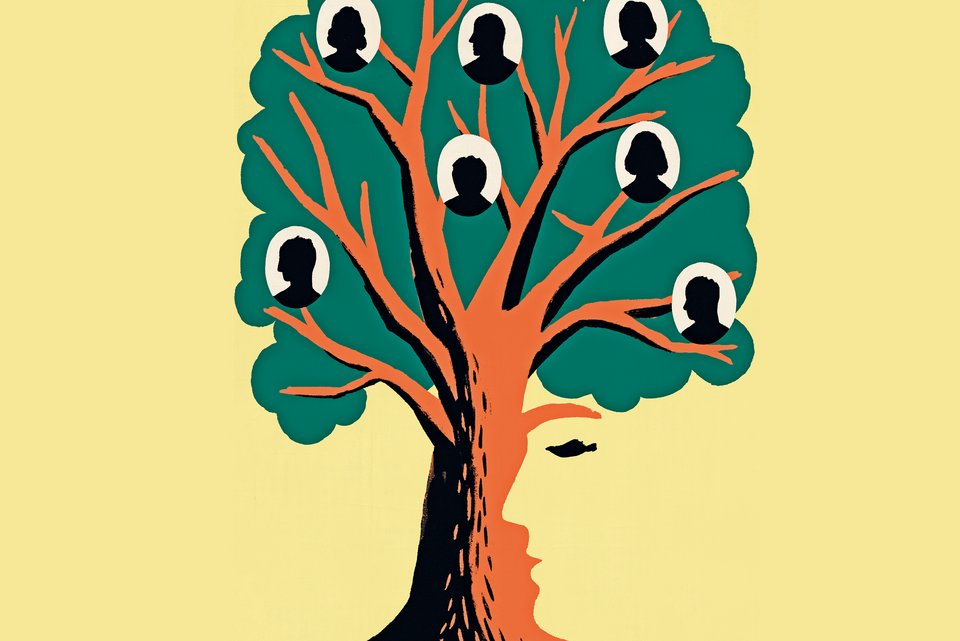Der Psychologe und Coach Roland Kopp-Wichmann beleuchtet im Interview typische Muster und Blockaden im Arbeitsleben, die mit unserer Herkunft zusammenhängen– und zeigt, wie man sie verändert.
Wie lässt sich erklären, dass sich alte familiäre Muster häufig im Beruf wiederholen?
Arbeitssituationen ähneln oft Beziehungserfahrungen aus der Herkunftsfamilie. Das machen sich viele nicht bewusst. Im Team muss man mit Menschen auskommen, die man sich nicht ausgesucht hat, und Regeln befolgen, die man vielleicht…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
muss man mit Menschen auskommen, die man sich nicht ausgesucht hat, und Regeln befolgen, die man vielleicht unsinnig findet. Dass etwa der Urlaub zu beantragen ist und man dann schlucken soll, dass er abgelehnt wird. Man muss akzeptieren, dass ein toller Vorschlag ignoriert wird.
Menschen, die frühe Erfahrungen mit autoritären Eltern haben, begehren dann auf und sagen: Das lasse ich mir nicht bieten. Ich gehe. Damit ist das Problem jedoch nicht gelöst. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich die Erfahrung wiederholt. Denn in jeder Organisation gibt es Regeln, die man nicht selbst mitbestimmt hat. Für viele ist es ein Aha-Erlebnis, zu verstehen, dass sie kindliche Ohnmachtserfahrungen auf Autoritätspersonen von heute projizieren, deshalb rebellieren und ständig anecken
Wie kommen Sie solchen blockierenden Mustern auf die Schliche?
Im Coaching lasse ich oft ein Bild zeichnen: von der Herkunftsfamilie wie auch der beruflichen Situation. Wenn ich auf dem Familienbild einen dominanten Vater oder eine überdimensionierte Mutter sehe, weiß ich, da hat jemand in den ersten 10 bis 12 Jahren gelernt: „Hier muss ich kuschen.“ Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Man schafft sich ein Umfeld, in dem man andere dominieren kann, oder man rebelliert und beschließt, sich von keinem mehr etwas sagen zu lassen. Diese unbewusste Entscheidung zu erkennen ist oft ein Wendepunkt.
Zu realisieren, dass man nun erwachsen ist, sich nicht mehr alles bieten lassen muss, aber auch entspannt damit umgehen kann, dass man nicht alles mitbestimmen darf. Ich muss nicht jede Ablehnung persönlich nehmen. Wenn ich das tue, bin ich gefangen in einem kindlichen Muster und erlebe Grenzen und Anordnungen als eine Machtausübung. Statt zu kündigen, hilft dann, die eigene Einstellung zu verändern.
Welche Rolle spielt das Gefühl, die Eltern nicht überflügeln zu dürfen?
Unbewusste Loyalitäten spielen eine entscheidende Rolle. Es gibt gefühlt eine unsichtbare Grenze, über die nie gesprochen wird, an die sich Menschen aber halten. Wenn etwa der Vater oder die Mutter früh gestorben ist mit 45, erleben die Klienten die Zahl 45 wie eine Schwelle. Dahinter steht die Frage: Darf es mir besser gehen? Darf ich älter werden als ein wichtiges Familienmitglied? Oft entwickeln sich unbewusste Schuldgefühle, die auf verschiedenen Ebenen wirken. Wenn ein Mädchen aus einer Handwerkerfamilie kommt und als Erste aufs Gymnasium geht und studiert, gerät sie in eine Sonderrolle in der Familie. Jetzt ist entscheidend, wie die Eltern darauf schauen. Sind sie stolz? Oder vermitteln sie: „Du willst wohl was Besseres sein. Du passt nicht mehr zu uns.“ Das kann dann später zur Selbstsabotage führen.
Wollen Sie mehr zum Thema erfahren? Dann lesen Sie auch folgende Artikel:
In der Familiengeschichte bündelt sich die wertvolle Erfahrung vieler Generationen. Lesen Sie, wie man durch einen Blick zurück stärkende Muster entdecken und schädliche überwinden kann in Die geheimen Muster meiner Familie.
Wo liegen die verborgenen Stärken in Ihrer Familiengeschichte? Die Fragen der Therapeutin Anke Lingnau-Carduck können helfen, Schätze zu heben in Die eigene Familiengeschichte verstehen.
Wie drückt sich eine solche Selbstsabotage aus?
Ich habe mehrere begabte Klienten, die ihre Doktorarbeit, an der sie lange geschrieben haben, nicht fertiggestellt haben. Dahinter steckt oft ein unbewusster Loyalitätskonflikt. Denn mit der Doktorwürde wird deutlich, dass jemand einen anderen Rang erreicht hat und andere womöglich überflügelt. Das könnte zu Neid führen. Hinter der Selbstsabotage kann auch stecken, dass jemand ein Studienfach nur gewählt hat, um die Erwartungen der Eltern nicht zu enttäuschen. Wer aus einer Arztfamilie kommt, braucht oft ein starkes Standing, um zu sagen: Ich möchte nicht Medizin studieren, meine Leidenschaft ist Jazzmusik.
Dann kommt es darauf an, ob die Eltern den inneren Freiraum haben, zu sagen: Hauptsache, du wirst glücklich mit deinem Beruf. Wählt jemand den Eltern zuliebe einen Beruf, der den eigenen Neigungen nicht entspricht, kann es gut sein, dass er oder sie die Prüfung vermasselt. Denn der Abschluss ist dann kein erstrebenswerter Erfolg, sondern eine Bürde. Das alles passiert natürlich unbewusst.
In welcher Weise beeinflussen Familienmuster das Verhältnis zu Leistung und Entspannung?
Bei Menschen, die im Burnout landen, zeigt sich manchmal eine unbewusste Überzeugung: „Weil meine Mutter ihr Leben lang kämpfen musste, darf ich es nicht leicht haben.“ Dann muss man starke Antreiber entwickeln, über seine Grenzen gehen, es allen recht machen, sich keinen Urlaub gönnen. „Mein Vater hat immer schwer geschuftet und keinen Erfolg gehabt. Wer bin ich, dass ich Karriere mache und leicht mein Geld verdiene?“ Das sind beides Originalzitate von Klientinnen und Klienten, die spüren: Wenn es ihnen besser geht, verletzen sie eine unsichtbare familiäre Grenze.
Wie kommt es, dass diese unsichtbare Grenze eine so starke Wirkung hat?
Zugehörigkeit zu den Eltern oder zur Familie ist ein starkes menschliches Überlebensprinzip. Da kann man nicht einfach sagen, dass man nicht dazugehört. Selbstsabotagemuster zeigen sich oft in Familien, die große Verluste erlitten haben, beispielsweise im Krieg fliehen mussten oder verfolgt wurden. In diesen Familien haben viele der Kinder das Gefühl: Mir darf es nicht zu gut gehen. Das kann wie eine Erfolgsbremse wirken. Der eigene Erfolg wird als Verrat an der Herkunft erlebt.
Gilt das auch für das Thema Geld?
Auch hier gibt es unsichtbare Grenzen. Wie viel Geld darf man verdienen? Darf das Geld leicht verdient sein? Ich hatte eine Klientin, die immer 30 Prozent unterhalb des Stundensatzes blieb, der ihr zustand. Sie schrieb auch oft gar keine Rechnung. Ein solches scheinbar unsinniges Verhalten lässt sich nur verstehen, wenn man den dahintersteckenden Konflikt aufdeckt. Jemand empfindet es als Verrat, die Eltern zu übertreffen und bleibt deshalb unterhalb einer bestimmten Geldgrenze.
Bewusstheit ist der Schlüssel, diese Grenze zu verschieben, mit ihr zu arbeiten. Natürlich gibt es auch ermu-tigende Muster aus der Familiengeschichte, die sich nutzen lassen. Wenn die Eltern durch große Schwierigkeiten gegangen sind und etwas Gutes daraus gemacht haben, kann man daraus schließen: Das ist vermutlich auch in meiner DNA drin, dass ich nicht gleich bei der nächsten Hürde aufgebe, sondern mich durchbeiße. Das gibt Kraft, Schwierigkeiten, die es im Beruf immer gibt, zu meistern.
Roland Kopp-Wichmann, Diplompsychologe, war vier Jahrzehnte niedergelassener tiefenpsychologischer Psychotherapeut. Heute bietet er Lebensthemencoaching an. Ziel ist dabei, ungeklärte Lebensthemen hinter wiederkehrenden beruflichen und privaten Problemen zu finden.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback! Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.