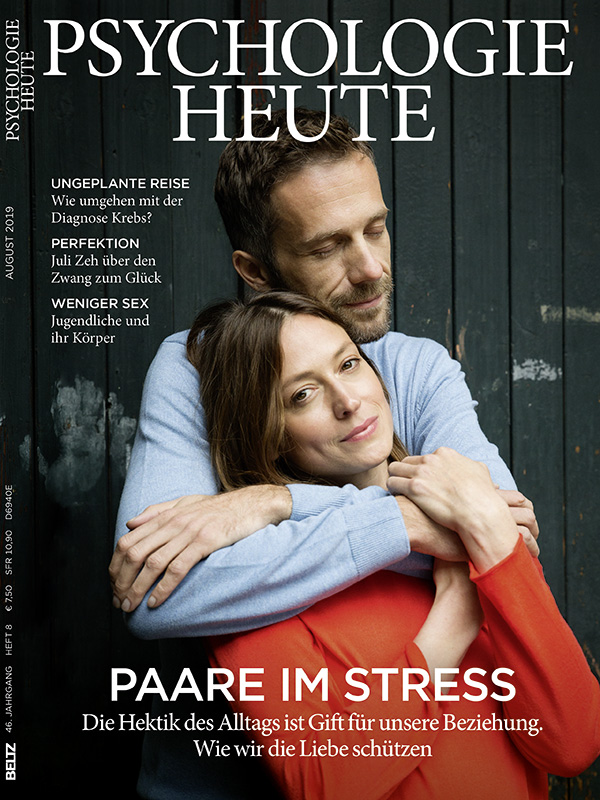Im deutschsprachigen Raum hat die Selbstoptimierung einen schlechten Ruf. Wird in der Medienöffentlichkeit über Selbstoptimierung diskutiert, so fallen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Begriffe wie „Zwang“, „Wahn“, „Diktat“, „Sucht“, „Falle“ oder „Hamsterrad“. Googeln Sie mal! Von sozialem Druck und unerfüllbaren Erwartungen ist die Rede, davon, dass wir uns einem unbarmherzigen Leistungsideal unterwerfen und dabei unser wahres Selbst verlieren. Was Letzteres denn eigentlich ist oder sein…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
unterwerfen und dabei unser wahres Selbst verlieren. Was Letzteres denn eigentlich ist oder sein sollte, spielt eine untergeordnete Rolle. Im Vordergrund steht die Verlust- und Deformationsdiagnose.
Meist wird Selbstoptimierung in einen Zusammenhang mit dem Kapitalismus, dem Neoliberalismus und dem Quantified Self gerückt. Der überzogene Anspruch an das eigene Leben erscheint dann als Äquivalent zu überzogenen Ansprüchen an Wohlstandssteigerung und Wirtschaftswachstum. Wie nimmersatte Kapitalisten die Ressourcen der Erde ausbeuten, beuten nun Individuen ihre physischen und vor allem psychischen Ressourcen aus.
Der Mensch wird zur Zahl
Und wie der Geist der Rationalität alles in Zahlen ausdrückt, wird der vermessene, sich vermessende Mensch angeblich selbst zur Zahl. Diese Kritik hat eine lange Tradition, gerade in Deutschland. So klagte der modernekritische, antisemitische Philosoph Martin Heidegger, die neuzeitliche Quantifizierung ordne das Sein der Herrschaft der Zahl unter. Im Trend zum Kalorien- und Schrittezählen hätte er wohl einen Ausdruck des „uferlose[n] Treiben[s] verstandesmäßiger Zergliederung“ gesehen, das er dem Judentum zuschrieb.
Vor allem Menschen, die ihre Schäfchen bereits ins Trockene gebracht haben, können sich den Luxus erlauben, Selbstoptimierung abzulehnen. In einer komfortablen Situation, gleichsam am Ende der Geschichte, schimpft es sich leicht auf die Optimierung der anderen. Jenen indes, die keine Privilegien genießen, die vielleicht unter prekären Bedingungen darben und denen der Zugang zu Ressourcen verwehrt ist, mag Selbstoptimierung als eine Verheißung erscheinen. Auch fällt denen, die in stabilen Verhältnissen leben, ein Dasein ohne numerische Leitplanken leichter.
Wer aber Unsicherheit erlebt und seine Gewissheit weder im Esoterischen noch im Spekulativen sucht, dem können die nüchternen Zahlen zumindest eine Basisorientierung geben. Nicht zuletzt vernimmt man die geläufige Kritik der Selbstoptimierung, vor allem die Kritik an Körper-Upgrades, sogenannten Enhancements, oft aus dem Munde von Gesunden. Für Beeinträchtigte hingegen bieten Enhancements, ob Prothesen oder Implantate, mitunter die einzige Chance, überhaupt am Alltagsleben der Gesunden teilzunehmen. Was den einen ein Angsttraum vom posthumanen Cyborg ist, ist für andere ein Weg zu mehr Teilhabe an menschlicher, allzumenschlicher Normalität.
Ein lustvoller Prozess
Die reflexhaften Einlassungen zur Selbstoptimierung verlangen nach einer differenzierten Gegenposition. Andernfalls erstarrt der Diskurs über Selbstoptimierung wie das Kaninchen vor der Schlange. Wir gehen der Macht des Marktes ex negativo auf den Leim, wenn wir selbst nur noch von Smartwatches, Leistungsdruck und Ökonomisierung sprechen, anstatt alternative Szenarien zu entwickeln. In diesem Essay vertrete ich deshalb die These, dass Selbstoptimierung ein menschliches Grundbedürfnis ist und ein lustvoller Prozess sein kann.
Was gibt es Schöneres, könnte man ketzerisch fragen, als das Bestmögliche aus sich zu machen? Nach dem Schlechten und Mittelmäßigen muss man nicht streben, das stellt sich schon von allein ein. Alexander von Humboldt schrieb 1799 richtig: „Der Mensch muss das Gute und Grosse wollen! Das Uebrige hängt vom Schicksal ab.“ Während der Wunsch, sich selbst und die Umwelt zu optimieren, ein Ausdruck von Optimismus ist, lässt sich das Misstrauen gegenüber Selbstoptimierung als Teilaspekt jener depressiven, angsterfüllten Grundstimmung deuten, die Teile des sich im Abstieg wähnenden Westens ergriffen hat.
Die Idee der Selbstoptimierung über den Haufen zu werfen, nur weil sie von selbstgerechten Neoliberalen und sonstigen Marktschreiern instrumentalisiert wird, ist ein klassischer Fall des Kind-mit-dem-Bade-Ausschüttens. Mit derselben Begründung könnte man die Idee des freien Marktes ablehnen, nur weil sie pervertiert worden ist – dabei lagen ihr einst emanzipatorische, ja sogar linke Bestrebungen zugrunde: die Überwindung von Leibeigenschaft, Monopolen, ungerechten Zöllen. Auch die sozialrevolutionären Ideen des Christentums, etwa das Durchbrechen der Gewaltspirale, könnte man mit Hinweis auf die von Jesus so nicht geplante Institution des Papsttums oder die Kreuzzüge für obsolet erklären. Es ist deshalb an der Zeit, den Begriff der Selbstoptimierung einer Revision zu unterziehen, anstatt sich mit Kulturpessimismus, heideggerscher Modernekritik und Lobreden auf irgendeine diffuse Essenz der wahrhaftigen Identität zu begnügen.
Problem gelöst – neues Problem
Menschen können zunächst einmal gar nicht anders, als mehr aus sich machen zu wollen. Wir sind Möglichkeitswesen, die im Offenen existieren. Unsere Identität ist die Arbeit an ebendieser. Dazu schrieb der Philosoph Hans Jonas 1970: „Von dem Umstand, dass die Natur des Menschen weit mehr ,Möglichkeit‘ ist als gegebenes Faktum, hängt unser ,einfühlendes‘ Verstehen auch solcher Erfahrungen anderer Seelen ab, tatsächlicher oder fiktiver, die wir vielleicht niemals in uns selbst zu replizieren vermögen.“ Es gibt folglich keinen finalen Idealzustand, den wir konservieren könnten. Was wir auch tun, es tun sich dadurch neue Herausforderungen auf. Jedes gelöste Problem schafft neue Probleme. Nie wurde diese Binsenweisheit sinnfälliger als in der Baumarktwerbung: „Es gibt immer was zu tun.“
Diese Einsicht kann zwar zu Stress führen. Doch dieser stellt sich keinesfalls zwangsläufig ein. Ebenso gut könnte das Wissen darum, dass es keinen alleinseligmachenden Endzustand gibt, beruhigend auf uns wirken, nimmt es doch Perfektionsdruck von uns. Es ist bezeichnend für die Verwirrung im heutigen Denken und für die intellektuelle Schludrigkeit auch in sogenannten Qualitätsmedien, dass Optimierung und Perfektionierung unablässig gleichgesetzt werden. So heißt es in der Pressemitteilung einer Klinik: „Selbstoptimierung bezeichnet den Trend, jeden Bereich des Lebens zu perfektionieren.“ Ein Radiosender spricht über den Typus des Selbstoptimierers als „Homo perfectus“.
In einem Boulevardblatt wird „Selbstoptimierung zum Lebensinhalt“ und im selben Zuge das „Bestreben nach Perfektion zum Diktat“, während eine Qualitätszeitung die Selbstoptimierung als „Wunsch, perfekt zu sein“ problematisiert. Derlei undurchdachte Verlautbarungen tragen dazu bei, dass es uns so schwerfällt, einen Zugang zur Optimierung zu finden, der nicht zu Frustration und Scham ob der eigenen Defizite führt. Was also unterscheidet Optimierung von Perfektionierung?
Auf was will ich verzichten?
Perfektion ist, was nicht mehr übertroffen werden kann. Perfektion ist abstrakt, sie hat keinen Platz in der materiellen Welt. Ein Optimum hingegen ist das bestmögliche Resultat eines Verbesserungsprozesses in einer konkreten Situation, unter konkreten Umständen. Im Gegensatz zur esoterisch gefärbten Perfektionierung impliziert Optimierung das Jonglieren mit diversen Voraussetzungen, Parametern und Variablen in spezifischen lebensweltlichen Zusammenhängen. Alle Elemente der Optimierung sind miteinander verbunden.
Verbessere ich einen Parameter, verschlechtert sich womöglich ein anderer. Erziele ich an der einen Stelle einen Gewinn, verzeichne ich an anderer Stelle unter Umständen einen Verlust. Also sind Kompromisse gefragt: Will ich für acht Prozent Körperfett die Spontaneität in sozialen Beziehungen opfern? Will ich für ein längeres Leben auf Intensität verzichten? Auf eine Formel gebracht, ließe sich sagen: Selbstoptimierung ist das beste Mittel gegen die Illusion der Selbstperfektionierung. Der Perfektionierung entspricht der Idealismus, der Optimierung der Pragmatismus.
Gerade die mathematische Nüchternheit des Begriffs „Selbstoptimierung“ schützt vor dem Entgleiten ins Esoterische, das verwandten Begriffen wie „Selbstverwirklichung“ oft anhaftet. Einige Beispiele aus Popkultur und Philosophie mögen veranschaulichen, wie eine so verstandene Selbstoptimierung aussehen kann.
Verbesserung der Gemeinschaft
In der Kultur des Hip-Hops spielen verschiedene Formen und Vorformen der Selbstoptimierung eine wichtige Rolle. So gab der Hip-Hop-Pionier Afrika Bambaataa in den 1970er Jahren Losungen wie self-improvement und positivity aus, um Gangkids von den Straßen New York Citys zu holen. Bis heute sind diese und verwandte Tugenden wie self-reliance, self-help oder self-pride essenziell für die globale Hip-Hop-Szene. Die Kultur des Hip-Hops zeichnet sich aus durch die Bejahung von personal growth, entstand sie doch in Armenvierteln, wo die Möglichkeit zur Arbeit am Selbst ein Privileg war. Es ist wenig überraschend, dass Selbstoptimierung im Ghetto einen anderen Beiklang hatte als in saturierten Bürgerhaushalten. Nicht übersehen werden sollte, dass self-improvement gerade im frühen Hip-Hop stets auf die Verbesserung der Gemeinschaft (community) abzielt.
Wer sich selbst optimiert, wird auch optimierend auf seine Umwelt wirken. Denn jede Veränderung der Umwelt beginnt mit der Veränderung des Selbsts. Sogar in vulgären Schwundstufen wie dem Werk des deutschen Rappers Kollegah ist dieser Impuls spürbar – mit dem Buch Das ist alpha! Die 10 Boss-Gebote hat er einen Selbstoptimierungsratgeber verfasst, der sämtliche Befürchtungen der oben erwähnten Kulturkritiker bestätigt. Doch Kollegahs Banalitäten ändern nichts am hohen Wert der Selbsttransformation.
Den zutiefst liberalen Primat der Selbsttransformation findet man auch im Spätwerk des Philosophen Michel Foucault. In seinen Texten zur Lebenskunst fragte er sich in den 1970er und 80er Jahren, warum zwar bestimmte Dinge, aber nicht das Leben eines jeden Einzelnen als Kunstwerk gelte. Aus Foucaults Sicht sollte man für sich selbst sorgen und an sich selbst arbeiten, bevor man sich an die Gestaltung der Umwelt macht. Dass man dabei nach einem Optimum und nicht nach einem Mediokrum, nach Intensität und nicht nach Komfort streben soll, versteht sich. Dabei war es Foucault nicht um jene stabile Identität zu tun, nach der sich heute so viele sehnen. Er strebte eine dynamische „Ästhetik der Existenz“ an, die sich unablässig selbst hinterfragt. Weil das Selbst Foucault zufolge aber nur in der Beziehung zum Sozialen existieren kann, ist der Selbstoptimierung die Optimierung des Sozialen eingepreist.
In der Mitte
Bereits in der Renaissance entstand eine andere Sicht auf die Selbstoptimierung, als sie heute bei uns üblich ist. Als der humanistische Philosoph Pico della Mirandola im Jahre 1486 seine Rede über die Würde des Menschen verfasste, legte er darin Gott selbstbewusst die folgenden Sätze in den Mund: „Weder als einen Himmlischen noch als einen Irdischen habe ich dich [den Menschen] geschaffen und weder sterblich noch unsterblich dich gemacht, damit du wie ein Former und Bildner deiner selbst nach eigenem Belieben und aus eigener Macht zu der Gestalt dich ausbilden kannst, die du bevorzugst.“
Dabei verfocht Pico weder einen naiven Optimismus – immerhin könne man auch zum Tier herabsinken –, noch definierte er den Menschen einfach als „Krone der Schöpfung“. Als „Geschöpf von unbestimmter Gestalt“, ja als „Chamäleon“ stehe der Mensch nicht an der Spitze, sondern in der offenen Mitte der Welt: „Weder haben wir dich himmlisch noch irdisch, weder sterblich noch unsterblich geschaffen, damit du wie dein eigener, in Ehre frei entscheidender, schöpferischer Bildhauer dich selbst zu der Gestalt ausformst, die du bevorzugst.“
Aus Dankbarkeit für die Fülle von Möglichkeiten, die Menschen im Gegensatz zu Tieren haben, rief Pico dazu auf, das Beste aus sich zu machen: „Ein heiliger Ehrgeiz dringe in unsere Seele, dass wir, nicht zufrieden mit dem Mittelmäßigen, nach dem Höchsten verlangen und uns mit ganzer Kraft bemühen, es zu erreichen – denn wir können es, wenn wir wollen.“
Das könnte einerseits fast aus Kollegahs krudem Ratgeberbuch stammen: das Höchste, Kraft, Ehrgeiz, American Dream! Doch Pico ging es nicht um die narzisstische Selbstperfektionierung oder um die Anhäufung von Kapital und schon gar nicht um die ideale Strandfigur. Es ging ihm um eine Verneigung vor der Offenheit der Existenz. Sich dieser zu verschließen hieße, die Existenz als solche zu schmähen. So sind Demut und Selbstoptimierung einander kongenial. Menschen optimieren, weil sie nicht perfekt sind.
Verzerrungen
Was aber ist dieses „Höchste“, von dem bei Pico die Rede ist? Genau hier beginnt das Missverständnis der Moderne: Die Optimierung nähert sich der Perfektionierung, der Illusion des „Erreichens“, an. Wir hätten eigentlich über 500 Jahre Zeit gehabt, das Missverständnis aufzuklären. Anstatt also Selbstoptimierung mit Selbstperfektionierung zu verwechseln und sie als solche zu verdammen, sollten wir lieber gegen jene politisch-ökonomischen und massenmedialen Systemzwänge aufbegehren, die nurmehr verzerrte Formen von Selbstoptimierung hervorbringen.
Wir leben in einer Zeit, die alle nichttrivialen, alle subtilen und eigensinnigen Versuche der Selbstoptimierung nur zu gerne aufgreift und in Zerrbilder ihrer selbst verwandelt – das ist es, was Theodor W. Adorno mit dem Satz „es gibt kein richtiges Leben im falschen“ meinte. Auf der einen Seite stehen die besorgten, bequemen, posthistorischen Kulturpessimisten, die jede Form von Selbstoptimierung als eine Verschwörung des Kapitals abtun und missgünstig auf jene schauen, die nicht nach dem Mittelmaß, sondern nach dem Optimum streben.Auf der anderen Seite steht, wenig überraschend, die Sekte der Trendscouts, Marktfetischisten und Effizienzsteigerer. Für sie ist Selbstoptimierung identisch mit neoliberaler Vereinzelung, neuen Produktsortimenten und Kosteneinsparungen für Krankenkassen, die sich zu „Gesundheitskassen“ hyperoptimieren.
In Distanz zu diesen Extremen gilt es, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, denen daran gelegen ist, Räume für kritische, aufgeklärte Formen der Selbstoptimierung zu schaffen. Denn das ist ja die Ironie der Selbstoptimierung: Nur in organisierter Form, ob in den frühen Hip-Hop-Communitys oder in Kreisen einander fördernder Philosophen, kann sie Früchte tragen. Die Arbeit beginnt am Selbst, doch das Selbst existiert nie isoliert. Eigensinn bedarf guter Gemeinschaft. Deshalb muss heute konkrete politische Arbeit an die Stelle des wohlfeilen Gejammers über Selbstoptimierung treten – es gilt, an Rahmenbedingungen zu arbeiten, die echte Selbstoptimierung ermöglichen. Nicht Selbstoptimierung, sondern die Ursachen ihrer Verzerrung müssen bekämpft werden. Alles andere wäre, nun ja: suboptimal.