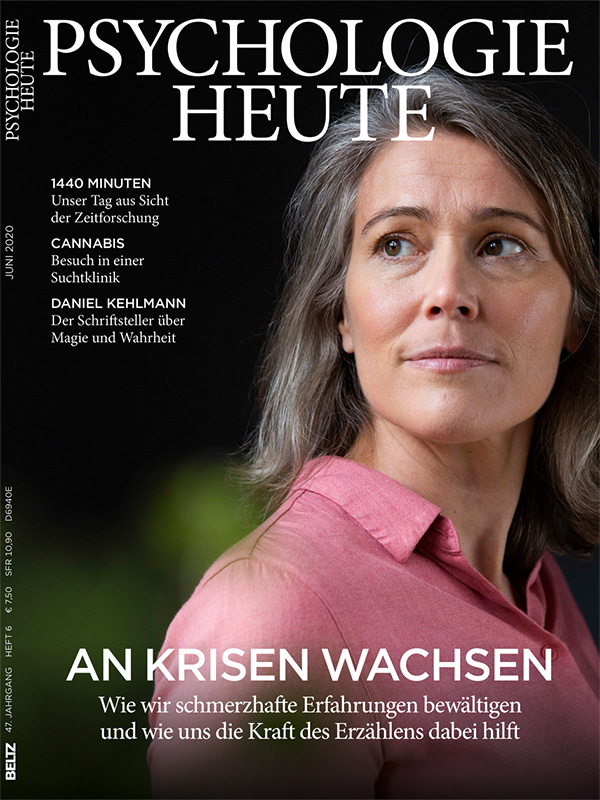Herr Kehlmann, wie entsteht bei Ihnen ein Roman? Denken Sie sich: Ich schreibe jetzt mal etwas über magisches Denken, wo könnte ich das ansiedeln? Oder ist da zuerst eine Figur wie Tyll Ulenspiegel, und dann versetzen Sie diese Figur in ein Szenario und sie fängt an zu agieren?
Eher Ersteres. Es ist allerdings keine kalte, rationale Entscheidung nach dem Motto: „Darüber müsste ich jetzt auch mal was schreiben.“ Es ist eher so, dass ich merke, dass ich von einem bestimmten Themenfeld, einem dunkel leuchtenden…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
schreiben.“ Es ist eher so, dass ich merke, dass ich von einem bestimmten Themenfeld, einem dunkel leuchtenden Bereich plötzlich fasziniert und angezogen bin. Allerdings interessieren und beschäftigen mich auch viele andere Themen, bei denen ich aber nie das Gefühl habe, dass ich nun darüber schreiben müsste. Es ist also eine ganz spezielle Art der Anziehung, die am Anfang eines Romans steht, eben der Wunsch, dass ich damit etwas machen will. Zuerst ist da meist noch gar keine Idee einer Geschichte, sondern die Vorstellung von einer Welt.
Bei meinem RomanTyll war das die Ideenwelt von Voraufklärung, Aberglaube und dem Schrecken und Chaos des Dreißigjährigen Kriegs. Dieser Vorgang des Ausbrütens ist auch mir selbst nicht wirklich transparent und läuft eher unbewusst ab: Man trägt so eine Welt lange mit sich herum. Und indem man immer wieder über diese Welt nachdenkt – das Nachdenken ist schon notwendig, von allein geht es nicht –, formen sich allmählich die Charaktere und Handlungsstränge des Romans.
Wenn diese Figuren dann anfangen zu agieren und einem Erzählfaden folgen, dann entsteht für Leser ein Sog. Forscher sprechen vom narrative impact – man versinkt in der Erzählwelt und vergisst ein Stück weit die reale Umgebung um einen herum. Wie ist das beim Autor? Versinken Sie auch beim Schreiben, oder müssen Sie eher ein kühler Strippenzieher bleiben?
Ich bin schon versunken, aber nicht auf so eine rauschhafte Art, bei der einen eine göttliche Inspiration oder ein genialischer Funke überkommt, wie man das in Filmen immer sieht: Der Autor sitzt da und schreibt wie ein Besessener, während vorm Fenster Tag und Nacht in fliegendem Wechsel vorbeiziehen. Mag sein, dass man ein Gedicht oder auch ein Theaterstück in einem ähnlichen Rauschzustand der völligen Gefangenheit hervorbringen kann. Aber bei einem so langen Stück Prosa wie einem Roman würde das nicht funktionieren, bei mir jedenfalls nicht. Bei all den Entscheidungen, die man da beim Verfassen ständig treffen muss, ist schon viel vernünftiges Abwägen dabei.
Gleichwohl bin ich beim Romanschreiben in einer anderen psychischen Verfassung als im Alltag. Zwar kommt es einem so vor, als sei man exakt derselbe wie sonst: Ich sitze am Schreibtisch, mache mir Kaffee, denke nach, bringe Sätze zu Papier, manchmal gute, manchmal schlechte. Aber das Merkwürdige ist: Später, wenn ich durch das fertige Buch blättere und mich frage, wie und wo ich diese und jene Stelle geschrieben habe, muss ich oft passen. Es hat wohl schon etwas von einem Trancezustand, einem Flow, in dem man so fokussiert ist, dass man die physischen Gegebenheiten um einen herum kaum wahrnimmt. Ich kann mich dann nachher an wenig erinnern, habe aber das Gefühl, dass es glückliche Tage waren.
Ihr RomanTyll ist 2017 erschienen. Spuken die Figuren – Tyll, seine Gefährtin Nele, Liz, der Winterkönig, der dicke Graf – noch immer in Ihrem Kopf herum?
Eigentlich nicht. Sie haben den Bogen ihrer Existenz mit dem Buch beendet. Die einzige Ausnahme überhaupt in meinen bald 25 Jahren als Schriftsteller ist Tyll. Der fühlt sich anders an als all meine anderen Figuren. Bei Tyll war es immer so: Wenn er den Mund aufmachte und sprach, musste ich nie nachdenken, was er sagt. Es war immer sofort fertig da. Vielleicht weil er eine mythische Figur ist.
Im Buch stirbt er ja nicht, sondern wird in gewisser Weise unsterblich. Das ist womöglich der Grund, warum ich immer das Gefühl hatte, dass er da draußen noch irgendwie präsent ist. In meiner Rede zum Schirrmacher-Preis habe ich im Nachhinein noch einmal ein Zwiegespräch mit Tyll Ulenspiegel imaginiert, an dessen Ende er mich dann für immer verlässt.
Tatsächlich ist Tyll vor allem gen Ende Ihres Romans eine ziemlich unheimliche Gestalt: Er taucht aus dem Nichts auf und verschwindet auf unerklärliche Weise. Er behauptet, er sei aus Luft und er werde nicht sterben – ganz wie der Luftgeist Ariel in Shakespeares Stück Der Sturm. Ist Tyll überhaupt ein Mensch aus Fleisch und Blut?
Till Eulenspiegel ist eine Fabelgestalt, der ich im Buch das gebe, was in Hollywood eine origin story genannt wird: Er erhält einen Hintergrund, eine Vergangenheit, man sieht, wo er herkommt. Aber er wird im Verlauf der Geschichte immer mehr zu dieser mythischen Figur und damit auch immer weniger zu einem psychologisch nachvollziehbaren Charakter.
Er bekommt immer mehr etwas absolut Rätselhaftes und eben auch Magisches. Interessanterweise habe ich das wiedergefunden in dem Film Joker, der etwas Ähnliches mit dieser Mythengestalt aus dem 20. Jahrhundert anstellt. Ich bin sehr froh, dass der Film mit komfortablem Abstand nach meinem Roman herauskam, sonst hätte man mir womöglich nachsagen können, das habe ich doch alles aus Joker geklaut.
Natürlich war es umgekehrt: Die haben bei Ihnen geklaut!
Haha, sicher nicht. Aber es gibt eine innere Verwandtschaft in der Art, wie hier eine böse, gefährliche, mythische Schelmenfigur in Szene gesetzt wird. Mich hat das fasziniert.
Bevor Tyll in Ihrem Roman zu einer Fabelgestalt und damit unantastbar wird, geben Sie ihm ein Innenleben und eine menschliche Biografie: Er wird als Junge mehrfach traumatisiert und schließlich von marodierenden Soldaten misshandelt und allem Anschein nach entmannt…
Letzteres ist eine mögliche Lesart. Ich hatte das zuvor nicht so geplant, sondern es hat sich beim Schreiben ergeben. Tyll ist in dieser Szene bei der Belagerung von Brünn von den Verteidigern der Stadt zwangsrekrutiert worden. Mit anderen Söldnern gräbt er Stollen, um die Angreifer abzufangen, die sich unter der Stadtmauer hindurchgraben wollen. Plötzlich stürzt der Tunnel ein, und Tyll ist mit zwei Schicksalsgenossen dort unten eingesperrt. Und nun, in der Dunkelheit und Enge, öffnen sich für alle drei die Schleusen der Erinnerung.
Die schlimmsten Dinge, die sie getan und gesehen haben, werden vor ihrem inneren Auge wieder lebendig. In diesem Augenblick erschien es mir zwingend, dass sich Tyll an das Trauma damals im Wald erinnert, als er – womöglich – entmannt wurde. Im Roman ist Tyll ja über viele Jahre mit Nele befreundet. Sie stehen einander sehr nahe, aber ich hatte von Anfang an das Gefühl: Die beiden können kein Liebespaar sein. Denn Tyll Ulenspiegel – der seltsame, archaische, archetypische Narr, der er nun mal ist – würde nie eine wie auch immer geartete Liebesbeziehung eingehen. Das wäre falsch. Er ist auf seine Art unberührbar.
Im RomanTyll geht es viel um Aberglaube, um volkstümliche Vorstellungen von sprechenden Steinen, bösen Geistern, magischen Formeln. Sie haben mal verraten, dass Sie viele Bücher über die Geschichte der Magie und Alchemie in Ihrem Regal haben. Was fasziniert Sie an diesem Stoff?
Wenn man es genau nimmt, möchte ich Ihnen schon beim Ausdruck „Aberglaube“ widersprechen. Abergläubisch sind ja Menschen, die Vernunft ablehnen. Das war aber nicht so. Denn aus der damaligen voraufklärerischen Weltsicht heraus gab es ja gar keinen Grund, warum nicht auch intelligente Menschen etwa an die Wirksamkeit von Bannflüchen oder an die Existenz von Drachen hätten glauben sollen.
In dem schönen Buch A Secular Age erläutert der Philosoph Charles Taylor, dass man in der frühen Neuzeit gar nicht die Möglichkeit hatte, ein Atheist zu sein. Das war einfach keine intellektuelle Option. Mich hat fasziniert, wie fremd diese Welt uns heutigen Menschen erscheinen muss. Wir sind alle Kinder der Aufklärung, und das ist auch gut so. Aber als Schriftsteller fand ich reizvoll, mich psychologisch in eine Welt zu versetzen, in der es diese Dichotomie zwischen Aberglaube und Vernunft noch nicht gegeben hat und in der das, was später die wissenschaftliche Methode wird, sich in ganz enger Verbundenheit mit abergläubischen Vorstellungen zu entwickeln beginnt.
Und da sind wir bei der Alchemie. Niemand würde leugnen, dass sie die Großmutter der modernen Naturwissenschaften ist. Hier beginnt sich die Wissenschaft samt systematischer Beobachtung und Experiment zu entwickeln. Doch gleichzeitig ist diese Alchemie durchsetzt von Vorstellungen, die uns heute abergläubisch und völlig absurd erscheinen.
Die Wissenschaft stand nicht quer zu diesem Zeitgeist?
Auch unseren heutigen Helden der frühen Wissenschaft war diese Vorstellungswelt selbstverständlich. Vor vielen Jahren habe ich bei Elisabeth von Samsonow in Wien ein Seminar über Giordano Bruno besucht, der ja einer der Vorväter und frühen Märtyrer der modernen Wissenschaft war. Er schreibt wunderbar über seine experimentellen Beobachtungen zum Phänomen der Resonanz: Er hat zwei Trommeln bespannt, die größere mit einem Wolfsfell, die kleinere mit einem Kalbsfell. Bruno beobachtet nun, dass die Kalbstrommel mitschwingt, wenn er die Wolfstrommel schlägt. Ein tadelloses Experiment. Nur seine Erklärung klingt für uns verwunderlich: Die Resonanz der Schwingungen resultiert aus der Furcht des Kalbs vor dem Wolf. Aus Sicht dieser Zeit war diese Erklärung völlig vernünftig.
Sie treiben Schabernack mit Ihren Lesern, indem Sie die magischen Mittel und Zaubersprüche immer wieder als wirksam darstellen oder jedenfalls halbwegs wirksam. Warum tun Sie das?
Mich hat als Autor gereizt, in diese Vorstellungswelt einzutauchen und sie von innen heraus zu beschreiben. Ich habe zwar einen allwissenden Erzähler, der das Geschehen von außen schildert. Doch dieser Erzähler ist in seinem Weltbild nie klüger oder moderner als die Figuren. Er deutet nie an, dass diese Leute naiv sind und er es besser wüsste. Auch das hatte ich ursprünglich nicht geplant, aber beim Schreiben hat sich diese Weltsicht dann immer mehr durchgesetzt, und es hat mir natürlich auch Spaß gemacht, sie als selbstverständlich hinzustellen. Schließlich ist Tyll ein Eulenspiegelroman, und als solcher muss er die Leser manchmal vor den Kopf stoßen, wie ein Narr das eben auch mit seinem Publikum tut.
Eine interessante Figur ist Claus Ulenspiegel, Tylls Vater. Von Beruf ist er Müller, aber hauptsächlich treibt er allerlei verrücktes oder auch gelehrtes Zeug. Er spricht Beschwörungsformeln, schreibt Pentagramme, aber er zeichnet auch nach Art eines Forschers mittels eines Fadenkreuzes am Scheunenfenster auf, wo am Horizont der Mond jeweils untergeht. Was ist dieser Claus für ein Typ?
Er ist ein Autodidakt, ein wissensbegieriger Mensch, der gerne verstehen würde, aber in seiner sozial so rigiden Welt einfach keinerlei Zugang zu dem Wissen seiner Zeit hat. Niemand würde ihn zu irgendeiner Ausbildungsstätte zulassen, und deshalb fängt er selbst an zu experimentieren und setzt sich so sein eigenes Weltbild zusammen. So etwas war gar nicht so selten. Der Historiker Carlo Ginzburg wertet in seinem Buch Der Käse und die Würmer einen Inquisitionsprozess aus, der einem Müller gemacht wurde.
Die Müller waren damals nie ganz Teil der Dorfgemeinschaft, weil die Mühle immer etwas außerhalb lag. Manche haben sich daher tatsächlich geistig freier entwickelt und oft die Rolle von Magiern und Heilern eingenommen. Claus ist im Roman eine tragische Figur, denn mit seiner Begabung und seinem Wissensdrang hätte er es unter anderen Umständen weit bringen können.
Sie stellen Claus Ulenspiegel eine andere Figur gegenüber, die sein Schicksal besiegeln wird: den Kirchengelehrten und Hobby-Ketzerjäger Athanasius Kircher, eine Gestalt nach einer historischen Vorlage. Auch Kircher versteht sich als Gelehrter und Forscher. Was unterscheidet ihn von Claus Ulenspiegel?
Die Macht und die Autorität. Ansonsten sind sie sich nicht unähnlich: beide intelligent, wissbegierig, forschend. Athanasius Kircher wurde tatsächlich ein großer Experimentator – wenn auch einer, der viele seiner Experimente gar nicht ausgeführt, sondern erfunden hat. Denn er meinte: Wenn er von seiner Vernunft her versteht, wie ein Experiment ausgehen muss, dann braucht er es erst gar nicht durchzuführen. Er hat allerdings in Wirklichkeit an keinen Hexenprozessen mitgewirkt, das muss ich der Gerechtigkeit halber klarstellen.
Der Roman Tyll spielt im Dreißigjährigen Krieg. Mit dessen Ende beginnt allmählich eine neue Zeit: die Aufklärung und der Siegeszug der Wissenschaft. Ihr berühmter Roman Die Vermessung der Welt handelt von zwei bis heute grundverschiedenen Forschertypen. Hier der Empiriker Humboldt, der in die Welt hinauszieht und systematisch beschreibt, was er dort vorfindet. Dort der Mathematiker Gauß, der in seinem Kämmerlein die Welt berechnet, ohne sie mit seinen Sinnesorganen zu erkunden – so wie heute die theoretischen Physiker mit ihren Stringmodellen vom Universum. Welcher der beiden ist Ihnen sympathischer?
Was die Sympathie angeht, habe ich da keine Präferenz. Aber der historisch Siegreiche ist natürlich Gauß. Er steht für die aufstrebende quantifizierende Wissenschaft, die die Welt in Zahlen übersetzt. Humboldt hingegen interessierte sich nicht für Zahlen. Im Roman ist Gauß die intelligentere, begabtere Figur.
Sie erfinden hier eine Geschichte um reale historische Personen. Wie weit darf sich ein Erzähler dabei von den geschichtlichen Fakten entfernen?
Ich glaube, Dichtung ist hier tatsächlich sehr frei, sofern das, was sie da imaginiert, einen kompositorischen oder poetischen Sinn ergibt. Wenn meine Romanfiguren von Humboldt und Gauß sich allzu weit von den historischen Originalen entfernt hätten und ich beispielsweise Gauß zum Militär geschickt hätte und ihn als General Napoleon hätte besiegen lassen, dann hätte ich mich fragen lassen müssen: Warum nennst du ihn noch Gauß? Daraus hätte nichts anderes als ein schlechter Roman werden können. Ich bin davon überzeugt, dass es tatsächlich einen Bezug des Literarischen zum Schönen, Wahren, Guten gibt.
Wenn Wissenschaft Erkenntnissuche ist, ist Literatur dann eine Erkenntnissuche mit anderen Mitteln?
Ich denke doch. Es ist eine Erkenntnissuche durch Sprache und Empathie. Ich habe gerade zum dritten Mal Madame Bovary gelesen. Die Geschichte, die Flaubert da erzählt, ist bewusst banal. Doch die ganze Welt, die er beschreibt, jedes Detail, jede Bewegung, ist vollgesogen mit seiner sprachlichen Intelligenz. Daran teilzuhaben ist schon eine Art von Erkenntnis: Man sieht und versteht jedes Detail neu, als hätte man es zum ersten Mal wahrgenommen. In dieser hohen Kunst der Beschreibung und Darstellung liegt eine Entbanalisierung mittels Sprache. Hinzu kommt die Empathie: Erzählende Literatur heißt, die Welt mit anderen Augen zu sehen und am Gefühlsleben und den Konflikten anderer Menschen innerlich teilzuhaben. Das ist die höchste Schule des Mitempfindens, selbst der Film kann das nicht, denn er blickt letztlich von außen auf seine Figuren.
Olga Tokarczuk sagte in ihrer Nobelpreisrede in Stockholm: „Ereignisse sind Tatsachen. Erfahrung aber ist etwas unaussprechlich anderes.“ Erlebtes und Erfahrenes – ist das die Art von Wahrheit, die Literatur erkundet?
Ja, denn gerade diese subjektiven Erfahrungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Realität. Wenn man eine vollständige Beschreibung der Welt liefern würde, wären ja nicht nur die physischen Objekte Bestandteil dieser Realität, sondern zum Beispiel auch alle Träume, die jeder Mensch je gehabt hat. Und dieser innere Aspekt der Wirklichkeit ist eigentlich nur der Literatur zugänglich.
Vermittelt Literatur allein schon durch den Vorgang des Erzählens Sinn?
Ein Großteil des menschlichen Leidens, der Schmerzen, der Schrecken des Menschenlebens bleibt furchtbar und sinnlos, und das muss die Literatur auch widerspiegeln. Literatur vermittelt aber einen kompositorischen Sinn. Sie ist immer das Werk eines Erfinders, also eines Autors, der die Figur erschaffen und ihr ein Schicksal zugedacht hat. Wir lassen uns vielleicht deshalb so gerne Geschichten erzählen, weil dort immer eine Welt imaginiert wird, in der die Menschen ein Schicksal haben. Während es durchaus wahrscheinlich ist, dass wir in dem kalten, riesigen, toten Kosmos, in dem wir leben, eben kein Schicksal haben, sondern Hervorbringungen des reinen Zufalls sind.
Psychologie und Literatur
In unserer Serie sprachen zuletzt:
Isabel Bogdan über das Weiterleben mit der Trauer (Heft 3/2020)
Lucy Fricke über Töchter und abwesende Väter (Heft 11/2019)
Juli Zeh über die Vergeblichkeit verbissener Identitätssuche (Heft 8/2019)
Stephan Thome über die bedrohliche Verlockung des Fremden (Heft 5/2019)
Sie können diese Hefte über unsere Website nachbestellen: psychologie-heute.de/shop
Leseprobe
„Ist er denn gesichtet worden, der Drache?“
„Natürlich nicht. Ein Drache, den man gesichtet hat, wäre ein Drache, der über die wichtigste Dracheneigenschaft nicht verfügt – jene nämlich, sich unauffindbar zu machen. Aus genau diesem Grund hat man allen Berichten von Leuten, die Drachen gesichtet haben wollen, mit äußerstem Unglauben zu begegnen, denn ein Drache, der sich sichten ließe, wäre a priori schon als ein Drache erkannt, der kein echter Drache ist.“
Olearus rieb sich die Stirn.
„In dieser Gegend ist offensichtlich überhaupt noch nie ein Drache bezeugt worden. Somit habe ich Zuversicht, dass einer da ist.“
„Aber an vielen anderen Orten ist auch keiner bezeugt. Warum gerade hier?“
„Erstens weil die Pest sich aus diesem Landstrich zurückgezogen hat. Das ist ein starkes Zeichen. Zweitens habe ich ein Pendel benützt.“
„Das ist doch Magie!“
„Nicht, wenn man ein Magnetpendel nimmt.“
Aus dem Roman Tyll von Daniel Kehlmann. Rowohlt, Reinbek 2017
Daniel Kehlmann, Jahrgang 1975, ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller. Sein Roman Die Vermessung der Welt (2005) wurde in vierzig Sprachen übersetzt. Sein bislang jüngster Roman Tyll (2017), aktuell für den International Booker Prize 2020 nominiert, ist ebenfalls ein Bestseller; Netflix hat die Filmrechte für eine Serie gekauft. 2019 erschien der Band Vier Stücke mit Arbeiten fürs Theater. Kommt, Geister (2015) versammelt seine Poetikvorlesungen an der Uni Frankfurt. Kehlmann ist Gastdozent an der New York University. Ansonsten lebt er mit seiner Familie in Berlin