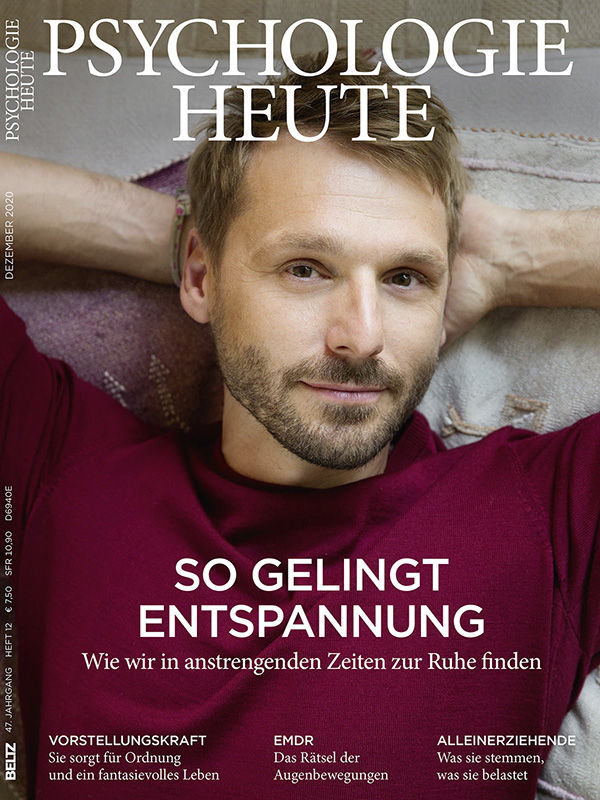Jemand ermutigt uns kurz vor einem kniffligen Gespräch: „Es wird gutgehen.“ Hoffentlich wird es das, denken wir. In der Coronapandemie hoffen viele, dass uns bald ein Impfstoff zur Verfügung steht. Auch im ganz normalen Alltag haben wir eine Menge Hoffnungen: dass wir im Urlaub eine erholsame Zeit haben werden, unser Lieblingsrestaurant heute Abend geöffnet hat oder ein berufliches Projekt erfolgreich sein wird.
Was mit Hoffnung gemeint ist, das verstehen wir ganz intuitiv. Und wie wichtig es ist, Hoffnung…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
gemeint ist, das verstehen wir ganz intuitiv. Und wie wichtig es ist, Hoffnung zu haben, zeigen psychologische Studien schon lange. Der Begriff ist auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen zentral, etwa in der Philosophie. Um Hoffnung geht es ebenso in vielen Religionen, meist verbunden mit dem Wunsch, Leid zu überwinden oder in der Zukunft nicht mehr leiden zu müssen. Versucht man aber, auf den Punkt zu bringen, was Hoffnung genau ist, wird es komplizierter – Hoffnung ist nicht dasselbe wie Optimismus und auch nicht nur eine Erwartung. Was sagt die Psychologie dazu?
Sehnsucht nach etwas Gutem
In den 1980er Jahren stellte der Psychologe Charles Richard Snyder seine Hoffnungstheorie vor. Er versuchte, die individuell unterschiedlichen Ausprägungen der Hoffnung bei Menschen mit einer eigens entwickelten hope scale zu erfassen. Hoffnungsvolle Menschen sind laut dieser Theorie entschlossener, sich auf ein Ziel zuzubewegen, und haben die Erwartung, dass sich Wege finden lassen, ein Ziel zu erreichen. Snyder sieht Hoffnung eher als ein kognitives Phänomen an – für ihn hat es etwas mit Motivation, Entscheidung und Zielerreichung zu tun. Andere Psychologen sehen in der Hoffnung ein Gefühl, das mit einer Erwartung einhergeht, wie die Zukunft aussehen könnte, also eine „Erwartungsemotion“.
An einer einheitlich verwendbaren Definition mangele es jedoch in der Psychologie, schreiben Psychologen von den Universitäten Amsterdam und Tilburg in einem wissenschaftlichen Fachartikel. Sie haben jetzt in fünf Studien mit verschiedenen Stichproben aus den USA und den Niederlanden eine psychologische Beschreibung des Hoffnungsbegriffs erarbeitet, die auf der Befragung von Laien beruht. Zunächst sollten Probanden einer niederländischen sowie einer US-amerikanischen Stichprobe einfach alle Eigenschaften notieren, die sie mit dem Begriff verbanden.
Überzeugung und Glaube
Daraus resultierten zwei lange Listen, aus denen die Forscher 52 Begriffe herausfilterten, die in beiden häufig vorkamen. Die Teilnehmer nannten den Begriff desire am häufigsten, etwa Sehnsucht, Verlangen, Bestreben. Fast gleich häufig kamen vor: „positiv“ und „Zukunft“ – Hoffnung war für diese Befragten also ein psychischer Zustand, in dem man sich nach etwas Gutem sehnt, einer Wendung ins Positive, und von dem man sich wünscht, dass es irgendwann einmal eintritt. Dazu gehöre aber neben dem Wunsch auch die Überzeugung und der Glaube daran, dass das gewünschte Ereignis tatsächlich passieren wird – einhergehend mit dem Wissen, dass das unsicher ist.
Auf der Grundlage dieser ersten Analyse legten die Psychologen anderen Teilnehmern die erstellte Liste mit den 52 Eigenschaften vor und ließen sie angeben, wie eng diese Begriffe ihrer Meinung nach mit dem Terminus Hoffnung zusammenhingen. In weiteren Studien sollten die Teilnehmer diese für Hoffnung zentralen Begriffe lesen, neben vielen anderen Ausdrücken, die nichts mit Hoffnung zu tun hatten. Gemessen wurde dabei die Geschwindigkeit, in der die hoffnungsnahen Wörter wiedergegeben werden konnten. Außerdem ließen die Psychologen die Probanden Situationen beschreiben, in denen sie Hoffnung erlebt hatten oder die neutral waren, und verglichen die Kurztexte miteinander.
Eine Möglichkeit sehen
Folgende Arbeitsdefinition ergab sich aus den Studien: Hoffnung sei die „Überzeugung, der Glaube daran oder das Vertrauen darauf, dass eine Situation in der Zukunft positiv ausgehen wird – einhergehend mit dem Wunsch, dass es so kommt“. Die Psychologen erklären: Diese Definition enthalte die in den Studien ermittelten zentralen Eigenschaften der Hoffnung, die Sehnsucht nach einer positiven Wendung einer Situation und die Überzeugung, dass diese Wendung möglich sei. So umfasse sie sowohl kognitive (Überzeugung) wie auch emotionale Komponenten (Wunsch und Sehnsucht).
Hoffnung sei eng verwandt mit den Begriffen „Optimismus“ und „Liebe“. Wie die Forscher erklären, gibt es aber Unterschiede: Optimisten gehen von einer höheren Wahrscheinlichkeit aus, sie seien sich sicherer, dass das erwünschte Ereignis in der Zukunft auch tatsächlich eintreten werde. Hoffen heiße, dafür eine Möglichkeit zu sehen.
Warum Liebe so eng mit Hoffnung verknüpft wurde, sei weniger klar. Denn Personen könnten Liebe empfinden und gleichzeitig keine Hoffnung haben. Hoffnung hat aus der Sicht der Autoren zwei wichtige psychologische Funktionen: Zum einen helfe sie uns, kritische Situationen zu meistern und nicht aufzugeben: „Verzweifelte brauchen Hoffnung, damit sie dranbleiben und ihr Leben weiterleben.“ Zum anderen motiviere Hoffnung uns in neutralen Situationen, uns anzustrengen, um wichtige Ziele zu erreichen – das, was wir uns wünschen und wonach wir uns sehnen, auch zu bekommen.
Siria Xiyueyao Luo u.a.: What we talk about when we talk about hope: A prototype analysis. Emotion, 2020. DOI: 10.1037/emo0000821