Wenn ich erzähle, dass ich Psychotherapeutin in Ausbildung bin, lautet die häufigste Frage: „Ist es schwer, die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen?“ Sie wird mit einem einfühlsamen Unterton gestellt, der impliziert, was auch ich vor der Ausbildung annahm: Dass die Konfrontation mit Leid und schwierigen Schicksalen einen mitunter nicht mehr loslässt. Das passiert mir zwar ab und an, aber viel seltener als ich angenommen hatte. Womit ich hingegen überhaupt nicht gerechnet hatte, ist, wie oft ich im Positiven an meine Patientinnen denke. Ich sehe eine Stellenanzeige oder schaue eine Serie und habe den Impuls, sie einer Patientin oder einem Patienten zu empfehlen. „Das würde Herrn Z. auch zum Lachen bringen“, schießt es mir durch den Kopf, während ich mit Freundinnen zusammensitze. Ich frage mich, wie das Bewerbungsgespräch von Frau M. gelaufen ist und wie es mit dem Aufstehen klappt. Ich kenne die Namen der Freunde, Töchter und Haustiere meiner Patientinnen. Kein Wunder: Ich gehe asymmetrische und professionelle, aber dennoch aufrichtige Bindungen mit ihnen ein. Ich muss und will mich berühren lassen.
Was schön klingt, kann unfassbar anstrengend sein. Denn ich kann nicht an meine Patientinnen denken, ohne mich selbst als Therapeutin zu verstehen. Und das will ich eben nicht immer sein.
Eine meiner besten Freundinnen ist vor Kurzem in die Ausbildung gestartet und liebt ihren Beruf sehr. Doch neulich berichtete sie, eines morgens aufgewacht zu sein und einen fast unüberwindbaren Widerwillen verspürt zu haben, zur Arbeit zu gehen und Menschen zuzuhören. „Fantastisch!“, rief ich in den Hörer, „deine Abwehrkräfte entwickeln sich! Willkommen zurück im Leben!“ Ich erinnere mich so gut an diese Zeit. Während ich in den ersten Ausbildungsmonaten für die Arbeit lebte – ständig mit meinen Fällen beschäftigt, ständig auf der Suche nach Mustern und Lösungen –, trat nach einiger Zeit eine starke Ermüdung ein. Plötzlich wollte ich nicht mehr nur sanft sein und besuchte deshalb einen Kampfkunstkurs. Ich wollte nicht mehr neutral sein und warf Freundinnen ungefragten Rat zu. Hatte ich noch vor einigen Monaten Sorge gehabt, Patientinnen auf der zu Straße begegnen, während ich in Jogginghose einkaufte, eroberte ich mir Schritt für Schritt die Fülle meines Kleiderschranks zurück. Denn mein Privatleben gehört mir, nicht meinen Patientinnen.
Ob ich durch diese Veränderung auch zu einer besseren Therapeutin geworden bin, bezweifle ich. Manchmal vergesse ich ein Formular und schicke einen Antrag eine Woche zu spät ab. Manchmal bereite ich eine Sitzung nicht vor, weil ich unbedingt ins Theater will. Und ich gestalte meine Freizeit auch nicht, um eine erholte Therapeutin, sondern um ein glücklicher Mensch zu sein. Es ist von unglaublich großer Wichtigkeit, die Privatheit der eigenen Seele zu verteidigen. Ich bin nicht nur Therapeutin. Ich bin auch eine Chaotin, ein Faulpelz, eine Genießerin, ein Frechdachs. All diese Seiten brauchen Platz in meinem Leben. Paradoxerweise kann ich diese besser würdigen, seit ich therapeutisch arbeite. Manchmal, in Gesprächen mit meinen Freundinnen schießt mir durch den Kopf, was ich jetzt fragen würde, wenn das hier eine Sitzung wäre. Und dann verwerfe ich die Frage ganz bewusst. Denn so, wie es jetzt ist, kann ich mein Leben als Marathon durchhalten, nicht nur als Sprint. Ich gehe an neun von zehn Tagen kraftvoll und mit Vorfreude zur Arbeit.
Wenn mir heute etwas zu einer Patientin einfällt, tippe ich das schnell in meine Notizenapp – und denke dann bewusst an etwas anderes. Wenn meine Patientinnen abends die Bühne meines Kopfes betreten, fordere ich sie auf, zu gehen. „Jetzt aber mal alle raus hier“, sage ich freundlich und schließe die Vorhänge. Morgens, auf dem Weg zur Arbeit, lasse ich sie dann alle wieder rein – in meine Gedanken und in mein Herz.

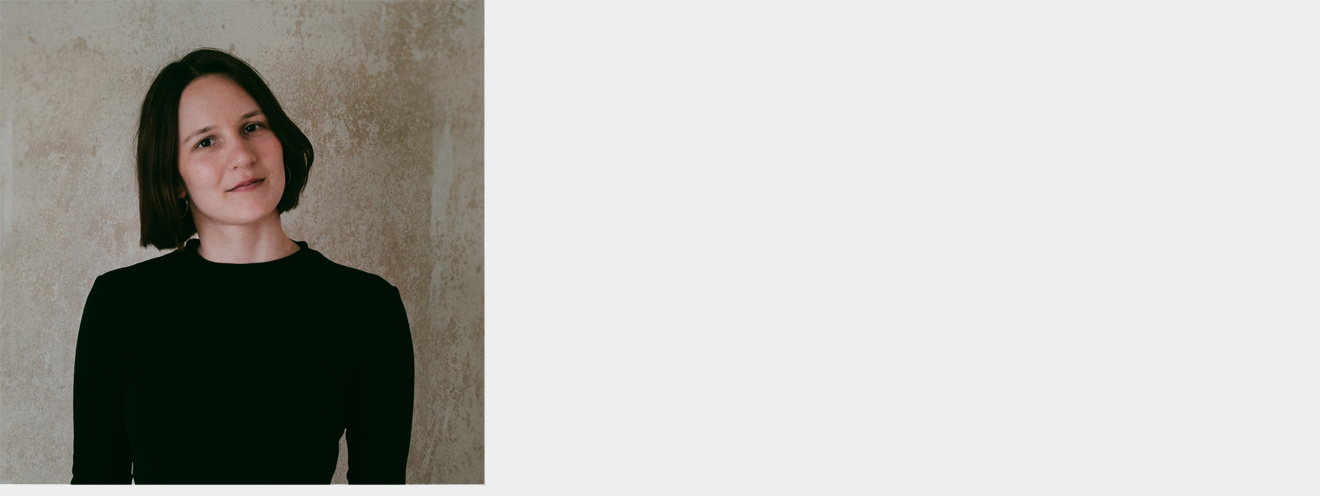
Transparenz-Hinweis: Es gibt keine Therapeutin ohne Patientinnen – deshalb erzählt diese Kolumne von Menschen in der Psychiatrie. Da der Schutz der Behandelten an oberster Stelle steht, werden die Fallbeispiele bezüglich ihrer soziodemographischen und biografischen Daten stark verändert und erscheinen mit zeitlichem Abstand. Die berichteten Begegnungen bleiben in ihrem emotionalen Kern erhalten.








