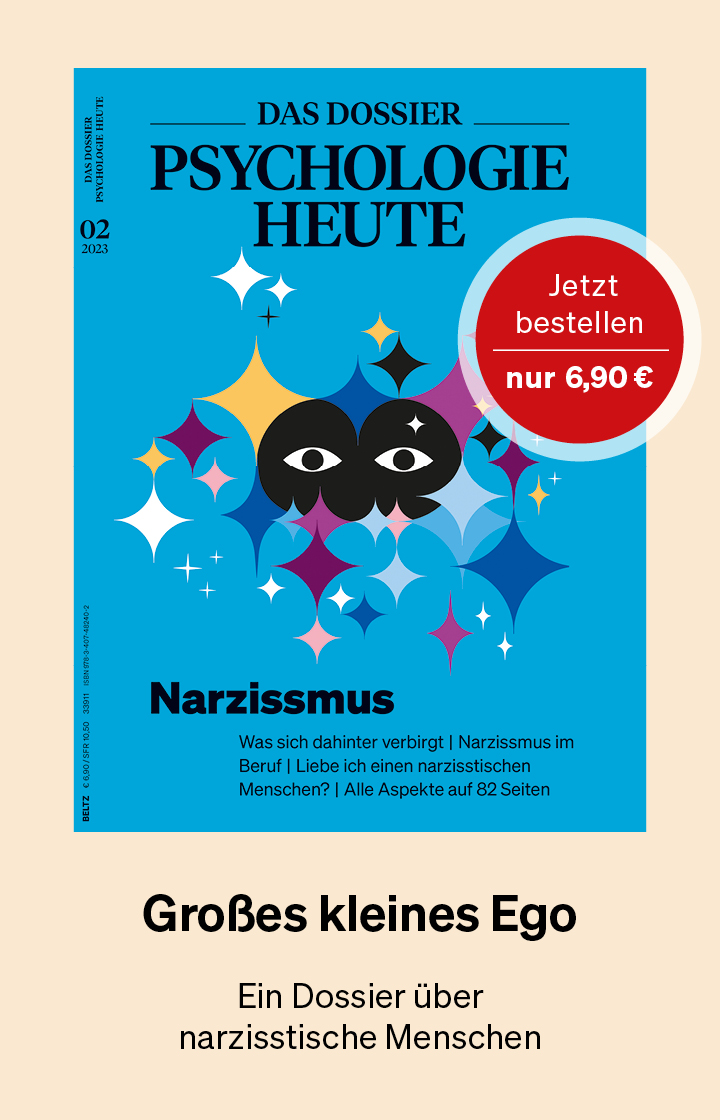Carl Gustav Jung bezeichnete mit dem Wort „Schatten“ – vereinfacht gesagt – jene Persönlichkeitsanteile, die wir verdrängen. Es sind oft negativ besetzte Gefühle wie Neid, Scham oder Gier. Wenn uns im Märchen solche dunklen Seiten begegnen: Ist das in einer Form, die wir sofort als bedrohlich oder böse identifizieren würden? Oder sind es auch Erscheinungen, die uns schlicht fremd oder unbekannt sind?
In der Regel sind sie bekannt, aber sie haben eben einen dunklen Aspekt, den wir nicht toll finden, etwas, das nicht in unser Konzept von „Edel sei, der Mensch hilfreich und gut“ passt. Wir haben dann das Bedürfnis, es wegzuschieben, zu verdrängen. Je höher mein Anspruch ist, ein lieber, guter, hilfsbereiter Mensch zu sein, desto gefährlicher ist auf der anderen Seite die dunkle Seite, die uns den Spiegel vorhält. Das kann Eifersucht sein oder Rivalität, Hass oder Lieblosigkeit. Diese Seiten gehören auch zu uns. Und wenn wir sie verdrängen und wegschieben, dann explodieren sie irgendwann und kommen sehr destruktiv ins Bewusstsein.
In welchen Figuren äußern sich die Schatten? Als böser Wolf, als schwarzer Rabe, als Drachen, als Menschenfresser?
Die Schattenthematik stellt sich im Märchen sehr häufig in Eigenschaften dar wie Neid, Eifersucht und Rivalität. Ein prominentes Beispiel ist Schneewittchen: Die Mutter ist Königin und wünscht sich ein hübsches, gehorsames Kind. In der Urfassung des Märchens ist es nicht die Stiefmutter, sondern die leibliche Mutter, die am Anfang lieb und nett ist. Aber als die Tochter größer wird, bricht die andere Seite in der Mutter hervor, sie verspürt Eifersucht und Rivalität, weil die Tochter so schön ist – schön meint: überlegen. Vier Mal versucht die Mutter daraufhin, ihre Tochter zu töten. Der Schatten ist oft nicht bei den Kindern, sondern häufig bei den Erwachsenen. Bei Rotkäppchen wird er vom bösen Wolf verkörpert. Der böse Wolf ist die dunkle Seite des Mütterlichen, die einen verschlingt, also wirklich gefährlich ist.
Ich habe den Eindruck, dass die Schattenfiguren in Märchen häufig Teil der eigenen Familie sind – böse Brüder, machtgierige Väter, neidische Stiefschwestern.
Ja, das ist eine Seite, die in Märchen dargestellt wird. Wir haben zum Beispiel das Grimmsche Märchen Einäuglein, Zweiäuglein, Dreiäuglein. Das sind drei Schwestern, und die Älteste und die Jüngste neiden der Mittleren ihre Schönheit. Aber nicht nur das, sie sind auch eifersüchtig, weil die Mittlere „normal“ ist, denn sie hat zwei Augen – die älteste Schwester hat nur ein Auge auf der Stirn, und die jüngste Schwester hat drei Augen. Symbolisch steht dahinter die Gefahr, dass man beneidet wird, weil man im Leben gut zurechtkommt. Rivalität unter Geschwistern ist außerordentlich verbreitet, das wollen Eltern oft nicht wahrhaben. Das findet sich auch in den zahlreichen Märchen vom Dummling, in denen immer der Jüngste der Dumme ist. Die beiden Älteren sind die Gescheiten, die Klugen, weil sie intellektuell sind. Und der Dummling, der seinem Gefühl näher ist, ist dann letztlich der, der gewinnt.
Auch zwischen Vater und Sohn gibt es Probleme in Märchen. Sie haben die Figur des Menschenfressers bereits erwähnt. Das ist der, der sagt: Ich bin der Größte, ich bin stark und alles, was für mich Konkurrenz bedeutet, wird verschlungen, also vernichtet. Da werden oft drastische Bilder gewählt.
Ja, in vielen Märchen geht es ganz schön blutig zu, es werden Köpfe abgeschlagen und Kinder verspeist – ist das nicht etwas zu brutal für Kinder?
Kinder erschrecken nicht – sie erkennen den Gehalt. Sie verstehen, dass wenn ein Kopf abgeschlagen wird, es bedeutet, dass man das Leben nicht nur mit dem Verstand meistern kann. Hier lernen sie Dinge nicht in einer intellektuellen Sprache, sondern in Symbolen.
In Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack wird die Aggression vom jüngsten Sohn gelebt, der am Ende mit dem Knüppel dafür sorgt, dass die Habseligkeiten der Brüder – das Tischlein und der Esel – dem betrügerischen Wirt wieder weggenommen werden. Die Brüder hatten nicht gelernt, angemessen mit Aggression umzugehen, und das Ende des Märchens zeigt: Aggression kann entwicklungsfördernd sein, denn dann kommen die Geschenke wieder zurück.
Kinder hören oft: Sei doch nicht so aggressiv – so als sei es etwas Böses. Dabei bedeutet es vom lateinischen Wortstamm her erst einmal: an etwas herangehen, sich mit etwas auseinandersetzen, etwas in Angriff nehmen – das ist positiv. Wenn ich diese Seite in mir anerkenne, sie sozusagen aus ihrem Schattendasein erlöse und ins Bewusstsein integriere, dann finde ich auch Zugang zu meinem kreativen Potenzial, zu meinen Kraftquellen und Ressourcen.
Wenn ich als Eltern meinem Kind Märchen vorlesen: Wie kann ich diese Schattenfiguren einordnen? Sage ich dann: „Jeder Mensch hat auch so ein bisschen einen böses Wolf in sich selbst?“ Das kann ja auch recht beunruhigend sein.
Das wäre sicherlich der zweite Schritt vor dem ersten. Der erste Schritt ist, dass man die Märchen erzählt oder vorliest und auf Pausen achtet, in denen man zum Beispiel sagt: „So ein schwarzer Wolf. Und der sagt zu Rotkäppchen: ,Hol Blumen.‘ Aber vielleicht hat er ja auch recht und die Großmutter würde sich freuen, wenn sie Blumen bekommt. Was meinst du dazu?“ Es ist gut, das Kind immer wieder aufzufordern, sich auf der Gefühlsebene zu äußern, und nicht selbst intellektuell alles zu erklären. Denn Rotkäppchen weiß eigentlich, dass sie in Gefahr ist – „Warum hast du so große Augen?“ –, verleugnet es aber. Sie weiß, dass sie mit der Gefahr auf Distanz umgehen muss. Und das ist ein wichtiger Lerninhalt, den ein Kind selbst emotional erleben sollte, indem man es auf seine Wahrnehmungen anspricht und zum Beispiel fragt: „Warum ist Rotkäppchen denn nicht weggegangen? Kannst du dir das vorstellen?“
Und dann kann man irgendwann auch sagen: „Manchmal passiert es natürlich auch, dass man selbst ganz wütend ist wie der Wolf und furchtbar hungrig und dann ist man selbst auch mal richtig wüst und schlimm und das gehört mit dazu.“ Aber das wäre immer erst der zweite Schritt. Davor liegt eher eine emotionale Selbsterkenntnis.
Wir haben von Vätern und Söhnen und von Töchtern und ihren Müttern gesprochen. Ist es für Kinder wichtig, dass sie in Geschichten Schattenfiguren finden, mit deren Geschlecht sie sich identifizieren können?
Ja und nein. Auf der einen Seite ist es wichtig, dass Kinder Figuren finden, die so sind, wie sie sein wollen. Da können wir einmal von den Märchen zu den Kinderbüchern springen: Pippi Langstrumpf ist ein wundbares Beispiel. Sie ist gutherzig und einfallsreich, aber sie macht auch unpraktische Dinge, die bei Erwachsenen nicht gut ankommen – sie ist nicht nur hell. Das Gegenbeispiel ist Annika, die in ihren frisch gestärkten Kleidern immer lieb und angepasst ist. Trotzdem lieben alle Pippi, weil sie auch eine andere Seite hat und ein Vorbild für viele Mädchen ist.
Aber es muss nicht immer eine gleichgeschlechtliche Figur sein, das zeigt eine andere Geschichte von Astrid Lindgren, nämlich Karlsson vom Dach. Karlsson spielt Streiche, ist gefräßig, isst also immer zu viel, und hat eine sehr hohe Meinung von sich selbst. Er ist der Schattenbruder von dem schüchternen Jungen Lillebror, mit dem er befreundet ist. Ich habe einem Mädchen in der Therapie den ganzen Karlsson vorlesen müssen, und sie sagte zwischendurch: „Ich bin Karlsson.“ Das heißt: „Ich erkenne diese Seite bei mir an und führe ein Leben ohne schlechtes Gewissen.“ Daran sieht man: Karlsson ist als Figur nicht auf Jungen reduziert.
Wenn Schattenaspekte – eben auch destruktive Seiten – bei Kindern durchbrechen, bewerten Eltern das häufig negativ und sagen: „Du bist böse.“ Statt zu sagen: „Dieses Verhalten gefällt mir nicht, das müssen wir ein bisschen relativieren. Aber es hat nichts mit deiner Person zu tun. Deine Person ist hell und dunkel und das ist völlig in Ordnung.“
Astrid Lindgren fängt diese Ambivalenz mit ihren Büchern wirklich wunderbar ein: Michel von Lönneberga ist gutherzig, er will nichts Negatives, sondern er hat einfach Einfälle. Und die Eltern sind relativ wenig einfallsreich und sperren ihn immer wieder zur Strafe in den gleichen Tischlerschuppen. Dort beginnt er, seine Männchen aus Holz zu schnitzen. Wenn er auf sich gestellt ist, verzweifelt er nicht und sagt sich: „Oh, wie bin ich böse.“ Sondern: „Ich bin kreativ.“
Kinder können über Märchen und Kinderbücher spüren, dass sie vielschichtige Menschen sind.
Genau. In Michael Endes Unendlicher Geschichte ist Bastian ein unansehnliches, alleingelassenes Kind ohne Mutter, das nun endlich der große Held sein möchte. Im Verlauf der Geschichte verfällt er immer mehr dem Bedürfnis, nur hell zu sein, eine Lichtfigur. Ja, und dann erlebt er am Schluss, dass er sich hat verführen lassen in eine Einseitigkeit, die einen verrückt macht. Das heißt, wenn ich abspalte und nur das Helle lebe und das Dunkle völlig ausblende, dann bin ich in großer Gefahr; das kann bis in die Psychose gehen. Und das ist das, was Kinder immer wieder verstehen – man muss ihnen dafür keine großen psychologischen Erklärungen geben. Sie verstehen es in Märchen und in Kinderbüchern. Deswegen sind die so unglaublich beliebt.
In der Schattenkonzeption von C G Jung geht es nicht nur um unsere individuellen dunklen Seiten, sondern auch um kollektive Schatten, ich nenne es mal vereinfacht: die dunkle Seite der Gesellschaft, Krieg, Ausgrenzung, Ausbeutung. Können Kinder in Märchen und Geschichten auch über die gesellschaftlichen Schatten etwas lernen?
Der kollektive Schatten ist im Moment so wichtig, weil Kinder über die Nachrichten von der politischen Situation viel zu viel mitkriegen und dadurch Angst bekommen. Was jetzt bei uns kollektiv explodiert, sind eigentlich die Schattenaspekte: Macht haben, gierig sein, mehr haben wollen, neidisch sein.
Dazu fällt mir ein weiteres Michael-Ende-Buch ein: Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Darin gibt es den Scheinriesen Herrn Tur Tur. Aus der Ferne wirkt er riesig, aber je näher man kommt, desto kleiner wird er. Menschen projizieren ihre eigenen Ängste auf die anderen, Angst und Aggression sind die zwei Seiten einer Medaille. Und wenn ich den Schatten integrieren will, muss ich mit meiner Angst umgehen.
Es ist wichtig, dass wir den Kindern über Märchen die Perspektive eröffnen, dass auch etwas schwierig und schlimm ist, im Außen und in ihnen selbst. Und dass es immer auch ein gutes Ende gibt.
Würden Sie sagen, dass es sich auch für Erwachsene lohnt, sich mit Märchen zu beschäftigen und so den dunklen Seiten Raum zu geben?
Ja, früher waren Märchen durchaus Unterhaltung für Erwachsene, da hat man sich um die Dorflinde versammelt und sich Märchen erzählt, weil man in ihnen etwas verstanden hat, was wir heute erst mithilfe psychologischer Interpretationen glauben können. Ich frage Menschen manchmal nach ihrem Lieblingsmärchen; sehr viele haben eines, das vielleicht sagt: Mein Leben ist ein schwieriges, und ich bin herausgefordert zu kämpfen. Oder eines, das erzählt: Ich habe es geschafft, trotz aller Herausforderungen. Märchen können ein Stück Lebenshilfe sein.
Christiane Lutz ist Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche mit eigener Praxis in Stuttgart, Dozentin am C. G. Jung-Institut Stuttgart und eine profunde Kinderbuch- und Märchenkennerin. 2021 ist von ihr erschienen: Von der sehnsüchtigen Suche nach Sinn: Eine tiefenpsychologische Annäherung an die Unendliche Geschichte