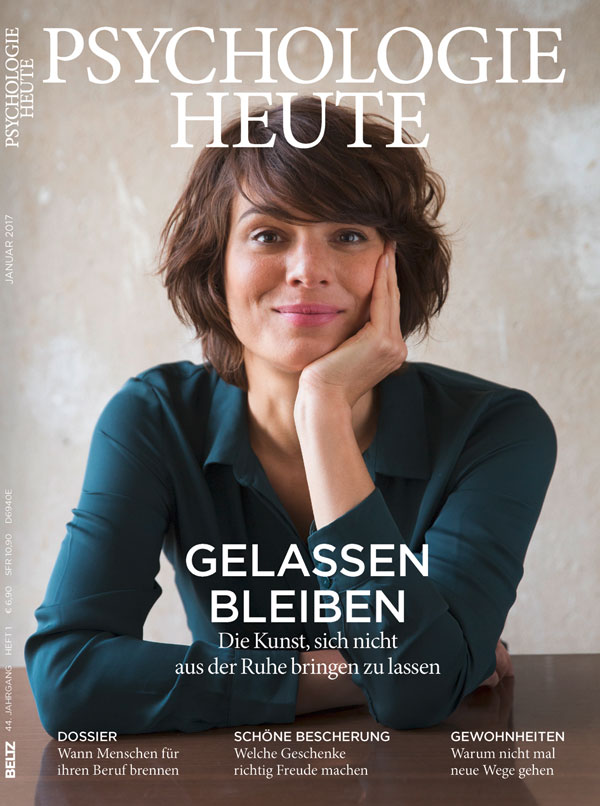Ende der 1970er Jahre tauchte in Berlin, Connecticut ein junger Mann auf, der behauptete, Sohn reicher deutscher Eltern zu sein. Ein Ehepaar nahm ihn als Austauschschüler auf. Er erwies sich als Flegel, und als die Familie genug von ihm hatte, überredete er seine 22-jährige Freundin Amy, ihn zu heiraten, da ihm bei Ausreise nach Deutschland ein Einsatz als Soldat in Russland drohe. Als er nach der Hochzeit eine Aufenthaltsgenehmigung in der Tasche hatte, verließ er seine Frau. Einige Jahre später heiratete…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
in der Tasche hatte, verließ er seine Frau. Einige Jahre später heiratete er eine wohlhabende Managerin und überredete sie, ihm die Verwaltung ihres Vermögens zu überlassen. Wer war dieser Mann?
Manche kannten ihn als wohlhabenden Absolventen der Elite-Universität Yale, andere als Kunstsammler. Manchen stellte er sich als Schiffskapitän oder als britischer Aristokrat vor, als Fernsehproduzent, Börsenmakler oder jemand, der die Schulden der Dritten Welt lösen könne. Er war nichts von alledem. Sein echter Name war Christian Gerhartsreiter. Gerhartsreiter ist ein Betrüger, der viele Menschen um viel Geld gebracht hat. Inzwischen wird ihm vorgeworfen, seinen Vermieter und dessen Frau und Sohn, die ihm möglicherweise auf die Schliche gekommen waren, ermordet zu haben.
Christian Gerhartsreiter ist kein Einzelfall. Ferdinand Demara schlich sich bei der US-Navy als Chirurg ein und operierte Verwundete. Ohne Ausbildung. Der Bremer Gert Postel machte Karriere als Psychiater, zeitweise arbeitete er als Notarzt. Eigentlich war er Postzusteller. Andreas Holst aus Kiel erklärte 2014 mit Kapitänsmütze und weißem Bart vor Fernsehkameras, dass er von Piraten entführte Seeleute in Afrika freikaufen wolle. Er sammelte Spenden – und verschwand mit dem Geld.
Diese Hochstapler waren wahre Genies darin, sich das Vertrauen anderer zu erschleichen. Mit gezielten Strategien wiegten sie ihre Opfer in Sicherheit. Sie alle waren zu gutgläubig.
Hochstapelei ist ohne Vertrauen nicht denkbar. Unser Alltag allerdings auch nicht. Es ist ein Dilemma: In welchem Maß dürfen wir uns auf andere verlassen? Denn einerseits wollen wir nicht hinters Licht geführt werden. Anderseits sind Freundschaft und Liebe kaum mit grundsätzlichen Zweifeln am anderen vereinbar. Und normalerweise bauen wir auch darauf, auf der Straße von unseren Mitmenschen weder überfahren noch überfallen oder belästigt zu werden. Wir liefern uns Piloten und Ärzten aus, überlassen unsere Kinder Erziehern und Lehrern. Oft tun wir das, ohne lange darüber nachzudenken.
Wissenschaftler versuchen zu entschlüsseln, was das eigentlich ist, dieses Vertrauen. Wie entsteht es? Anhand welcher Kriterien entscheiden wir, ob Vertrauen gerechtfertigt ist? Wie können wir uns vor Betrügern schützen, ohne zynisch durchs Leben gehen zu müssen?
„Unser Verstand entwickelte sich nicht in einem sozialen Vakuum“, schreibt David DeSteno von der Northeastern-Universität in Boston in seinem Buch The Truth About Trust. Die wichtigste Herausforderung für unsere Vorfahren sei gewesen, herauszufinden, auf wen sie bauen konnten und auf wen nicht. Dieses Erbe tragen wir noch immer in uns: Unser Verstand ist laufend damit beschäftigt, die Vertrauenswürdigkeit anderer zu beurteilen. Meistens laufen diese Prozesse automatisch ab, sodass wir sie nicht bewusst wahrnehmen.
Manchmal geben wir jemandem Geld, obwohl wir ahnen, dass wir es nicht zurückbekommen
Wenn wir das Wort Vertrauen hören, verbinden wir damit bestimmte Gefühle, die wir nicht leicht benennen können. „Vertrauen ist ein Begriff wie viele andere, aber wenn wir ihn definieren möchten, zeigt sich plötzlich, wie komplex er ist“, sagt Detlef Fetchenhauer, Sozialpsychologe an der Universität zu Köln. „Nach unserer Auffassung besteht Vertrauen aus drei Komponenten: einer kognitiven, emotionalen und behavioralen, also einer Verhaltenskomponente.“ Leihe ich jemandem, dem ich vertraue, Geld, ist das die Verhaltenskomponente. Dabei gehe ich davon aus, dass ich das Geld zurückbekommen werde – das ist die kognitive Komponente oder die Erwartungshaltung. Und weil ich mit dem Geld jemandem helfe, fühle ich mich gut. Das ist die emotionale Komponente.
„Diese drei Komponenten korrelieren nur gering miteinander“, sagte Fetchenhauer. „Manchmal geben Leute jemandem Geld, obwohl sie ahnen, dass sie es nicht zurückbekommen werden. In Studien haben wir gezeigt, dass Menschen es trotz ungutem Gefühl oft tun, weil es für sie noch viel unangenehmer ist, Misstrauen zu signalisieren. Wir können deshalb nicht aus der einen Komponente auf andere schließen.“
Im Alltag geben wir also oft freiwillig oder unfreiwillig Vertrauensvorschüsse. „Das ist in unserer hochkomplexen modernen Gesellschaft in der Tat positiv“, sagt Fetchenhauer. „Schon beim Bäcker müssen wir davon ausgehen, dass Backwaren nicht schädlich oder giftig sind. Wir vertrauen also vielen Fremden, weil das soziale Miteinander davon abhängig ist.“ Das lohnt sich für uns. Würden wir jedes Brötchen auf Unbedenklichkeit untersuchen wollen, würden wir wohl verhungern. Der Vorteil des Vertrauens überwiegt in der Regel also die möglichen Risiken. Trotzdem verwenden wir viel kognitive Energie darauf, unser Grundvertrauen in andere Leute fortlaufend zu aktualisieren. Unser Verstand überprüft unbewusst, ob wir in eine gefährliche Situation geraten könnten.
Ob wir uns auf andere verlassen, hängt von unseren Erfahrungen ab. Wenn wir in der Vergangenheit von Ärzten stets gut behandelt wurden, erwarten wir das auch von anderen Angehörigen dieser Berufsgruppe. Wir geben einem neuen Mediziner selbst dann einen Vertrauensvorschuss, wenn wir nichts über ihn wissen. Deshalb bleibt immer eine Restunsicherheit: Vielleicht liefern wir uns einem Scharlatan aus. „In vielen Bereichen haben wir allerdings gar keine andere Möglichkeit, als dieses Risiko einzugehen, weil uns die fehlende eigene Expertise dazu zwingt, in Vertrauen zu investieren“, sagt Martin Schweer, Leiter des Zentrums für Vertrauensforschung an der Universität Vechta.
Vertrauen macht uns verletzlich. Hochstapler sind Menschen, die das geschickt ausnutzen, weil sie unsere Schwachstellen kennen. Einige von diesen sind wohl biologisch fest in uns verankert. Wir können nicht aus unserer Haut. Diese Denk- und Verhaltensmuster erforschte der Sozialpsychologe Robert Cialdini. Er hat einige prinzipielle Einfallstore in unser Vertrauen ausgemacht.
Erstens: der kleine Gefallen. Bittet uns jemand wegen einer Kleinigkeit um Unterstützung, helfen wir meist. Rückblickend erscheint diese Person als hilfsbedürftig. So ins rechte Licht gerückt, folgt dann die große, eigentlich unverschämte Bitte. Auch Verkäufer kennen diesen Trick. Sie lassen einen Stift fallen und fragen, ob wir ihn aufheben könnten. Dann haben sie aber noch ein Anliegen: Wie wäre es, den Vertrag für den Gebrauchtwagen jetzt und sofort zu unterzeichnen?
Zweitens: der große Gefallen. Die Manipulation funktioniert auch umgekehrt. Weil wir eigentlich vertrauen wollen, füllen wir uns schuldig, wenn wir nein sagen. Betrüger fragen deshalb mitunter nach Dingen, die wir ihnen unmöglich zugestehen können. Weil uns das leidtut, akzeptieren wir aber den nächsten, kleineren Gefallen.
Drittens: das Geschenk. Die bekannteste Masche ist die Ausnutzung des Reziprozitätsprinzips: Wenn uns jemand etwas schenkt und uns später um einen Gefallen bittet, fällt es uns schwer abzulehnen. Ganz egal, worum es geht.
Eine gewisse Anfälligkeit für dreiste Betrüger haben viele Menschen. Wir glauben, dass es immer ein wenig aufwärts im Leben geht, dass wir einzigartig sind. Wir sind netter, ethischer, gewissenhafter als andere; und wenn jemand uns ein Vermögen verspricht, dann glauben wir ihm nicht, weil sein Plan plausibel klingt, sondern weil wir uns wünschen, dass wir vom Glück auserwählt wurden. Wir denken, wir hätten es verdient, beruflich aufzusteigen, dass sich ein charmanter Junggeselle in uns verliebt oder ein Millionär uns unterstützt.
Die meisten Hochstapler manipulieren bereits in frühester Kindheit
Hochstapler können nicht nur Vertrauenssignale aussenden, sie spüren jegliches Misstrauen und wirken ihm sofort entgegen. Sie gehen in der Rolle, die sie spielen, auf – ob als Finanzexperte, heiratswilliger Millionenerbe oder respektierter Arzt. „Betrüger sind meist charmant, gewinnend und gute Erzähler“, sagt Jens Hoffmann vom Institut Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt. Hoffmann unterscheidet bei Hochstaplern hauptsächlich zwei Typen: Narzissten und Psychopathen. Narzissten sind von sich begeistert und mögen Statussymbole. Sie möchten in eine besondere Position gelangen oder in den besseren gesellschaftlichen Kreisen verkehren. Vor allem suchen sie Bewunderung, aber sie sind nicht am Wohlergehen anderer interessiert. Einen Anspruch auf ihre erschlichene Position haben sie in ihren Augen, weil sie ja sie selbst sind. Psychopathen sind indes hochmanipulativ; ihr Bedürfnis ist die Dominanz. Sie wollen andere kleinmachen und bauen ebenfalls keine inneren Bindungen auf. Auch sie sind gute Erzähler. Beide Persönlichkeitsmerkmale sind in der Gesellschaft weit verbreitet, aber viele betroffene Menschen finden damit einen Beruf, der zu ihnen passt und ihre Bedürfnisse ohne große Betrügereien befriedigt: Verkäufer, Politiker, Schauspieler, Führungskräfte.
Die meisten Hochstapler fangen in frühester Kindheit damit an, andere zu manipulieren. Es ist unklar, warum sie zu Hochstaplern werden – möglicherweise wurden sie von ihren Eltern vernachlässigt oder aber, im Gegenteil, verhätschelt. So oder so sehnen sie sich ihr Leben lang nach Bewunderung.
Mit den ersten Erfolgen wachsen sie in die Rolle hinein. Finden Betrüger ein Opfer, erschaffen sie gemeinsam mit ihm eine Welt, in der sie selbst in gutem Licht dastehen, das Opfer allerdings auch: Sie machen gemeinsame Sache. Diese Illusion ist das Erfolgsprinzip. „Ich war die Verwirklichung ihrer Träume. Das Idol. Der Held. Der Meister und Gebieter ihres Lebens“, sagte einst Charles Ponzi, der damit reich wurde, dass er seinen Investoren hohe Gewinne versprach – ihnen aber verschleierte, wie genau diese zustande kommen sollten. Seine Masche – Renditen versprechen, die zu gut sind, um wahr zu sein – ging als Ponzitrick in die Geschichte ein.
Den Opfern fällt es schwer, sich einzugestehen, dass die Traumwelt nicht real ist, und deshalb kommen sie nicht gut aus der Sache heraus. Einem Mann oder einer Frau fällt es schwer zu akzeptieren, dass der charmante Ehepartner ein Heiratsschwindler ist und einen nie attraktiv fand. Das ist peinlich und schmerzhaft. „Aus Selbstschutz reden sie sich die Illusion auch oft nachträglich schön“, sagt Fechtenhauer. „Sie schreiben die Vergangenheit so um, dass sie nichts daraus lernen.“
Von außen betrachtet, erscheinen Betrugsopfer oft als naiv. Aber niemand ist immun gegen Hochstapler, insbesondere in Situationen, in denen wir verletzlich sind: bei Einsamkeit, Arbeitslosigkeit, Scheidung, Krankheit, einem Unfall oder Schulden. Manche Menschen sind allerdings anfälliger als andere – etwa besonders optimistische und religiöse Leute, die am Wohlergehen anderer interessiert sind. „Das ist ein Einfallstor, das oft missbraucht wird“, sagt Jens Hoffmann. „Wachsame, zurückhaltende Persönlichkeiten fallen seltener auf Hochstapler herein.“
Es ist nun einmal nicht leicht, Hochstapler zu durchschauen. Es erfordert eine andere Art von Vertrauen – das Vertrauen in das eigene Bauchgefühl. „Wenn ich zu schnell begeistert bin und nicht weiß, warum, ist das ein Warnzeichen“, sagt Hoffmann. „Und wenn ich merke, ich habe ein komisches Gefühl und möchte eigentlich etwas nicht tun – dann ist es höchste Zeit, einen Schritt zurückzutreten und mit Distanz über alles nachzudenken.“ Menschen, die nichts im Schilde führen, haben in der Regel Verständnis. Bei längeren Beziehungen sei es zudem hilfreich, mit anderen Menschen zu sprechen, die das Geschehen von außen betrachten, sagt Jens Hoffmann. In seinem Buch Menschen entschlüsseln gibt er weitere Tipps, Manipulationen zu erkennen.
„Der beste Weg, herauszufinden, ob du jemandem trauen kannst, ist, ihm zu trauen“, ist ein Zitat, das Ernest Hemingway zugeschrieben wird. Shakespeare schrieb hingegen: „Liebe alle, traue wenigen, tue niemandem Unrecht.“ Aus Sicht der psychologischen Forschung liegt die Lösung irgendwo in der Mitte.
Literatur
Maria Konnikova: The confidence game. Why we fall for it … every time. Viking, New York 2016
Jens Hoffmann: Menschen entschlüsseln. MVG, München 2016 (4. Auflage)