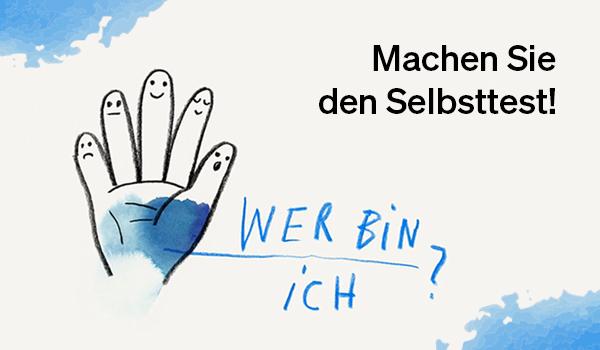Herr Professor Hancock, Sie erforschen, wie wir mit Wahrheit, Lüge und Täuschung umgehen. Wieso gerade dieses Thema?
Das begann in meiner Zeit als Student. Damals haben die kanadischen Behörden Leute gesucht, die beim Zoll aushelfen. Zusammen mit meinem besten Freund habe ich mich beworben – und plötzlich waren wir für zwei Jahre beim Zoll. Manchmal sage ich heute im Scherz: „Ich habe Kanada mit einem Stempel verteidigt.“ Das war jedenfalls das erste Mal, dass ich beruflich mit dem Thema Lüge und Täuschung…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
Stempel verteidigt.“ Das war jedenfalls das erste Mal, dass ich beruflich mit dem Thema Lüge und Täuschung in Berührung gekommen bin.
Wie war das damals beim Zoll? Haben die Leute viel gelogen?
Das merkt man ja nur, wenn man jemanden erwischt. Vermutlich haben viele mir was vorgeschwindelt und sind damit durchgekommen.
Die meisten Laien glauben, dass sie einen Lügner ganz gut erkennen können. Dass man es an den Augen sieht oder an einer zappeligen Körpersprache. Man denkt, es läuft wie bei Pinocchio, dessen Nase länger wird, wenn er schwindelt.
Dazu gibt es sehr viele Untersuchungen. Tatsächlich erkennen wir eine Lüge nur in 54 Prozent aller Fälle. Genauso gut könnte man eine Münze werfen – Kopf oder Zahl? Deshalb meine Antwort: Ja, die Leute glauben, sie könnten eine Lüge erkennen. Und: Nein, sie können es nicht.
Sie erforschen seit vielen Jahren, wie wir lügen, wenn wir E-Mails oder SMS schreiben, wenn wir WhatsApp oder Facebook nutzen. Was haben Sie herausgefunden? Lügen wir häufiger, wenn wir über solche Medien kommunizieren?
Genau das glauben die meisten Menschen, und dieser Glaube speist sich aus drei Grundannahmen. Erste Annahme: Am Computer fehlen die – vermeintlich verräterischen – Signale von Mimik und Gestik. Also kommt man über diese Medien leichter mit einer Lüge davon. Folglich wird man im Internet häufiger lügen.
Klingt einleuchtend.
Stimmt aber nicht! All unsere Studien zeigen, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Die meisten Leute sagen fast immer die Wahrheit. Nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung lügt häufig – nämlich die Psychopathen und die pathologischen Lügner. Aber diese Leute lügen ja auch, wenn sie nicht per Computer oder Handy kommunizieren.
Nur damit ich Sie richtig verstehe: Wir lügen in E-Mails seltener als von Angesicht zu Angesicht?
Korrekt. In E-Mails sind wir im Allgemeinen ziemlich ehrlich. Und wissen Sie, über welches Medium wir die meisten Lügen erzählen? Über das Telefon. E-Mail, Instant Messaging, direktes Gespräch, Telefon – mit jedem Wechsel des Mediums steigt die Anzahl der Lügen. Und die Unterschiede sind enorm: Am Telefon lügen wir zweieinhalbmal häufiger als per E-Mail.
Wie erklären Sie sich das?
Dazu muss ich ein wenig ausholen. Die Frage lautet doch: Welche Features, welche Eigenschaften eines Mediums haben Einfluss auf unsere Ehrlichkeit? Und ich glaube, dass da vor allem drei Faktoren eine Rolle spielen: Findet die Kommunikation gleichzeitig statt wie beim normalen Gespräch, am Telefon und beim Onlinechat – oder zeitversetzt wie bei Brief und E-Mail? Zweitens: Sind unsere Worte flüchtig wie im mündlichen Gespräch – oder kann man sie speichern, kopieren und weiterleiten? Und drittens: Wie groß ist die räumliche Distanz zwischen den Gesprächspartnern? Meine Vorhersage lautet: Die Faktoren Gleichzeitigkeit, Flüchtigkeit und große Distanz führen kombiniert zu den meisten Lügen. Und genau das haben unsere Untersuchungen immer wieder bestätigt.
Was ich nicht verstehe: Warum spielt die Gleichzeitigkeit dabei eine Rolle?
Da geht es eher um die kleinen, harmlosen Alltagslügen. Man sagt: „Hey, tolles Kleid“ – auch wenn man das Teil hässlich findet. Ich nenne diese Art der Flunkerei eine „Butler-Lüge“. Man will einfach nett sein und die Form wahren. Butler-Lügen haben wir immer dort, wo man schnell reagieren, schnell antworten muss – und außerdem keinem auf den Schlips treten will. In E-Mails flunkern wir viel weniger. Man hat ja Zeit, sich eine elegante Antwort zu überlegen, die einerseits wahr ist und trotzdem niemanden beleidigt.
Jedes Medium produziert also seine eigene Art von Lügen?
Absolut. Wir haben in E-Mails vor allem Erklärungslügen entdeckt. Man erklärt sich gegenüber einem Vorgesetzten für ein Fehlverhalten. Ein Student schreibt seinem Professor zum Beispiel: „Der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen.“ Das ist eine typische E-Mail-Lüge. Text-Messages dagegen, etwa über WhatsApp, sind eine gleichzeitige Form der Kommunikation. Es überrascht nicht, dass wir hier viele Butler-Lügen gefunden haben. Ich meine, jetzt mal ehrlich: Jeder von uns hat schon einmal den Satz „Bin unterwegs“ in sein Handy getippt. Und keiner von uns saß zu diesem Zeitpunkt schon im Taxi. Wir wollten nur nett sein und unserer Verabredung signalisieren, dass wir an sie denken, dass sie uns wichtig ist – wir uns aber trotzdem verspäten werden.
Was ist mit der Annahme: „Wir lügen mehr, wenn wir wissen, dass wir damit durchkommen“?
Das ist eine Milchmädchenrechnung. Mein Kollege Dan Ariely hat dazu eine Menge geforscht. Und er konnte zeigen, dass die meisten Menschen manchmal ein bisschen mogeln. Aber das bleibt alles in einem sehr kleinen Rahmen – selbst wenn man weiß, dass man dabei niemals erwischt werden kann. Die Erklärung dafür lautet: Wir wollen, wenn wir in den Spiegel schauen, einen ehrlichen Menschen sehen, einen guten Kerl, dem man vertrauen kann. Ich sage meinen Studenten immer: Niemand lügt, solange er keinen sehr guten Grund dafür hat.
Reden wir über die Geschichte von Cyrano de Bergerac. Er verfasste Liebesbriefe im Namen eines anderen, war aber wirklich in die Frau verliebt, an die er schrieb. War Cyrano ein Lügner?
Cyrano ist ein interessanter Fall. Sie wissen vielleicht, dass es heute Firmen gibt, die etwas ganz Ähnliches anbieten: Sie fungieren als Ghostwriter fürs Onlinedating und sorgen dafür, dass man ein attraktives Profil bekommt und damit seine Chancen auf dem Heiratsmarkt erhöht. Man nennt diese Leute Cyrano professionals. Aber sind diese Profile deshalb gleich eine Lüge?
Sie haben in einer Studie untersucht, wie ehrlich Hotelbewertungen sind. Was haben Sie dabei herausgefunden?
Diese gefälschten Kritiken sind ja tatsächlich ein Problem. Man kann sich solche Bewertungen heute buchstäblich kaufen. Man mietet sich ein paar sogenannte Klickarbeiter (mechanical turks) und lässt sich für wenige Dollars eine große Menge von Jubelbewertungen schreiben. Nicht nur bei Hotels, auch bei Büchern oder Schallplatten. Amazon geht inzwischen ziemlich hart dagegen vor. Jedenfalls habe ich mich mit ein paar Informatikern von der Cornell-Universität zusammengesetzt und Folgendes gemacht: Wir haben nach genau demselben Verfahren 400 gefälschte Hotelbewertungen schreiben lassen. Diese Texte haben wir dann mit echten Bewertungen aus dem Netz verglichen und ein paar deutliche sprachliche Unterschiede festgestellt.
Worauf haben Sie dabei besonders geachtet? Was genau hat die Fälscher verraten?
Wir haben uns die Struktur der Sprache angesehen. Man zerlegt den Text dafür in viele kleine Elemente. Wie viele Verben stehen in dem Text? Wie viele Pronomen? Und so weiter. So bekommt man eine numerische Beschreibung für jeden einzelnen Text. Diese Muster haben wir dann per Computer ausgewertet.
Es ging also um Grammatik?
Zum Teil schon. Zum Beispiel gebrauchten die Fälscher viel häufiger das Wort „ich“. Sie reden dauernd über sich selbst. Aber etwas anderes war noch wichtiger: Gefälschte Bewertungen lesen sich wie eine fiktive Erzählung, während die echten Reviews eher die Form von Sachtexten hatten. Leute, die wirklich im Hotel waren, erzählen davon, wie die Räume ausgesehen haben, wie groß sie waren, wo das Bett stand. Es gab viel mehr Details. Die Fälscher dagegen haben davon erzählt, was sie dort alles gemacht haben, wer noch alles mit dabei war. Und sie haben viel mehr Adjektive benutzt wie „wundervoll“, „toll“ oder „großartig“.
Sie haben auch erforscht, wie ehrlich wir mit unserem Lebenslauf sind – zum Beispiel auf der Jobplattform LinkedIn. Mit welchem Ergebnis?
Es stellte sich heraus, dass wir im Netz viel ehrlicher sind als bei einem traditionellen Lebenslauf, den wir ausdrucken und mit unserer Bewerbung an irgendeine Personalabteilung schicken. Ein Netzwerk wie LinkedIn erzieht die Leute zu mehr Ehrlichkeit. Eigentlich ist das nicht verwunderlich. Schließlich weiß jeder: Hier in diesem Netzwerk gibt es viele, die genau wissen, wie lange ich wo und in welcher Position gearbeitet habe. Vor denen will ich nicht als Lügner dastehen.
Wie ehrlich sind wir in unseren Selbstdarstellungen auf Datingportalen?
Die meisten flunkern in ihren Profilen. Männer machen sich ein bisschen größer und erfolgreicher, Frauen machen sich ein bisschen leichter und jünger. Fast alle mogeln. Aber nur ein bisschen. Das liegt zum Teil an dem, was ich vorhin gesagt habe: Keiner will vor sich selbst als Betrüger dastehen. Außerdem würde eine krasse Lüge immer auffliegen. Wenn ein 1,70-Mann behauptet, 1,90 groß zu sein, hat er spätestens beim ersten Date ein Problem.
Ich möchte noch über das Thema Vertrauen sprechen – sozusagen über die Empfängerseite unserer Geschichte. Wie sehr vertrauen wir anderen, wenn wir uns im Internet bewegen?
Es scheint da ein bestimmtes Muster zu geben. Im Allgemeinen glauben die Leute: Ich selbst sage praktisch immer die Wahrheit – aber meine Mitmenschen lügen oft. Wir überschätzen also die eigene Ehrlichkeit und unterschätzen die Ehrlichkeit der anderen. Eine unserer aktuellsten Studien zeigt, dass dieser Effekt sich noch einmal verstärkt, sobald wir uns im Internet bewegen. Das heißt: Unser Vertrauen in andere schwindet, wenn wir E-Mails oder Instant Messages bekommen. Wir misstrauen allem, was aus dem Netz kommt. Aber wenn man sich dann das konkrete Verhalten der Menschen ansieht, merkt man, dass sie in Wahrheit ziemlich viel von dem glauben, was sie zu lesen kriegen.
Sie meinen: Wir verhalten uns naiv?
Nicht unbedingt. Es zeigt sich nämlich, dass dieses eher vertrauensvolle Verhalten fast immer eine gute Entscheidung ist. Schließlich wird, wie wir schon gesagt haben, im Netz deutlich weniger gelogen, als die Leute im Allgemeinen glauben. Aber der ganze Komplex um „Vertrauen im Internet“ ist ehrlich gesagt noch nicht besonders gut erforscht. Ich halte das für ein riesiges Feld, in dem auf uns Forscher noch eine Menge Arbeit wartet.
Warum könnte das relevant sein?
Kürzlich hatte ich einen Gast bei mir an der Uni, einen der Gründer von Airbnb …
… einer Plattform, auf der man seine Privatwohnung an Fremde vermieten kann.
Er hat eine kleine Übung mit meinen Studenten gemacht und gesagt: „Holt euer Handy aus der Tasche und gebt es der Person, die rechts neben euch sitzt.“
Das machen die nie!
Die jungen Leute rasten da schon ein bisschen aus, aber am Ende spielen dann doch alle mit. Dann sagt er: „Okay, als ihr euer iPhone weitergegeben habt, da habt ihr’s mit der Angst zu tun bekommen. Aber wie ist es, das Handy eines anderen in den Händen zu halten? Man fühlt sich verantwortlich! Man will gut darauf aufpassen! Und genau das passiert, wenn du – wie bei Airbnb – in der Wohnung eines anderen Menschen lebst.“ Dasselbe erzählen die Leute von Rent the Runway, wo man sich von Privatleuten sehr teure Klamotten für einen Abend leihen kann: Die Kleider kommen in makellosem Zustand zurück. Ich glaube, wenn wir über Vertrauen reden, dann neigen wir dazu, uns nur die eine Seite anzusehen, die verwundbare Seite der Gleichung. Aber es gibt auch die andere Seite, die Seite derer, denen man Vertrauen schenkt. Und da sehen wir: Die meisten Leute sind sehr verantwortungsvoll und sehr vertrauenswürdig. Und darauf fußt diese ganze neue Welt der Share Economy. Manche glauben: Airbnb oder Uber funktionieren, weil wir diesen Unternehmen vertrauen. Aber im Mittelpunkt steht etwas anderes, nämlich die Tatsache, dass wir unseren Mitmenschen vertrauen.
Jeff Hancock ist Psychologe und war über viele Jahre Professor für Kommunikationswissenschaften an der Cornell University. Inzwischen hat er einen Lehrstuhl an der Stanford University im Silicon Valley.
Verlaufen Paarkonflikte besser, wenn man sie per Internet austrägt?
Alle Paare streiten dann und wann. Doch auch auf diesem Feld haben die modernen Kommunikationsmedien das Spiel verändert. So haben Studien gezeigt, dass Menschen mit geringem Selbstwertgefühl dazu neigen, Paarkonflikte nicht von Angesicht zu Angesicht auszutragen. Sie verlagern den Streit lieber auf die elektronischen Medien. Ist das eine gute Idee? Diese Frage stellten sich die gelernten Psychologen Lauren Scissors und Darren Gergle von der Northwestern University. In ihrer Studie baten sie 88 Paare ins Labor, maßen bei jedem Teilnehmer die Höhe des Selbstwertgefühls per Fragebogen und gaben den Paaren anschließend die Aufgabe, sich acht Minuten lang über ein strittiges Thema zu unterhalten. Die Hälfte der Paare saß sich dabei gegenüber, die andere Hälfte kommunizierte am Computer über einen Instant Messenger. Es zeigte sich, dass Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl besonders unzufrieden mit der Diskussion waren, wenn diese via Computer stattgefunden hatte. Sie hatten hinterher auch das Gefühl, der Streit habe einen schlechten Einfluss auf die Beziehung gehabt. Anders gesagt: Wenig selbstbewusste Menschen fürchten zwar eine Auseinandersetzung von Angesicht zu Angesicht, würden aber genau davon am meisten profitieren. Ironischerweise läuft die Sache für selbstbewusste Partner umgekehrt. Sie lösen Konflikte am liebsten Aug in Aug. Tatsächlich empfinden sie einen Streit aber als weniger belastend, wenn sie ihn am Rechner austragen.
Lauren Scissors, Darren Gergle: On the bias: Self-esteem biases across communication channels during romantic couple conflict. Proc. of CSCW ’16, 2016, 383–393