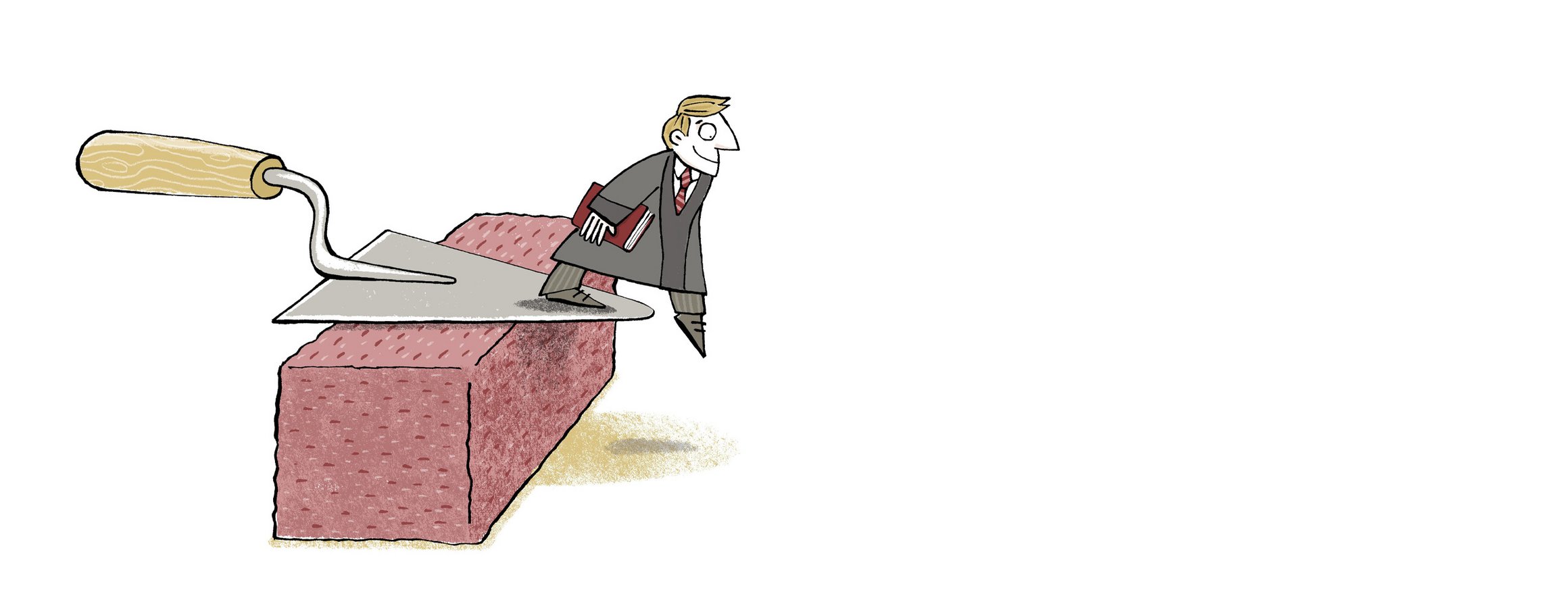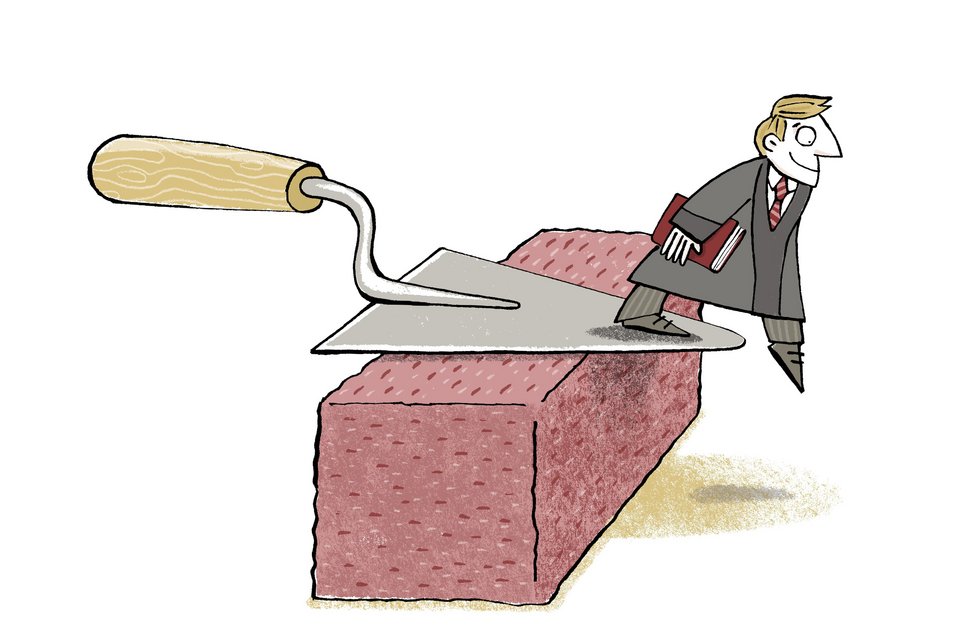Carsten, ein 45-jähriger Richter, kommt in meine Sprechstunde. Er betont, dass er keine umfängliche Therapie möchte, sondern sich eine rasche Lösung für sein Problem erhofft.
Auf meine Frage, was ihn denn belaste, erfahre ich, dass er häufig ausrastet. Er wird laut, beleidigt andere Menschen, vergreift sich im Ton. Als ich ihn bitte, Situationen zu schildern, in denen er sich so verhält, erzählt er, dass es schon ausreicht, wenn jemand nicht seiner Meinung ist. Auch das Gefühl, von seinem Gegenüber nicht…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
wenn jemand nicht seiner Meinung ist. Auch das Gefühl, von seinem Gegenüber nicht geschätzt zu werden, kann das Verhalten hervorrufen. Traurig fügt er hinzu, dass er mit diesem Verhalten bereits viele Menschen, darunter auch einen langjährigen Freund in die Flucht geschlagen habe.
Ich möchte etwas über seine Lebensumstände wissen. Seinen Beruf übe er gern aus und seine Ehe sei gut, erzählt er. Aber über seine Herkunftsfamilie spreche er nicht gern. Sein Vater und seine Brüder seien Bauarbeiter. Den Besuch des Gymnasiums habe er sich hart erkämpfen müssen. Er wurde verhöhnt, „der Herr Gymnasiast“ genannt. Am schlimmsten aber war das gewalttätige und autoritäre Verhalten des Vaters. Habe er als Kind mal gewagt zu widersprechen, habe es regelmäßig Ohrfeigen gesetzt. Von den Prügelattacken, die an der Tagesordnung waren, wolle er gar nicht sprechen.
Ich sage Carsten, dass er stolz auf sich sein könne, trotz dieser beengenden und gewalttätigen Verhältnisse seinen eigenen Weg gegangen zu sein. Er wirkt nachdenklich und meint, dass er das so noch gar nicht gesehen habe. Aber ob er auf sich stolz sein könne, wolle er nicht besprechen. Er hätte gern konkrete Tipps von mir, um seine häufigen Wutausbrüche in den Griff zu bekommen.
Ich glaube kaum, dass Carstens Verhalten allein durch bewusste Handlungsanweisungen beendet werden kann. Aber ich respektiere seinen Wunsch und mache ihm einen Vorschlag. In problematischen Situationen, wenn er sich kritisiert oder abgelehnt fühle, solle er sich auf die Signale seines Körpers konzentrieren. Gefühle zeigen sich auch körperlich, bei Ärger und Wut etwa in Form von Herzrasen, angespannter Muskulatur oder aufsteigender Hitze. Ich rate ihm, die Situation zu unterbrechen, sobald die ersten körperlichen Anzeichen auftauchen.
Am besten sei es, den Raum zu verlassen. Oder – wenn das nicht geht – aus dem Fenster zu schauen und Autos, Bäume oder Menschen in den Fokus zu nehmen. Auch die Konzentration auf ein Bild, eine Pflanze oder auf eine beruhigende innere Vorstellung kann helfen, den sich anbahnenden Ausrast-Impuls zu stoppen.
Frühe Demütigung
In der nächsten Stunde berichtet Carsten, dass mein Vorschlag funktioniert habe. Erst am Tag zuvor sei er bei einem Kollegen, der sich sehr abweisend verhalten habe, nicht explodiert. Während er mir das erzählt, wirkt er aber keineswegs zufrieden. Als ich ihn auf diesen Widerspruch anspreche, meint er, er sei schon stolz auf sich. Aber jetzt sei er ständig voller Wut, ohne Anlass und ohne sich dies konkret erklären zu können. Dazu kämen noch quälende Szenen aus der Vergangenheit, die ihm plötzlich wieder eingefallen seien. Bilder von ihm als verängstigtem Schüler, der sich gegenüber seinen Mitschülern aus den sogenannten besseren Verhältnissen nichts traut. Und Erinnerungen, wie er als angehender Student kaum wagt, das juristische Institut zu betreten.
Ich verstehe, dass Carstens Gefühl der Wut, das sein Ausrast-Verhalten immer wieder hervorruft, in seiner Kindheit, aber auch in seiner sozialen Herkunft begründet ist. Er hat noch die Wut des kleinen Jungen in sich. Es ist die Wut des Kindes auf seinen ihn demütigenden Vater, aber auch auf seine soziale Herkunft, die ihm ein Unterlegenheitsgefühl vermittelt. Damals war die Wut berechtigt, heute ist sie es nicht mehr. Carsten ist nicht mehr abhängig vom Vater und er ist beruflich angesehen.
Jetzt tritt die Wut in Situationen auf, in denen – realistisch betrachtet – kein Grund dazu besteht. Carsten ist wütend, wenn jemand anderer Meinung ist oder wenn er meint, nicht geschätzt zu werden, weil das noch tief in ihm verankerte Gefühl der früher erlebten Demütigung dadurch wieder aktualisiert wird. Wenn er wütend andere Menschen zurechtweist, stellt sich bei ihm ein befriedigendes Gefühl von Selbstbehauptung ein. Wenn er das Verhalten nicht mehr praktiziert, bleibt er auf seiner Wut sitzen.
Um die Wut des Kindes, die noch in Carsten steckt, zu besänftigen, beschäftigen wir uns mit der Frage, was denn damals geholfen hätte. Es wäre gut gewesen, meint er, wenn jemand das Verhalten des Vaters verurteilt hätte und ihn – das Kind – beschützt und liebevoll behandelt hätte. Auch die Bestätigung, dass es nicht seine Schuld sei, in der Schule und später der Universität als Arbeiterkind sich nicht zugehörig zu fühlen, hätte helfen können.
„Ich gehe meinen eigenen Weg“
Wenn man den beängstigenden inneren Bildern positive Vorstellungen entgegenstellt, können Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Unser Gehirn reagiert auf positive Vorstellungen mit der Ausschüttung von Glückshormonen, ähnlich wie auf real Erlebtes. Auf diesem Wege können Schreckensbilder verblassen. Darum bitte ich Carsten, sich so intensiv wie möglich vorzustellen, wie er als Kind vor dem Vater geschützt wird. In seiner Vorstellung taucht ein starker Mann auf, der den Vater in die Schranken weist und der dem Kind erklärt, dass es klug und gut ist. Diese Übung hat eine befreiende Wirkung. Er nimmt sich vor, sie so oft wie möglich zu praktizieren.
Wir sprechen auch darüber, dass Carsten sich heute selbst schützen und sein Leben positiv gestalten kann. Ich äußere den Gedanken, dass er das bereits in der Vergangenheit getan hat. Er ist schon lange nicht mehr der, der von seinem gewalttätigen Vater zugerichtet und in seiner Sozialklasse gefangen ist. Ich möchte von ihm wissen, wie er das konkret geschafft hat. Er meint, der Wunsch, seinen eigenen Weg zu gehen und ein starkes Durchhaltevermögen hätten ihm geholfen. Spontan fällt ihm eine Situation ein, in der er mit dem Gedanken gespielt habe, das Gymnasium zu verlassen. In der Schule Außenseiter zu sein und in der Familie ständig verhöhnt zu werden habe ihm stark zugesetzt.
Der Gedanke „Ich will meinen eigenen Weg gehen und ich schaffe das“ habe ihm geholfen, nicht aufzugeben. Ich bitte Carsten, sich in diese Erinnerung zu vertiefen und den damaligen Gedanken noch einmal in sich aufsteigen zu lassen. Die Wiederbelebung dieser Situation geht mit einem befreienden Gefühl einher. Die Erkenntnis, in der Vergangenheit bereits gut für sich gesorgt zu haben, stärkt sein Selbstbewusstsein und lässt ihn zuversichtlicher in die Zukunft schauen.
Durch die Stärkung und den Ausbau von Ressourcen, also eigene Fähigkeiten und gute Erfahrungen kann ein Fundament geschaffen werden, um unerwünschtes Verhalten einzudämmen. Als ich Carsten frage, was noch geholfen hat, sich gegenüber den widrigen Verhältnissen zu behaupten, fällt ihm ein, dass auch Romane und Erzählungen eine wichtige Rolle gespielt haben. Das Lesen habe seine Fantasie beflügelt, seinen Horizont erweitert und ihm die Kraft gegeben, aus der Enge seiner Verhältnisse herauszugehen und seinen eigenen Weg weiter zu verfolgen.
Carsten wird sich immer mehr seiner Fähigkeiten und Stärken bewusst. Mit der Steigerung seines Selbstbewusstseins gelingt es ihm dann auch zunehmend besser, auf die Schreckensbilder seiner Kindheit und Jugend mit Distanz zu schauen und sie der Vergangenheit zuzuordnen. Die Bilder haben ihre Macht über ihn verloren.
Am Ende der Therapie spürt Carsten nur noch selten den Drang auszurasten, weil er es nicht mehr nötig hat, seinen Selbstwert zu stärken, indem er andere Menschen herabsetzt. Tritt der Impuls doch mal auf, fühlt er sich ihm nicht mehr hilflos ausgeliefert. Er hat gelernt, mit ihm umzugehen.
Gabriele Eßing ist Psychologische Psychotherapeutin und arbeitet in eigener Praxis in Berlin. Sie ist Autorin des Buches Praxis der Neuropsychotherapie. Wie die Psyche das Gehirn formt (DPV 2015)