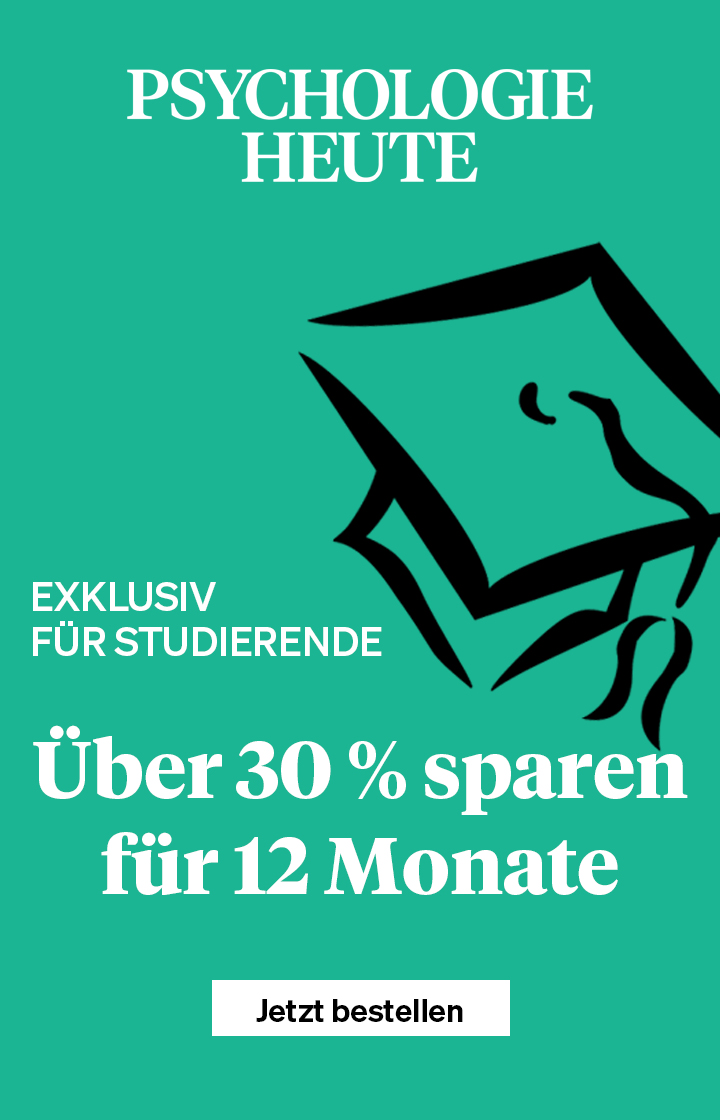Die Begegnung mit dem Tod ist das Psychodrama schlechthin. In menschlichen Kulturen ist der Umgang mit den Toten und die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit lange Zeit eine Domäne von Magie und Religion gewesen. Es überfordert die menschliche Psyche, ihr Ende hinzunehmen; wir denken uns selbst, sobald unser Stirnhirn reift, und können es eigentlich nicht fassen, dass dieses Denken ein natürliches Ende hat. Hamlet vergleicht Sein und Nichtsein mit dem Schlaf. Sein berühmter Monolog ist ein erstes Zeichen für historische Prozesse, mit denen sich Carolin Kosuch in ihrer monumentalen Arbeit Die Abschaffung des Todes. Säkularistische Ewigkeiten vom 18. bis ins 21. Jahrhundert auseinandersetzt.
Asche für die Ewigkeit
Kosuch beginnt ihre Forschungsreise in Italien mit bizarren Erfindern, die in aufklärerischer Feindschaft zum katholischen Konservatismus auf zwei Wegen nach einer nichtreligiösen Bewältigung des Todes suchen: einmal durch Konservierung der Leiche, zum anderen durch ihre Verbrennung, welche den schmutzig verwesenden Leichnam in reine, dauerhafte Asche verwandelt, die nun unverändert, unsterblich bewahrt werden kann.
Einer dieser Forscher ist Cesare Lombroso (1835–1909), der über Spiritismus mithilfe eines Mediums forschte. Er behauptete, auf diesem Weg die Existenz einer Seele nachgewiesen zu haben, die nach dem Tod weiter existiert. Lombroso reiste mit seinem Medium durch Europa und suchte in spiritistischen Sitzungen die Gelehrtenwelt zu überzeugen. Den Witz und die Bandbreite von Kosuchs Buch zeigt ihr Vergleich von Lombrosos Reisen mit ganz aktuellen Vorführungen: Den Transhumanisten aus Kalifornien, die eine Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten durch künstliche Organe befürworten, verdanken wir unter anderem eine sprechende Büste. Aus ihr können mithilfe von digitalen Schaltungen Erinnerungen und Gedanken einer einst lebenden Person abgerufen werden, der auf diesem Weg Unsterblichkeit verschafft werden soll.
Verstorbene als Schmuckstück um den Hals tragen
Kosuch hat eine Unmenge an Quellen verarbeitet, aber das Buch ist dank seines klaren Stils und gelegentlich sanfter Ironie gut lesbar. Es zeigt, dass nach der Fülle an frommen Bemühungen, den Menschen Erlösung und ewiges Leben auszumalen, aufgeklärte Säkularisten kaum weniger einfallsreich sind. Sie entwerfen bizarre Gesten wie den aus der Asche Verstorbener gepressten Diamanten, der als Schmuckstück – diamonds are forever – vererbt wird.
Es gibt mittlerweile auch (sehr teure) unruhige Friedhöfe für Unsterblichkeitssüchtige, die in flüssigem Stickstoff auf die weltliche Form des jüngsten Tages warten. Wenn es in Science-Fiction-Filmen gelingt, Dinosaurier aus in Bernstein konserviertem genetischem Material zu züchten, muss denen um ihre Unsterblichkeit nicht bange sein, die ihre DNS einem entsprechenden Unternehmen anvertrauen und parallel dazu ihre Erinnerungen, Träume und Gedanken in einer Cloud speichern, um irgendwann einen neuen Körper mit ihrer digital kristallisierten Psyche zu verbinden.
Carolin Kosuch: Die Abschaffung des Todes. Säkularistische Ewigkeiten vom 18. bis ins 21. Jahrhundert. Campus 2024, 604 S., € 56,–