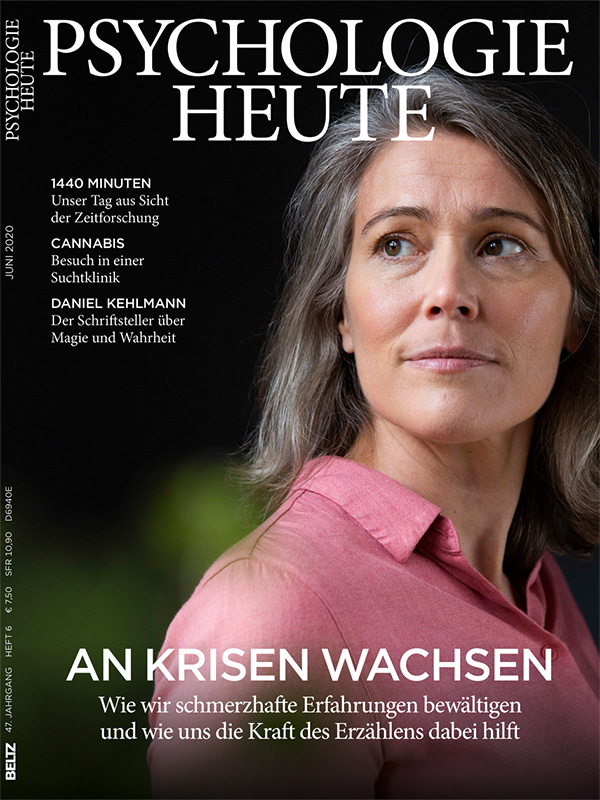Als die Prinzessin Leia ihren geliebten Luke Skywalker in einem der Star Wars-Filme küsst, ahnen beide nicht, was die Zuschauer ebenfalls erst in einer späteren Folge erfahren: Sie sind Geschwister. Im Roman Das Hotel New Hampshire von John Irving begehrt John seine Schwester Franny hartnäckig, bis sie ihren ersten und letzten Sex miteinander haben. Das sind nur einige Beispiele von vielen, denn Schriftsteller und Filmemacher hat das Thema des Inzests schon immer fasziniert. Schuld und Geheimnis, Tabu und…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
Tabu und Liebe – große Gefühle verdichten sich in der unmoralischen Beziehung.
Diesem entrückten, fast mystischen Bild vom Geschwisterinzest in Film und Literatur kann Esther Klees, Professorin für soziale Arbeit an der Internationalen Hochschule IUBH, wenig abgewinnen. „Das ist ganz weit weg von der Wirklichkeit, mit der ich mich befasse. Ich verwende deshalb auch nicht mehr gerne das Wort Inzest – anders als am Anfang meiner Forschungen vor zehn Jahren. Ich spreche von sexuellem Missbrauch oder von sexualisierter Gewalt, weil es das beim genauen Hinsehen oft ist. Es besteht ein Machtungleichgewicht zwischen beiden Sexualpartnern und wirklich einvernehmlich ist die Beziehung nicht.“
Unter den befassten Psychologen und Sozialwissenschaftlern ist tatsächlich vorwiegend von sexuellem Missbrauch zwischen Geschwistern die Rede. Ob es harmonischen Inzest gibt, stellen sie meist infrage. Oder sie blenden es in ihren Forschungen aus. Unstrittig ist nur, dass das spielerische sexuelle Erkunden des eigenen Körpers und dann manchmal auch des von Geschwistern zur kindlichen Entwicklung gehört.
Keine einheitliche Definition
„Vielleicht gibt es einvernehmliche sexuelle Beziehungen zwischen erwachsenen Geschwistern“, sagt auch David Finkelhor, der als Soziologe an der University of New Hampshire in Durham zu sexuellem Missbrauch forscht. „Spezifische Studien darüber sind mir aber nicht bekannt.“ Verkompliziert wird die Lage noch dadurch, dass es keine einheitliche wissenschaftliche Definition des Geschwisterinzests und des sexuellen Missbrauchs zwischen Geschwistern gibt.
Die Begriffe werden unterschiedlich belegt und verwendet. Wiederholte sexuelle Handlungen zwischen Minderjährigen wertet Finkelhor auf Basis seiner eigenen Forschungen aus fünfzig Jahren vorwiegend als sexuellen Missbrauch. „Diese Übergriffe sind drei- bis fünfmal häufiger als zwischen Vater und Tochter“, sagt er.
2,3 Prozent der US-Bevölkerung berichten einer Erhebung von 2014 zufolge von solchem Missbrauch während der Kindheit oder Jugend. Andere Studien sind deutlich älter: In den späten 70er Jahren fragte Finkelhor erstmals knapp 800 Studierende nach ihren sexuellen Erfahrungen in der Kindheit. 13,6 Prozent hatten solche Erlebnisse mit einem Geschwister gehabt. Ein Viertel erfolgte unter Zwang. Die Übrigen dürften vielfach vorübergehende altersgerechte Sexspiele gewesen sein. Denn 73 Prozent beschrieben diese mit dem „Berühren und Streicheln der Genitalien des Geschwisters“.
Diese Zahlen sind jedoch einsame Lichter an einem dunklen Himmel. Es fehlen weitere Erhebungen aus anderen Ländern, insbesondere aus Deutschland, und neueren Datums. Der schottische Populationsgenetiker Jim Wilson von der Universität in Edinburgh entdeckte gleichwohl jüngst bei seinen genetischen Analysen, dass es „erschreckend viele Personen gibt, die Kinder von Verwandten ersten Grades sind, also beispielsweise von Bruder und Schwester oder Vater und Tochter“. Da Betroffene, sobald sie um diese Herkunft wüssten, den Einblick in ihre Gene verwehren dürften, da Inzest kulturübergreifend verpönt ist, vermutet Wilson eine noch höhere Dunkelziffer. In Kürze will er seine Daten veröffentlichen.
Schweigen – aus Angst, Scham oder Schuld
Im Dunkeln liegt vieles zum Inzest. Opfer, Täter und die Familien schweigen aus Angst, Scham und Schuld. Auch müssen sie hierzulande davon ausgehen, dass sich das Jugendamt einschaltet, wenn sexuelle Ereignisse öffentlich würden. Die Medien berichten selten und zurückhaltend. Nur wenige Forscher beleuchten die Problematik. Noch weniger Therapeuten haben sich darauf spezialisiert. „Es besteht ein langwährendes Forschungsdefizit“, so Esther Klees. Sie begründete hierzulande die Forschung zu sexualisierter Gewalt zwischen Geschwistern, die es bis vor zehn Jahren nicht gab.
Doch wo beginnt Missbrauch? Was, wenn Geschwister sagen, dass sie sich lieben? Vereinzelt gibt es Medienberichte über Paare, die Bruder und Schwester sind, über Verwandte, die Kinder bekommen. Sexualität habe immer etwas mit Macht zu tun, meint die Evolutionspsychologin Debra Lieberman von der University of Miami. Auch bei Paaren, die keine verwandtschaftliche Beziehung zueinander haben. Forscher, die sich des Themas angenommen haben, tun sich in der Praxis schwer, das Sexualleben von Geschwistern eindeutig einzuordnen.
Nur eines scheint seit Jahrhunderten klar: Sexualität zwischen Verwandten ersten Grades ist in allen Kulturen ein Tabu. Der französische Anthropologe Claude Lévi-Strauss hielt es für eine der ältesten kulturübergreifenden Normen. In einigen Ländern steht die Liaison zwischen Geschwistern oder Elternteilen und ihren Kindern sogar unter Strafe, so auch in Deutschland. Überall ist sie geächtet und ein schwerer Verstoß gegen die gesellschaftliche Ordnung.
Davon abweichend werden Cousin-Cousine-Ehen oder die Vermählung zwischen Onkel und Nichte als sogenannte Verwandtenehen bezeichnet. Sie stellen keinen Inzest dar, sagt der Verwandteneheforscher Alan Bittles von der Murdoch University im australischen Perth. Vielmehr sind sie Bünde zwischen Verwandten dritten oder höheren Grades. Diese Partnerschaften sind weltweit in vielen Kulturräumen verbreitet: Jede zehnte Ehe ist eine Verwandtenehe.
Biologische Abwehr?
Biologen haben viel darüber sinniert, weshalb sich ein kulturübergreifendes und historisch verwurzeltes Inzesttabu ausgebildet hat. Einige vermuten, dass dem eine biologische sexuelle Aversion zwischen Verwandten ersten Grades zugrunde liegt. Denn auch Tiere wie Löwen, Wespen und Gibbons paaren sich nicht mit Mitgliedern der Kernfamilie. Diese Abneigung habe sich evolutionsbiologisch über die natürliche Selektion ausgeprägt, glauben einige.
Da Bruder und Schwester zur Hälfte das gleiche Erbmaterial tragen, sei das Risiko für genetisch bedingte Krankheiten bei ihrem Nachwuchs deutlich erhöht. Viele Erbleiden brechen nämlich nur dann aus, wenn zwei identische Erbmerkmale – eben von Bruder und Schwester – zusammentreffen. Eine tschechische Studie von 1971 bezifferte die Rate an angeborenen Fehlbildungen und frühem Kindstod beim Nachwuchs von Verwandten ersten Grades auf 42 Prozent, wohingegen es sonst 7 Prozent sind. Bei Verwandten dritten Grades ist diese Gefahr immer noch messbar erhöht, aber nurmehr vier Prozent über dem Durchschnitt.
Angeboren scheint eine sexuelle Aversion zwischen Geschwistern aber nicht zu sein, berichtet die Evolutionspsychologin Debra Lieberman. Bruder und Schwester, die sich als Erwachsene das erste Mal begegneten, fänden sich sogar etwas attraktiver als einen Nichtverwandten oder eine Nichtverwandte. Lieberman glaubt, dass sie sich anziehen, weil sie ähnliche Vorlieben, Einstellungen und Verhaltensweisen haben, die wiederum aus der genetischen Nähe resultieren. „So wie wir schnell gut Freund mit jemandem sind, der dieselbe Musik, dieselben Hobbys, dieselbe Tagesstruktur mag“, sagt sie.
Sexuelle Abneigung durch Erfahrung
Die sexuelle Abneigung zwischen Geschwistern entstehe durch Schlüsselerlebnisse anderer Art, glaubt Lieberman. Sie wäre demnach ein erworbenes Verhalten. Ihrer Meinung nach finden wir Gleichaltrige dann sexuell abstoßend, wenn wir zusammen mit ihnen aufwachsen und die gleiche unmittelbare Bezugsperson teilen. In diese Richtung argumentierte schon der finnische Soziologe Edvard Westermarck im ausgehenden 19. Jahrhundert.
Einen ersten Hinweis zugunsten der Westermarck-These erbrachten die israelischen Kibbuze. Das sind Gemeinschaftsorte, in denen gleichaltrige Kinder schon als Säuglinge und dann gemeinsam bis zu ihrem Militärdienst großgezogen wurden. Frauen und Männer, die ihre ersten zwanzig Jahre so miteinander geteilt hatten, heirateten einander später selten, ergründeten Forscher in den 1960ern und nochmals in den 1980ern.
Lieberman glaubt, dass es spezifische Erfahrungen gibt, die zur sexuellen Abneigung zwischen Geschwistern führen: etwa wenn ältere Kinder sehen, wie die Mutter ein jüngeres Geschwisterkind stillt und trägt. Damit wächst die Gewissheit, dass dieses Kind ein Geschwisterkind ist. Es wird als Geschlechtspartner unattraktiv. Verhaltensregeln wie „Teile die Brezel doch mit deinem Bruder“ tragen zusätzlich dazu bei, dass diese Person brüderlich behandelt und kein attraktiver Geschlechtspartner wird.
Patchwork-Familien als Inzesthäufer?
„Wenn diese Schlüsselinformationen des gemeinsamen Aufwachsens durch die Mutter fehlen, ist die sexuelle Abneigung gering. Diese Männer und Frauen sind gefährdet, sich später zu verlieben“, glaubt Lieberman. Darauf deuten jene anekdotischen Fälle hin, in denen Bruder und Schwester einander erst als Erwachsene begegneten und starke Gefühle füreinander entwickelten.
In Zeiten, in denen Patchworkfamilien zunehmen und in denen immer mehr Kinder einen leiblichen Elternteil aufgrund von Samen- und Eizellspenden nicht kennen, könnte sich Geschwisterinzest deshalb häufen, glaubt die Evolutionsbiologin.
Natürlicher Inzesttrieb?
Obwohl Inzest ein universelles Tabu ist, kommt er doch in wahrscheinlich allen Gesellschaften vor. Schon der Psychoanalytiker Sigmund Freud versuchte diese Widersprüchlichkeit in mehreren Abhandlungen in seinem Werk Totem und Tabu von 1913 zu erklären. Er kam zu einem den Vermutungen der Evolutionsbiologen zuwiderlaufenden Schluss: Danach hat jeder Mensch einen natürlichen Inzesttrieb.
Dieser begünstige jedoch die Rivalität, besonders zwischen Söhnen und dem Vater – bis hin zur Gefahr des Vatermordes durch die Brüder. Erst infolge der zivilisatorischen Errungenschaft der Kultur sei der inzestuöse Trieb mit dem Inzesttabu in die Schranken gewiesen worden. Menschen, die der ihnen innewohnenden inzestuösen Neigung nachgäben, versetzten sich zurück in den Naturzustand, gäben sich ganz der Triebbefriedigung hin und rebellierten gegen die gesellschaftliche Ordnung.
Folgt man Freud, wäre das Tabu ein Sieg der Kultur über die Natur des Menschen.
In der modernen Literatur ist dieses Deutungskonzept allerdings kaum präsent. David Finkelhor vertritt jedoch eine moderne Lesart davon: „Die sexuelle Aversion zwischen Geschwistern ist schwach“, sagt er. Aber der unmittelbar zerstörerische Effekt auf Familien und Gesellschaften habe dazu geführt, dass Inzest zur Unmoral geworden sei. Wären Schwestern und Brüder, sogar Mutter und Vater potenzielle legitime Geschlechtspartner, würde das den Zusammenhalt in der Kernfamilie gefährden. „Eifersucht und Konkurrenz schlichen sich in die Beziehungen von Müttern und Töchtern und von Vätern und Söhnen. Das würde die ernährende und beschützende Rolle, die Eltern gegenüber Kindern haben, aber auch Geschwister untereinander, aushöhlen.“ Die Institution der Familie würde implodieren.
Trost in schwierigen Familien
Der Frage, warum Inzest in geringem Ausmaß dennoch in allen Kulturen fortbesteht, hatten sich auch die Psychologen Stephen Bank und Michael Kahn in den achtziger Jahren genähert. Sie vertraten die Auffassung, dass Geschwister ihr Bedürfnis nach emotionaler Nähe in einem einvernehmlichen Inzest befriedigen. Die tabuisierte Beziehung sei eine Art „Liebesnest in gestörten Familiensystemen“, in denen die Kinder diese Wärme nicht erführen. Mit dem bilateralen Geheimbund gewännen die Geschwister zudem einen Machtzuwachs gegenüber den ahnungslosen Eltern.
Problematische Familienverhältnisse sehen die befassten Psychologen und Sozialwissenschaftler auch als eine Ursache von sexuellen Übergriffen zwischen Geschwistern. „Von ,Inzest‘ sprechen wir nicht gerne, auch weil dieser den seelischen Schaden ausblendet“, sagt der Psychologe John Caffaro von der California School of Professional Psychology in Los Angeles. Immer hätten die Familien, in denen Geschwister sexuelle Kontakte entwickeln, Probleme, darzulegen, dass dies keine Zwangshandlungen seien.
Manipulation und massive Dominanz kämen immer vor. In einer Befragung in den achtziger Jahren stellte Finkelhor bereits fest, dass 70 Prozent die sexuellen Ereignisse als erzwungen erinnerten. Und in einer weiteren Befragung fiel der Psychologin Marjorie Hardy vom Eckerd College in Florida an den Antworten von 207 Studenten auf, dass zwar 80 Prozent die sexuellen Kontakte als einvernehmlich ansahen, aber dennoch ein Drittel die Erlebnisse später als Missbrauch bewertete.
Problemfokussierte Sicht
Sexuelle Übergriffe kämen vor allem in Familien mit Vernachlässigung, Gewalt und starker Sexualisierung vor. Psychologen und Soziologen vertreten damit gegenwärtig eine problemfokussierte Sicht auf den Geschwisterinzest.
73 Erwachsene, die als Kinder Opfer von Gewalt oder sexuellem Missbrauch seitens eines Geschwisterkinds geworden waren, interviewte Caffaro, um die Verhältnisse zu Hause auszuleuchten. Obwohl die Fälle sehr heterogen waren und sich in ihren Details unterschieden, fielen ihm doch Gemeinsamkeiten auf: „Die Eltern kümmerten sich wenig oder waren emotional abwesend. Die Kinder bekamen wenig Zuwendung und wurden in ihren Bedürfnissen missachtet.“
Schon frühere Arbeiten hatten herausgeschält, dass Kinder einer psychisch kranken oder aus anderen Gründen abwesenden Mutter – auch im Fall ihres Todes – ein besonders hohes Risiko für sexuellen Missbrauch durch Geschwister trugen. Nach dem Vater hatten die Forscher damals nicht gefragt. Familien, in denen Geschwistermissbrauch auftritt, seien auch sonst von Gewalt geprägt, analysiert Caffaro und steht damit in einer Linie mit Finkelhor. Die Täter wurden oft vorher geschlagen oder selbst schon sexuell missbraucht. Auch Alkoholmissbrauch komme vor, arbeitet er heraus.
Machtspiele großer Geschwister
Dysfunktionale Familien – in denen Probleme auf dem Rücken der Familienmitglieder ausgetragen werden – begünstigen, dass ein älteres Geschwisterkind das jüngere missbraucht. Die übergriffigen Jungen waren im Schnitt weniger als 9 Jahre alt, die Opfer, meist die Mädchen, noch jünger, ergab Klees Erhebung. Sexuelle Übergriffe, die von Schwestern ausgehen, kämen vor, seien aber bis dato nahezu unerforscht, sagt sie. Meist übt das ältere Kind Macht und Dominanz aus, indem es das andere zu sexuellen Handlungen zwingt oder bewegt, auf die es sich freiwillig nicht einlassen würde.
Besonders gefährdet sind Familien mit mehr als drei Kindern, weil die Eltern dann oft die Details im Zusammenleben nicht mehr überblicken. Es gebe Fälle, in denen zwei Kinder ein Zimmer und ein Bett teilten und sich die Übergriffe nachts so der Kontrolle der Eltern entzögen, berichtet Finkelhor. „Der Missbrauch geht nicht selten über viele Jahre, auch weil Geschwister so viel Zeit miteinander verbringen.“ Er ende meist nur deshalb, weil das tätliche Geschwisterkind die Familie verlässt.
Zwar kämen Psychologen und Sozialwissenschaftlern zufolge auch harmlose sexuelle Erkundungen vor. Nicht selten aber entwickelten sich die Missbrauchsbeziehungen aus spielerischer Neugier, berichtet Klees. Aber die Abgrenzung sei schwierig. Sie hat mit 13 übergriffigen Jugendlichen hierzulande gesprochen, die insgesamt 25 Geschwisteropfer und weitere außerfamiliäre Opfer hatten. Viele konsumierten harte Pornografie; die Eltern kümmerten sich kaum, betont sie.
Dominanz statt Lust
Die Beziehungen liefen im Schnitt vier Jahre lang mit Sexualkontakten mehrmals pro Woche. Die Täter gingen Klees Analysen zufolge strategisch vor: Sie belohnten das passive Geschwisterkind für seine Folgsamkeit etwa mit Süßigkeiten oder hielten es fest, wenn es sich nicht füge. Sie loteten aus, ob es bei den Eltern petze. Um das Geheimnis zu bewahren, flößten sie ihm Angst ein und drohten. Sobald sich das Opfer zu entziehen versuche oder wehre, wende der dominante Geschwisterpart nicht selten Gewalt an, auch aus Angst, die sexuellen Handlungen könnten nun gegenüber den Eltern auffliegen.
Klees erteilt der Theorie von Freud eine klare Absage, wonach der inzestuöse Trieb Lustbefriedigung verschaffe: „Es geht gar nicht primär um das Ausleben eines Sexualtriebs, sondern um Dominanz. , Danach habe ich mich stark gefühlt‘, habe ich oft in den Interviews gehört“, sagt Klees.
Keine harmlosen Doktorspiele
Lange Zeit galt die Sexualität unter Geschwistern als harmlos. Nun ist das Areal des unbedenklichen Sexuallebens zwischen Geschwistern klein geworden. „Sexuelle Erkundungen stürzen niemanden in ein emotionales Chaos“, meint Caffaro dazu. „Aber sexuelle Übergriffe – selbst wenn es nur die leiseste Unfreiwilligkeit gibt – bringen massive Probleme mit sich.“ Missbrauchte Kinder würden später als Erwachsene viermal so häufig wie andere wegen psychischer Krankheiten behandelt. Ob der Übergriff von einem Geschwister oder einem Erwachsenen ausging, ist für die Folgen dabei unerheblich, fand eine kanadische Studie heraus.
„Das Hauptproblem ist, dass die Eltern es als harmlose Doktorspiele abtun“, sagt Klees. „Man muss genau hinschauen, aber wenn eine Person mehr oder minder repressiv und manipulativ zu diesen Handlungen gebracht wird, kann das schwerwiegende Folgen haben.“ Ihr sei es deshalb ein Anliegen, Lehrer, Erzieher und Eltern zu informieren und das Thema aus der Heimlichkeit ins Bewusstsein zu holen. „Das Allerwichtigste ist, das Schweigen über den Inzest zu brechen. Nicht im Film, sondern ganz real.“
Zum Weiterlesen
John V. Caffaro, Allison Conn-Caffaro: Treating sibling abuse families. Aggression and Violent Behavior, 10/5, 2005, 604–623
Esther Klees, Torsten Kettritz (Hg.): Sexualisierte Gewalt durch Geschwister. Pabst Science Publishers, Lengerich 2018
Debra Lieberman, Adam Smith: It’s all relative: Sexual aversions and moral judgments regarding sex among siblings. Current Directions in Psychological Science, 21/4, 2012, 243–247
Literatur
Norbert Bischof: Die biologischen Grundlagen des Inzesttabus, in: Bericht über den 27. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Kiel 1970. Hogrefe, Göttingen, 1973, 115 – 142
Hans-Jörg Albrecht: Inzest und Strafrecht. Ein rechtsvergleichendes und empirisches Gutachten
John V. Caffaro, Allison Conn-Caffaro: Treating sibling abuse families. Aggression and violent behavior, 10/5, 2005, 604-623.
Treating adult survivors
Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral judgment. Psychological review, 108(4), 814.
Debra Lieberman, Adam Smith: It’s all relative: Sexual aversions and moral judgments regarding sex among siblings. Current Directions in Psychological Science, 21/4, 2012, 243-247.
Esther Klees: Geschwisterinzest – Einblicke in den internationalen Forschungsstand. In: Kindesmisshandlung und – vernachlässigung. Deutsche Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und – vernachlässigung (DGgKV) e.V. Interdisziplinäre Fachzeitschrift, Jahrgang 9, Heft 2, 2006, S. 62-80.
Esther Klees, Torsten Kettritz: Sexualisierte Gewalt durch Geschwister. Pabst Science Publishers, Lengerich 2018