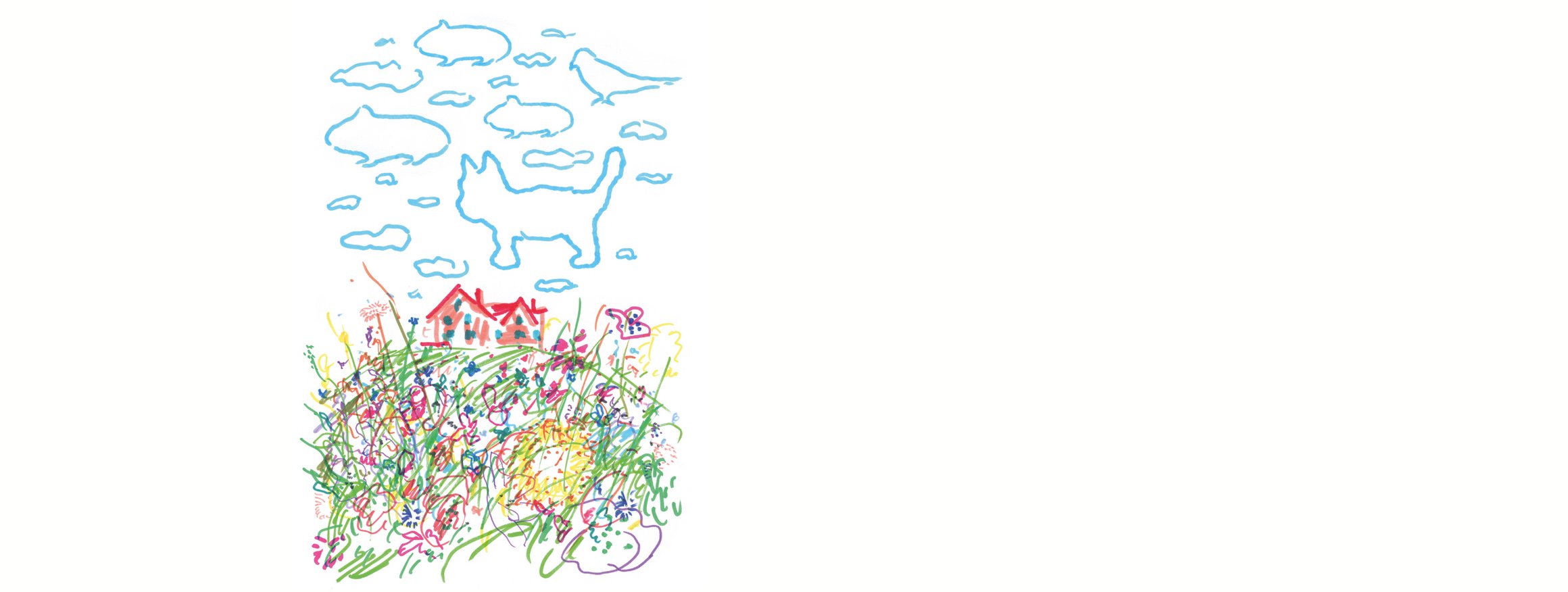Als ich zehn Jahre alt war, kauften meine Eltern einen frisch geworfenen Cockerspaniel. Vermutlich geschah das wegen meiner Schwester. Der Spaniel kotzte alles voll, auch alle anderen Körperöffnungen waren sendungsbewusst, schon am zweiten Tag wurde er in einem gut putzbaren Kellerraum inhaftiert und beobachtet, nach etwa fünf Tagen wurde er an die Züchterin zurückgegeben, der arme Hund.
Hatte er einen Namen in diesen Tagen? Ich vermute nicht.
Wir besaßen ein Meerschweinchen, das lebte immerhin ganz gut bei…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
vermute nicht.
Wir besaßen ein Meerschweinchen, das lebte immerhin ganz gut bei uns. Nein, das muss ich revidieren. Das Meerschweinchen, das bei uns gut lebte, war das dritte. An den ersten beiden, die nur wenige Wochen bzw. Tage bei uns waren, wurde noch geübt. Wir wohnten an einem Bachlauf. Das erste Meerschwein ließ meine Schwester, weil sie es so süß fand und der Freiheitsdrang damals auch bei jungen hessischen Mädchen unbegrenzt war, aus dem Käfig frei.
Mein Vater hatte jenes erste Meerschwein mit Käfig in den Garten gebracht, damit es etwas von der Sonne, dem Rasen, überhaupt unserem Garten habe. Schwester hob den Käfig hoch, das Tier rannte sofort Richtung Bachufer, wurde dann stundenlang gesucht, aber nie mehr gefunden.
Dem zweiten Meerschwein wurde der Käfig nicht gehoben. So konnte es nicht entkommen. Der Käfig wurde aber diesmal oben aufgeklappt. Und stand unter einem Apfelbaum, der gerade trug, es ging Richtung Oktober. Jenes Meerschwein, auch es blieb in der kurzen Zeit seines Lebens vermutlich namenlos, wurde also erschlagen von einem Bohnapfel.
Eine ganz dunkle Erinnerung sagt mir, dass eines dieser Meerschweinchen doch einen Namen bekommen hatte: Whisky.
Die beste Seele in der Familie
Das dritte Meerschweinchen lebte ultralang. Es schöpfte seine acht Jahre Lebenserwartung geradezu dekadent aus, es wurde zehn. Wir hätten das anfänglich aber nicht vermutet, denn es verhielt sich ungewöhnlich: Es trank nicht. Gar nichts. Jeder Versuch mit der Meerschweinchenflasche war sinnlos. Charlie war sein Name. Charlie ging nicht an die Flasche. Wir rechneten in den ersten Tagen wieder mit einer Katastrophe, nämlich mit Verdurstung. Es zeigte sich aber, dass durch feuchten Salat, also durch wirklich sehr feuchten Salat Charlie (vielleicht war er ein Gourmet) alles bekam, was er brauchte. Charlie trank zeitlebens keinen Schluck.
Das zweite Haustier, das klappte (wir hatten inzwischen auch einen Wellensittich hingerichtet), war wiederum ein Hund, diesmal kein Spaniel, sondern scheinbar defensiver: ein Yorkshireterrier. Er war eine Sie und hieß hochoffiziell Elisabeth von Kastelhoeve. Adeliger als wir alle. Mit Stammbaum bis Pipapo.
Diesem Tier, obgleich gezüchtet, um in englischen Schlössern und Gartenanlagen auf unterirdische Jagd gegen allerlei auszurücken, konnte kein Mensch die Zuneigung versagen. Es war sicherlich die beste Seele, die in unserer Familie, mich eingeschlossen, jemals lebte.
Sissi, so ihr Rufname, wurde dennoch kritisiert. Vor allem für die Ursünde der Onanie. Sie trieb es vor allem mit den Stoffkissen auf unserer Wohnzimmercouch.
Sie muss dafür oft Schelte eingesteckt und von daher ein schlechtes Menschengewissen bekommen haben. Manchmal, da war ich dreizehn, vierzehn und verstand bereits die ganze Geschichte aus eigener Hand, betrat ich das Wohnzimmer, und Sissi befand sich auf einem der Kissen und juckelte herum. Und was geschah mit dem armen Wesen?
Der Hund mit schlechtem Gewissen
Es blickte schuldbewusst zur Tür, auf mich. Als sei ich ein Züchtiger, als sei ich das materialisierte Über-Ich. Die Bewegungen auf dem Kissen verloren den Rhythmus, während mich das liebe, offenbar schon öfter dafür geschundene Wesen anschaute. Sissi hob das eine Bein, um langsam, fast wie ein Westernheld vom Reitpferd zu steigen, ließ vom Kissen ab, stand kurz daneben, schaute mich treuherzig an: „Nichts ist eben geschehen, nichts“, dann schlich sie sich davon – und ich fühlte mich tausendmal schuldiger als sie und fragte mich, was meine Eltern mit diesem Hund gemacht haben müssen, um ihn so zu vermenschen mit seinem schlechten Gewissen.
Sissi starb auch exorbitant alt. Sie wurde zwanzig. Ob sie als alte Dame noch schuldbeladen onanierte, kann ich nicht sagen. Ich war kaum noch in meinem Elternhaus. Einen Tag vor ihrem Hunde-Ende soll sie noch einmal ums Haus und durch den kompletten Garten gelaufen sein, fast völlig erblindet. Sie wurde nicht totgespritzt, sondern entleerte sich final in den Armen der Besitzerin, wurde mir erzählt.
Aber zurück zur jungen Sissi und zu Charlie, unserem nichttrinkenden Meerschwein. Sie vermittelten mir einen Begriff von Bukolik, als ich diesen Begriff noch nie gehört hatte. Charlie konnte tatsächlich im Garten ohne Käfig funktionieren, zumindest auf der flussabgewandten Seite des Hauses. Er haute nicht ab. Niemand sah ihn je rennen. Sissi interessierte sich dabei stets für ihn. Man konnte die beiden sogar ein bisschen allein miteinander lassen, Sissi schien auf ihn aufzupassen.
Das langsame Ende der Familie
Wie Charlie verdaute, konnten wir nicht bewerten. Zumindest fraß Sissi („fressen“ ist für die adelige Dame hier jetzt doch angebracht) allzu gern das Ausgedaute von Charlie, dem Meerschwein. Selbst im Hausflur, wenn er dort mal Freigang hatte, kam Sissi wie ein Staubsauger hinterher. So können sie sein, die Vorlieben. Sonst aß sie immer nur in Butter gebratene Kalbsleber.
Sissis Tod habe ich nicht miterlebt, ich war in Frankfurt, Studium. Meine Mutter rief mich an, erschüttert, aber schon gefasst, und erzählte mir von Sissis letzten zwei Tagen. Charlie war sicherlich zehn Jahre vorher gestorben. Bei ihm war es ein zähes Ringen mit dem Tod gewesen, eine längere Kaum-mehr-Aufnahme von Nahrung. Mein älterer Bruder und ich hatten ihn noch wochenlang mit dem Finger gefüttert, mit kleinstgeschnittenem, tropfnassem Kopfsalat.
Es waren Familienmitglieder. Der Tod meiner Großmutter und jener Sissis fallen zeitlich sogar zusammen. Beider Tod bedeutete eine Zeitenwende. Es war der Beginn von etwas, was seitdem zu beginnen nicht mehr aufgehört hat, wie es Thomas Mann mal sagte. Dem langsamen Ende der Familie.
Was je aus dem Cockerspaniel wurde, hatte damals schnell niemanden mehr interessiert. Zwei Meerschweine haben wir gehimmelt. Den Vogel ebenfalls. Ich habe später nie mehr ein Haustier gehabt. Vielleicht war meine Achtung vor Sissi, Charlie und den anderen zu groß.
Andreas Maier ist vielfach ausgezeichneter Schriftsteller. Auf elf Bände hat er seinen Zyklus „Ortsumgehung“ angelegt, 2021 ist der achte Band mit dem Titel Die Städte erschienen (Suhrkamp). In Psychologie Heute erdichtet er an dieser Stelle jeden Monat das Blaue vom Himmel