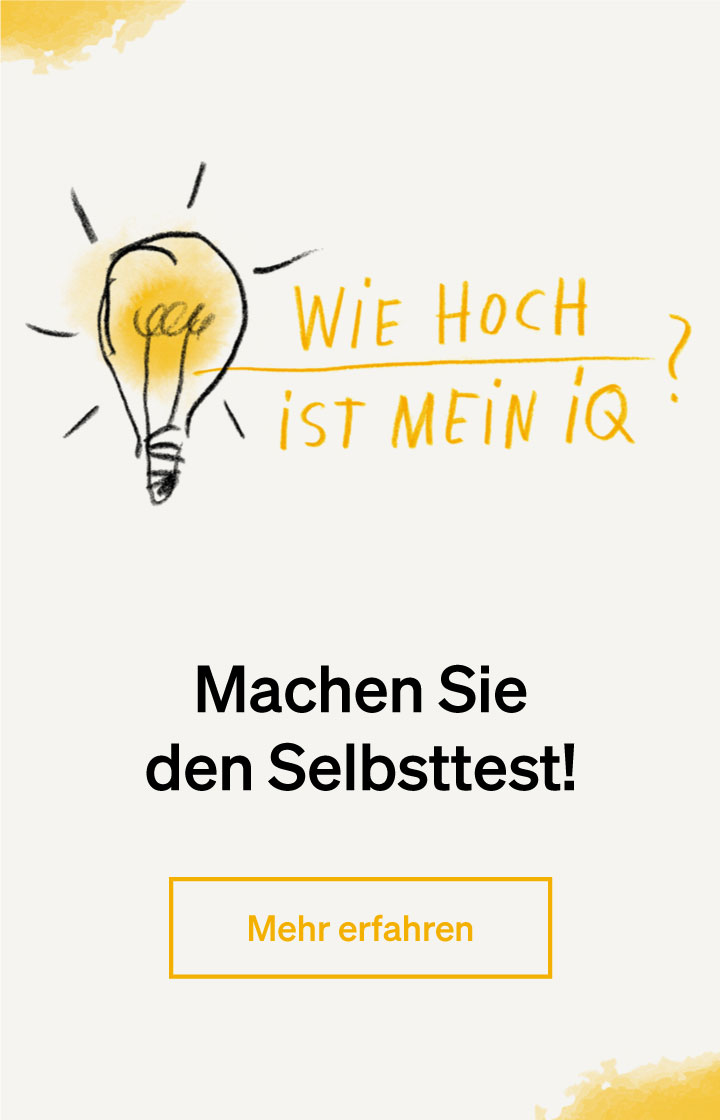In meinem Alltag als Hochschuldozent, Kunstwissenschaftler, Journalist und Musiker habe ich wenig Anlass, mich von etwas substanziell stören zu lassen. Grund dafür ist mein innerer Relativismus. Die Tatsache, dass ich mein Geld mit etwas verdiene, das mich fasziniert und überwiegend im Einklang mit meinen Werten steht, erfüllt mich mit so viel Dankbarkeit, dass mir viele potenzielle Ärgernisse wie Petitessen vorkommen.
Überall wilde Thesen
Zwar begegnen mir immer wieder Thesen, die ich für abstrus halte, zuvorderst in den sozialen Netzwerken, wo Menschen ungefiltert identitätsgruppenkonforme Litaneien absondern, statt miteinander in die Offenheit des Denkens zu finden. Doch aus der Ruhe bringt mich das längst nicht mehr. Na ja, fast nicht. Eine These schafft es, meine Contenance zu durchbrechen. Und sie hat ausgerechnet mit Relativismus zu tun.
Ob bei Podiumsdiskussionen, in TV-Sendungen, im Ganggespräch an der Universität oder in Peer-Review-Kommentaren – häufig werde ich mit Thesen konfrontiert, die sich als vulgarisierte Formen der sogenannten Standpunkttheorie beschreiben lassen. Unter dem Kollektivsingular „Standpunkttheorie“ fasst man Ansätze, die die Abhängigkeit einer Erkenntnis von der sozialen Position der Erkennenden und insbesondere der sie prägenden Machtverhältnisse betonen. Dagegen ist zunächst einmal wenig einzuwenden.
Totschlagargument in Diskussionen
Ich selbst bin Anhänger des polnischen Immunologen Ludwik Fleck, der 1935 mit seinem Buch Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache zeigte, wie „Denkstile“ und „Denkkollektive“ die Entstehung neuen Wissens prägen, fördern oder behindern. Fakten fallen nicht vom Himmel. Sie werden in konkreten sozialen Zusammenhängen gemacht. Darauf deutet bereits der lateinische Wortstamm factum, das „Gemachte“, hin. Das macht Fakten nicht irreal, sondern umso realer.
Die subtilen Analysen Flecks werden heute überschattet von der Standpunkttheorie als vulgärem Machtinstrument. Sucht man in einer Diskussion ein Totschlagargument, so behauptet man einfach, das, was das Gegenüber sage, sei doch nur ein Versuch, die eigene Machtposition zu sichern und die gesellschaftlichen Verhältnisse zu zementieren.
Streben nach Machtpositionen
Umgekehrt funktioniert es auch: Hinter der Aussage des Gegenübers stecke doch nichts anderes als das Streben danach, die eigene Machtposition zu verbessern und die bestehende Ordnung zu stürzen! Logik, Wissen, argumentative Stringenz, empirische Fundierung, all das wird zu Feigenblättern des Ringens um Macht erklärt.
Praktischerweise kann niemand das Gegenteil beweisen, denn durch das Individuum sprechen angeblich die für es selbst opaken „Strukturen“. Ideen, Thesen, Theorien ohne Grenzen sind gefährlich. Eine Grenze aber kennt die vulgarisierte Standpunkttheorie: sich selbst. Nähmen ihre Apostel sie wirklich ernst, so müssten sie sich fragen: Von welchem Standpunkt aus könnte die Standpunkttheorie denn standpunkteübergreifende, also universelle Gültigkeit beanspruchen? Die Antwort dürfte den Standpunktabsolutisten nicht gefallen.
Jörg Scheller ist Kunstwissenschaftler, Hochschuldozent, Journalist und Musiker. Er lebt in der Schweiz.