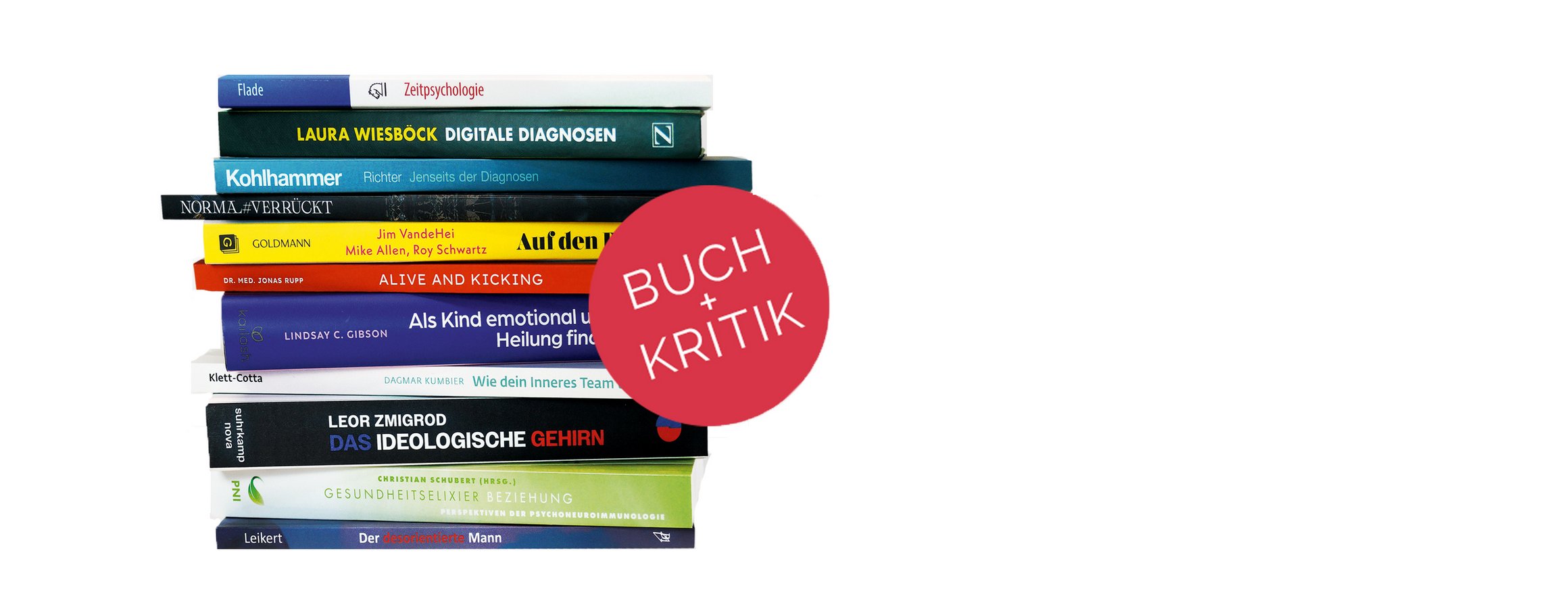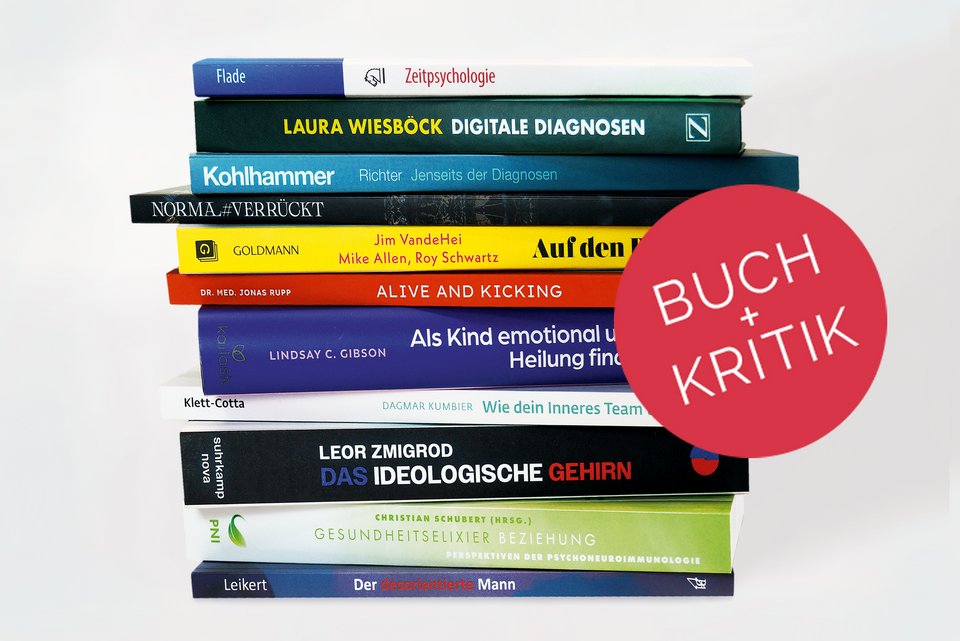Die Psychologie hat in den letzten Jahrzehnten vieles erreicht: Psychische Probleme werden offener thematisiert – niemand sollte sich für sein Leid schämen müssen. Doch was könnte an dieser neuen Offenheit falsch sein? Eine ganze Menge, meinen Holger Richter und Laura Wiesböck, die beide in der heutigen Art, Diagnosen zu diskutieren, ein Problem sehen. Sie kritisieren in ihren Büchern, dass selbstgestellte Diagnosen oft in Sackgassen führen – im Leben und in der Therapie. Dieser „Diagnose-Enthusiasmus“ – so die Soziologin Laura Wiesböck – sei Ausdruck des gesellschaftlichen Klimas. Dabei unterscheiden sich die Blickwinkel der Autoren deutlich: Während Psychotherapeut Holger Richter in Jenseits der Diagnosen seine Kritik auf eine „woke Gesellschaft“ fokussiert, sieht Laura Wiesböck in ihrem Buch Digitale Diagnosen die Ursache in einer neoliberalen Leistungs- und Optimierungskultur. Doch der Reihe nach.
Inflationäre Diagnose in sozialen Medien
Wiesböck analysiert den Umgang mit psychiatrischen Diagnosen in den sozialen Medien. Sie beobachtet, wie Kategorien wie ADHS oder Trauma inflationär und oft falsch verwendet werden. Selbsternannte Experten und Expertinnen verbreiten Informationen, die häufig banal bis falsch seien. Hinter dieser Entwicklung sieht Wiesböck den Wunsch nach Entlastung: Die Selbstdiagnose einer psychischen Störung ermögliche es, Unzumutbares abzulehnen oder das eigene Fehlverhalten zu rechtfertigen. Dadurch würden psychische Leiden häufig instrumentalisiert, um Ansprüche durchzusetzen – etwa wenn Rücksicht auf eine Krankheit eingefordert werde.
Auf den ersten Blick wirkt Wiesböcks Buch wie eine Kritik an jungen Leuten, die „menschliche und klinische Leidenszustände“ vermengen, um Konflikte zu umgehen. Doch ihre Analyse reicht tiefer: Sie fragt, warum diese Form der Selbstbehauptung so populär ist, und macht dafür die neoliberale Gesellschaft verantwortlich. In einer Welt voller Leistungsdruck und Selbstoptimierungszwang werde selbst Erholung problematisch – es sei denn, sie diene der „Heilung“. So werde etwa fast jede Form der „Leistungsunfähigkeit“ erst durch eine Diagnose legitimiert. Gleichzeitig kritisiert Wiesböck, wie Traumata – ob echte oder leichtfertig selbst diagnostizierte – fast zwingend mit einer Pflicht zur persönlichen Weiterentwicklung verknüpft würden. Der „Selbststilisierung als Wunde“ folge die Erwartung, negative Erfahrungen therapeutisch aufzuarbeiten – letztlich zur Selbstverbesserung.
Bei der Problembewältigung auf sich allein gestellt
Laura Wiesböck analysiert, wie die Last der Problembewältigung zunehmend vom Staat auf das Individuum verschoben werde: In einer entpolitisierten Gesellschaft sähen sich Einzelne zunehmend allein für ihre psychische Gesundheit verantwortlich. Sie plädiert dafür, mehr Raum für Verletzlichkeit und Trost zu schaffen. Wenn Menschen diesen hätten, müssten sie ihre Schwächen und Bedürfnisse nicht so sehr durch den Verweis auf psychische Krankheiten rechtfertigen.
Während Wiesböck den Blick auf Laien richtet, nimmt Holger Richter, Psychotherapeut, Gutachter und Supervisor, in Jenseits der Diagnosen die eigene Profession ins Visier. Seine Kritik richtet sich an Kolleginnen und Kollegen, die sich zu stark auf klassische Diagnostik stützten und dabei das größere Bild aus dem Blick verlören: So erschwere heutzutage etwa die Auflösung von Geschlechterrollen die Partnerwahl und fördere psychische Probleme. Dies bilde sich in den vergebenen Diagnosen aber nicht ab. Anliegen wie Gleichheit der Geschlechter und Rechte etwa von Transsexuellen bestimmten die Weltsicht und dürften nicht hinterfragt werden. Holger Richter will stattdessen neue Wege einschlagen: Er nutzt Fallgeschichten als Grundlage für sogenannte „Plots“ – narrative Kurzbeschreibungen, die das Leid der Patientinnen und Patienten jenseits üblicher Diagnoseschemata erfassen sollen.
Gesellschaftlich umgreifender Narzissmus
Richters Ansatz vermittelt seine Kritik vorwiegend durch Fallerzählungen. Das ist passagenweise meisterhaft erzählt und einfühlsam. Dabei hinterlassen die geschilderten Fälle – die einer nach dem anderen in einem Misserfolg enden – mitunter den Eindruck, Psychotherapie sei in ihrer aktuellen Form meist sinnlos. Als zentral sieht er einen gesellschaftlich umgreifenden Narzissmus, der nicht nur Patienten erfasse, sondern auch die Psychotherapeuten und -therapeutinnen. Aus dem Gedanken heraus, selbst der oder die Einzige zu sein, die die Situation im Sinne der Patientin lösen könne, unternähmen sie immer wieder neue Therapieversuche, auch dann wenn viele Vorbehandlungen bereits gescheitert seien.
Beide Bücher eröffnen wichtige Perspektiven auf den Umgang mit psychischen Diagnosen. Während Wiesböck eine neoliberale Leistungsgesellschaft kritisiert, in der Diagnosen zur Legitimation von Schwächen und Bedürfnissen genutzt werden, hinterfragt Richter die Praxis der eigenen Zunft.
Die Diskussion um den Umgang mit psychischen Diagnosen ist eröffnet. Beide Bücher liefern hierzu Denkanstöße: Wiesböck mit ihrem soziologischen Blick, Richter mit einem selbstkritischen Blick auf die Psychotherapie, die sich aus seiner Sicht zu sehr dem Zeitgeist angeschlossen hat.
Thorsten Padberg ist Diplompsychologe und arbeitet als Psychologischer Psychotherapeut und Supervisor in eigener Praxis in Berlin. Zuletzt erschien von ihm das Buch Die Depressions-Falle. Wie wir Menschen für krank erklären, statt ihnen zu helfen (S.Fischer 2021)
Laura Wiesböck: Digitale Diagnosen. Psychische Gesundheit als Social-Media-Trend. Paul Zsolnay 2025, 176 S., € 22,–
Holger Richter: Jenseits der Diagnosen. Fallstricke der Psychotherapie. Kohlhammer 2024, 265 S., € 39,–