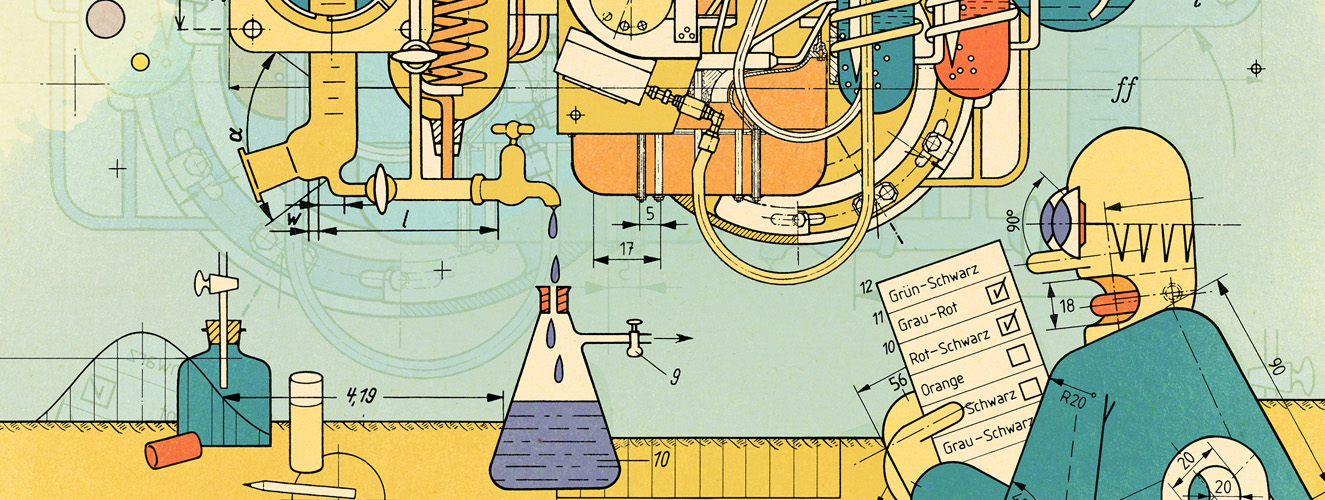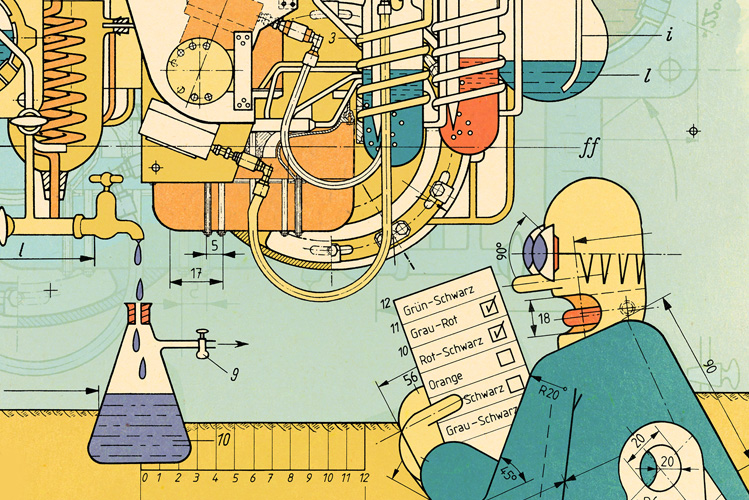Der Gedanke war einleuchtend: Wer etwa während des Wartens auf ein Bewerbungsgespräch „Powerposen“ einnimmt – die Faust ballt oder die Hände in die Hüften stemmt –, könne sich danach stärker fühlen und deshalb erfolgreicher sein. Diesen Zusammenhang entdeckten die US-amerikanische Psychologin Dana Carney, inzwischen an der Haas School of Business der University of California, und ihre Kollegen 2010 in einer Studie.
Vier Jahre später erklärte die Forscherin in einem Blogpost: „Ich glaube nicht, dass…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
Powerposen tatsächlich Effekte haben.“ Mehrere Versuche, die Ergebnisse zu wiederholen, waren fehlgeschlagen. In ihrem Post zählt die Forscherin einige Schwächen dieser Studie auf, etwa die zu geringe Anzahl der Versuchspersonen, einen zu frühen Messzeitpunkt, die Fehlinterpretation eines Befunds. Sie räumt ein, dass sie einige dieser Defizite hätte früher erkennen können.
Die Forscherin hatte lange an ihre Vermutung geglaubt – bis die missglückten Wiederholungen ihr vor Augen führten, dass an der Idee wohl doch nichts dran ist. Dass eine scheinbar gute Idee sich als ungenügend herausstellt, passiert nicht nur in der Forschung, sondern überall und jedem von uns: Man übersieht etwas, vergisst etwas, was wichtig wäre, berücksichtigt bestimmte Fakten nicht oder bildet sich eine Meinung zu einem Thema, das man gar nicht einschätzen kann.
Der Berliner Flughafen in uns
Seit sich in der Wissenschaft abzeichnet, wie viele Hypothesen nur einmal bestätigt werden können und dann nicht mehr, heißt das Phänomen dort „Replikationskrise“. In Unternehmen und der Politik können Projekte scheitern, weil falsche Vorannahmen und Entscheidungen getroffen wurden. Der Berliner Flughafen gilt als ein Musterbeispiel für beides. Hunderte von Umplanungen, Verschiebungen, verspätete Einreichungen von Bauanträgen, keine externe Kontrolle der Projektdokumentationen, fehlende Kooperation sorgten für ständig steigende Kosten.
Und selbst im Kleinen passierten eine Menge Fehler: Viele Räume im Flughafengebäude wurden falsch nummeriert, zu wenig Stahl in den Decken der Parkhäuser verbaut, Brandschutzwände nicht nach den gesetzlichen Vorgaben errichtet, zu kurze Rolltreppen installiert.
Wir alle glauben mitunter fest an einen Sachverhalt, und es kann dauern, bis wir merken, dass wir einer Fehleinschätzung unterlegen sind oder etwas übersehen und nicht bedacht haben. Dabei seien solche Denkfehler und Irrtümer, so der Fehlerforscher und Wirtschaftswissenschaftler Jan Hagen in seinem Buch Fatale Fehler, vollkommen normal und menschlich. In den Medien erklärte Hagen: „Wir sind Menschen, keine Maschinen. Und selbst bei Maschinen kann es technische Probleme geben.“ Das liege daran, dass ein Großteil menschlicher Entwicklungen und Erkenntnisse auf dem Prinzip von Versuch und Irrtum fuße.
Das eigene Wissen besser einschätzen
Kann man das Risiko von Fehleinschätzungen und Fehlleistungen wenigstens verringern? Nachdem offenbar geworden ist, wie viele Studienergebnisse der letzten Jahre einer Überprüfung nicht standhalten, entwickelt sich in der Psychologie gerade ein neues Forschungsfeld dazu. Wie wappnet man sich gegen allzu große Fehleinschätzungen? Was könnte eine passende Denkmethode sein? Wie der Psychologe Benjamin R. Meagher und seine Kollegen schreiben, geht es um die Fähigkeit, Informationen kritischer zu bewerten, den Umfang des eigenen Wissens präziser einzuschätzen und Kritik an eigenen Ideen zu akzeptieren. Die Forscher nennen das „intellektuelle Bescheidenheit“.
Die Psychologin Stacey McElroy-Heltzel, die das Phänomen ebenfalls untersucht, ergänzt: Dazu gehöre neben der Einsicht in die Grenzen des persönlichen Wissens auch die Offenheit für neue Ideen. Außerdem seien intellektuell Bescheidene eher bereit, ihre Ideen sachlich und ruhig – in einer nichtoffensiven Weise – zu äußern sowie konträre Ideen zur Kenntnis zu nehmen, ohne den anderen anzugreifen.
Wer intellektuell bescheiden ist, könne durchaus starke Überzeugungen haben, wie der Psychologieprofessor Mark Leary einmal sagte. Dies gehe jedoch stets einher mit der Bereitschaft, sich eines Besseren belehren zu lassen, also auch feste Überzeugungen aufzugeben, wenn sie sich als unangemessen herausstellen.
Intellektuelle Bescheidenheit
Die Hoffnung der Psychologen: Intellektuelle Bescheidenheit möge eine Denkweise und Haltung sein, die es erlaubt, konstruktiver mit Fehlern und Meinungsverschiedenheiten umzugehen, ob öffentlich, in der Wissenschaft oder im Alltag. Wie kann man intellektuelle Bescheidenheit bei sich selbst feststellen?
So vorhanden, tritt sie nur in bestimmten Situationen zutage, nämlich wenn Fakten, Ideen oder Planungen diskutiert werden und die Versuchung besteht, recht haben zu wollen: wenn man das dringende Bedürfnis verspürt, jemanden zu korrigieren oder zu zeigen, dass man sich auskennt. Oder auch wenn man auf Kritik reagieren muss und genau dann ganz besonders die eigenen Überzeugungen herausstellt – Stacey McElroy-Heltzel nennt diese Situationen „diagnostisch“, weil sie Eigenschaften Einzelner hervorbringen, die sonst nicht zutage treten.
Eine der ersten Untersuchungen, intellektuelle Bescheidenheit empirisch nachzuweisen, konzipierten der Psychologe Don E. Davis und sein Team vor drei Jahren. Die Wissenschaftler testeten über tausend Studierende anhand einer Skala auf ihre generelle und ihre intellektuelle Bescheidenheit hin. Außerdem überprüften sie die Eigenschaften der Big Five, also Offenheit, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion und Neurotizismus. Es zeigte sich, dass intellektuelle Bescheidenheit mit Offenheit in Beziehung steht.
Ein flexibler Verstand
Darüber hinaus fanden die Psychologen heraus, dass intellektuelle Bescheidenheit mit einer stärkeren Motivation einhergeht, sich bei der Verarbeitung von Informationen Mühe zu geben und dies sorgfältig zu tun.
Wenn nun Menschen unterschiedlich stark intellektuell bescheiden sind, sind sie dann unterschiedlich intelligent oder denken sie „irgendwie“ anders? Diesen Fragen gingen die Psychologin Leor Zmigrod und ihre Kollegen in einer kleinen Studie nach, bei der sie 108 Studenten eine Skala für intellektuelle Bescheidenheit zur Beantwortung vorlegten und ihnen anschließend Aufgaben stellten, um ihre Intelligenz und kognitive Flexibilität zu untersuchen.
Unter kognitiver Flexibilität verstehen Forscher die Fähigkeit, vorhandenes Wissen schnell und beweglich abzurufen und in die eigenen Überlegungen einzubeziehen. In der Studie wurden die Teilnehmer unter anderem darum gebeten, schnell möglichst viele verschiedene rote Gegenstände aufzulisten oder für Haushaltsgegenstände möglichst viele Mehrfachverwendungen zu nennen.
Intelligenz sei zwar hilfreich für intellektuelle Bescheidenheit, fassen Leor Zmigrod und ihr Team die Ergebnisse zusammen, wichtiger sei aber die kognitive Flexibilität, die dazu verhelfe, Sachverhalte neu einzuschätzen.
Offener und neugieriger
Intellektuell bescheidene Menschen neigen darüber hinaus offenbar dazu, ihre eigenen kognitiven Fähigkeiten eher zu unter- als zu überschätzen, dies zeigten die Psychologin Elizabeth Krumrei Mancuso und ihre Kollegen in fünf Studien. Und das sei so, obwohl die intellektuell Bescheidenen unter diesen Befragten über ein breiteres Allgemeinwissen verfügten als andere.
Außerdem fanden die Forscher heraus, dass die intellektuell Bescheidenen stärker dazu neigten zu reflektieren und offener, neugieriger und stärker intellektuell engagiert waren als andere Probanden. Sie zeigten ein größeres Interesse daran, neues Wissen zu erwerben – was sich mit den Befunden deckt, die den intellektuell Bescheidenen eine größere Offenheit attestieren.
Fehler passieren. Aber ist die Bereitschaft, sie einzuräumen, tatsächlich ein Zeichen intellektueller Bescheidenheit? Dieser Frage ging beispielsweise der Tübinger Psychologe Kai Sassenberg nach, der am Tübinger Leibniz-Institut für Wissensmedien forscht.
Wissenschaftliche Verantwortung
Die Ergebnisse von Tests mit einer eigens entwickelten Skala zeigen tatsächlich Verbindungen: Diejenigen Teilnehmer, die sich eher bereit zeigten, Fehler zuzugeben, waren verträglicher, ehrlicher, bescheidener und etwas gewissenhafter als andere. Macht war für sie etwas, das mit Verantwortung einhergeht, und sie erwiesen sich als weniger sozial dominant. Außerdem zeigten sie sich eher bereit als andere, ihre Fehler auch öffentlich zuzugeben, was mehr Mut erfordert, als dies in einem geschützten Rahmen zu tun.
Dies gilt auch für die Wissenschaft: Mit der Frage, wie schwierig es sein kann, hier gegenüber einem größeren Kreis von Kollegen Fehler einzuräumen, hat sich die Psychologin Julia Rohrer von der Universität Leipzig beschäftigt. Während eines Kongresses in Australien sprach Rohrer mit dem Psychologen Tal Yarkoni über die Replikationskrise der Psychologie.
Yarkoni berichtete der jungen Kollegin, dass er daran gedacht habe, ein Projekt namens Loss of confidence anzustoßen, aber leider nicht dazu komme: Forscher, so seine Idee, sollten über einen Aufruf im Internet ermutigt werden, in der Wissenschaftlercommunity öffentlich darüber zu sprechen, warum sie den Glauben in ein Forschungsergebnis verloren hatten. Julia Rohrer griff das Projekt auf.
Ein Save Space für Fehler
Denn obwohl es schon seit langem die Möglichkeit gebe, fehlerhafte Studien offiziell zurückzuziehen, hafte dem bis heute ein negativer Beigeschmack an, sagt sie. Es herrsche die Überzeugung vor, so etwas mache man nur, wenn „etwas Schlimmes passiert ist“, etwa Betrug oder manipulierte Daten.
Die Reaktionen auf ihren Aufruf in sozialen Medien zeigten: Auch Forscher tun sich schwer, Fehleinschätzungen und Irrtümern öffentlich anzusprechen. Es meldeten sich lediglich elf Forscherteams mit Statements über individuelle Fehler in ihren Studien.
Darüber hinaus erhielten Rohrer und die Mitstreiter aus Großbritannien, den Niederlanden, Singapur und den USA viel positive Resonanz, aber keine weiteren Stellungnahmen. Julia Rohrer sieht darin ihre Vermutung bestätigt, dass Wissenschaftler einen geschützten Ort brauchen, wo sie individuelle Fehler innerhalb der Wissenschaftscommunity diskutieren können.
Fehler sind nicht unmoralisch
Niemand gibt gern eine Fehleinschätzung zu. „Man muss sich ein bisschen überwinden“, erklärt der Psychologe Kai Sassenberg. Insofern sei Fehler zuzugeben eine „sozial relevante Eigenschaft“, denn es gehe stets darum, ehrlich zu sein, eine eigene bisherige Einschätzung umzudeuten und sie in ein negatives Licht zu rücken. Schnell könne dabei das Gefühl aufkommen, ein Fehler sei etwas Unmoralisches. Unmoral komme aber erst ins Spiel, wenn es um einen folgenreichen Fehler gehe, mit dem man anderen Schaden zugefügt hat, wie etwa in der Dieselaffäre.
Ein Problem dabei: Es sei nicht immer einfach zu entscheiden, ob eine Einschätzung tatsächlich völlig falsch ist, so Sassenberg: „Bei der Entwicklung unserer Skala über die Bereitschaft, Fehler zuzugeben, haben wir uns auf Einschätzungen konzentriert, bei denen es eindeutig war, ob A oder B richtig war. Aber ganz oft gibt es viel Interpretationsspielraum und viele Ungewissheiten.“ Wissenschaftliche Erkenntnisse seien fragil. Das bedeute: Erkenntnisgewinn baut immer auch auf Vertrauen auf.
Und es gibt Situationen, in denen vermutlich niemand gegenüber anderen Schwächen einräumt: wenn man unter Druck steht, Angst bekommt und etwas zu verlieren hat, meint Kai Sassenberg. „Dann kann man noch so intellektuell bescheiden und bereit sein, Fehler zuzugeben – in solchen Momenten werden wir es nicht tun.“ Auch in der Wissenschaft herrscht starker Wettbewerb.
Entgegenlaufende Tendenzen
Seit der Replikationskrise verschärfen sich die Richtlinien der wissenschaftlichen psychologischen Journale immer mehr. Die Ablehnungsquoten liegen hier laut Sassenberg bei mittlerweile mehr als 95 Prozent. Zugleich sind vor allem jüngere Forscher darauf angewiesen, möglichst viele Publikationen vorzuweisen, wenn sie einen Job ergattern wollen.
Wer auch unter schwierigen Bedingungen den Mut zu intellektueller Bescheidenheit hat, kann für sich selbst und andere Positives erreichen. Das gilt nicht nur in der Forschung, sondern auch in Organisationen und Unternehmen, wie eine Untersuchung des Fehlerforschers Jan Hagen belegt. Sein Spezialgebiet sind sogenannte Hochrisikoorganisationen, in denen Fehler fatale Folgen für viele Menschen haben könnten, also etwa Fluggesellschaften.
Hagen überprüfte unter anderem, welche Faktoren die Fehlerquoten von Airlinecrews am deutlichsten reduzierten. Der auffälligste Faktor: Stellte ein Flugkapitän seinem Team während der Zusammenarbeit konkrete Fragen, bat also um Einschätzungen aus verschiedenen Blickwinkeln, passierten die wenigsten Fehler. Generell aber herrsche auch in Unternehmen noch zu häufig eine Kultur, die es schwerermache, ein Versäumnis offenzulegen oder andere darauf anzusprechen, sagt der Wirtschaftswissenschaftler.
Weniger frustriert im Umgang miteinander
Intellektuelle Bescheidenheit scheint unterm Strich sehr lohnenswert zu sein. Sie ist eine Fähigkeit und eine Haltung, die sich positiv auf private und berufliche Beziehungen auswirken könnte. Etwa wenn es alltägliche Konflikte um die Verteilung der Hausarbeit gibt. Wer nicht einräumen kann, dass er seine Pflichten vernachlässigt hat, macht sich selbst und der Familie das Leben schwer und verschärft die Situation nur.
Wer im Beruf anderen einen Fehler vorenthält, nimmt ihnen die Möglichkeit, daraus zu lernen. Der Psychologe Mark Leary erklärt, Führungskräfte sollten intellektuell bescheiden sein, denn in der Regel bräuchten sie für gute Entscheidungen mehr als eine Sichtweise.
Egal ob im Privaten oder im Beruf, wer zu seinen Irrtümern stehe und sich korrigieren lasse, habe ein geringeres Risiko, wegen unbedeutender Meinungsverschiedenheiten mit anderen in Konflikt zu geraten. „Wir würden uns alle ein bisschen besser verstehen und wären im Umgang miteinander weniger frustriert.“
Intellektuell bescheidener werden
Mache ich mir etwas vor, wenn es um mein Wissen geht? Tue ich mich schwer, Fehler zuzugeben? Und lässt sich daran etwas ändern? Offenbar schon. Eine allererste Antwort gibt eine Studie der Psychologinnen Tenelle Porter und Karina Schumann. Sie gingen von folgender Annahme aus: Inwieweit wir selbst intellektuell bescheidener werden können, hängt davon ab, welches Konzept wir von unserer Intelligenz haben. Bleibe ich immer gleich intelligent oder habe ich das Potenzial, klüger zu werden? Aus der psychologischen Forschung ist bekannt, dass unsere mentalen Konzepte uns stark beeinflussen, etwa auch in Beziehungen. Wer grundsätzlich glaubt, diese seien etwas Negatives, wird sich anders verhalten, als wenn er in einer Beziehung etwas Förderliches sieht. Und wer der Meinung ist, jeder könne grundsätzlich lernen, kann auch die eigene Täuschbarkeit erkennen und weiß eher, dass das eigene Wissen begrenzt ist.
Die Forscherinnen testeten dies, indem sie ihre Teilnehmer verschiedene Artikel über Intelligenz lesen ließen: In dem einen war diese als ausbaufähig, in dem anderen als nicht beeinflussbar beschrieben. Danach lösten die Probanden knifflige Aufgaben, bei denen es schwer einzuschätzen war, ob sie gut abschneiden würden. Diejenigen, die den Beitrag über die entwicklungs- und ausbaufähige Intelligenz gelesen hatten, waren nach dem Absolvieren der Aufgabe intellektuell bescheidener als die anderen: Sie konnten zugeben, dass die Aufgabe für sie nicht lösbar war. Ob dieser Effekt anhaltend ist, lässt sich laut den Autorinnen nicht sagen – dazu sei weitere Forschung notwendig.
SAC
Literatur
Adam K. Fetterman u.a.: On the willingness to admit wrongness: Validation of a new measure and an exploration of its correlates. Personality and Individual Differences, 138, 2019. DOI: 10.1016/j.paid.2018.10.002
Leor Zmigrod u.a.: The psychological roots of intellectual humility: The role of intelligence and cognitive flexibility. Personality and Individual Differences, 141, 2019. DOI: 10.1016/j.paid.2019.01.016
Jan U. Hagen: Fatale Fehler. Oder warum Organisationen ein Fehlermanagement brauchen. Springer Gabler, Berlin 2017
Quellen und Literatur Intellektuelle Bescheidenheit, Ausgabe 2/2020
Adam K. Fetterman u. a.: On the willingness to admit wrongness: Validation of a new measure and an exploration of its correlates. Personality and Individual Differences, 138, 2019. DOI: 10.1016/j.paid.2018.10.002
Leor Zmigrod u. a.: The psychological roots of intellectual humility: The role of intelligence and cognitive flexibility. Personality and Individual Differences, 141, 2019. DOI: 10.1016/2019.01.016
Don E. Davis u. a.: Distinguishing intellectual humility and general humility. The Journal of Positive Psychology, 11/3, 2016. DOI: 10.1080/17439760.2015.1048818
Leor Zmigrod u. a.: The partisan mind: I extreme political partisanship related to cognitive inflexibilty? Journal of Experimental Psychology: General, 2019. DOI: 10.1037/xge0000661
Benjamin R. Meagher u. a.: Contrasting self-report and consensus ratings of intellectual humility and arrogance. Journal of Research in Personality, 58, 2015. DOI: 10.1016/j.jrp2015.07.002
Smantha A. Deffler u. a.: Knowing what you know: Intellectual humility and judgments of recognition memory. Personality and Individual Differences, 96/2016. DOI: j.paid.2016.03.016
Rick H. Hoyle: Holding speciric views with humility: Conceptualization and measurement of specific intellectual humility. Personality and Individual Differences, 97/2016. DOI: 10.1016/j.paid.2016.03.043
Julia M. Rohrer u. a. Putting the self in self-correction. https://lossofconfidence.com
Elizabeth J. Krumrei-Mancuso u. a.: Links between intellectual humility and acquiring knowledge. The Journal of Positive Psychology, 2019. DOI: 10.1080/17439760.2019.1579359
Tenelle Porter, Karina Schumann: Intellectual humility and openness to the opposing view. Self and Identity, 2018. DOI: 10.1080/15298868.2017.1361861
Jan U. Hagen: Fatale Fehler. Springer Gabler, 2017, 2. Auflage
https://today.duke.edu/2017/03/modest-personality-trait-intellectual-humility-packs-punch
Dana Carney: My position on “Power Poses”, Blog Post