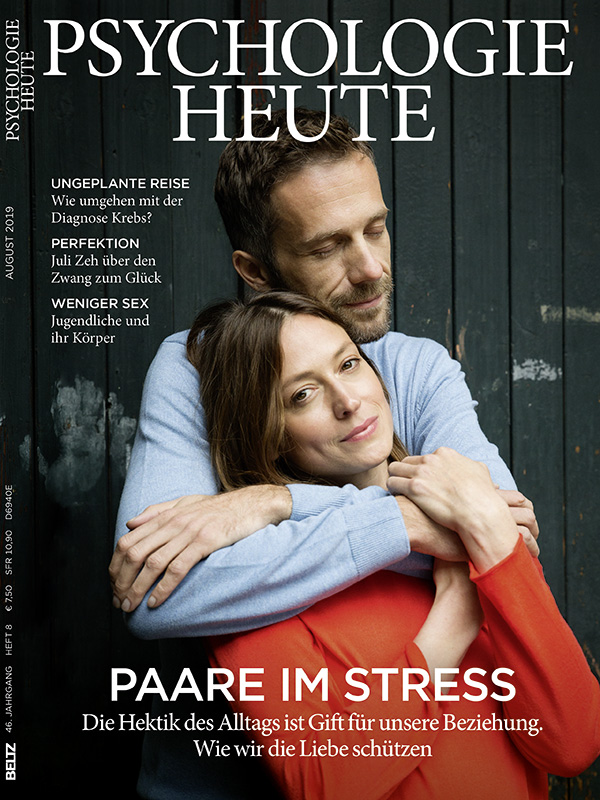Frau Zeh, das Thema Selbstoptimierung zieht sich wie ein roter Faden durch Ihre Bücher. Was interessiert Sie daran?
Für mich ist das ein Lebensthema, es beschäftigte mich schon während meines Jurastudiums in den 1990er Jahren. Die Individualisierung nahm damals richtig Fahrt auf, und ich fragte mich, ob es für Einzelne und für die Gesellschaft gesund sein kann, wenn jeder sich primär auf sich selbst bezieht – und was das für eine Demokratie bedeutet, die ja vom Volk ausgeht und nicht von 83 Millionen…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
bezieht – und was das für eine Demokratie bedeutet, die ja vom Volk ausgeht und nicht von 83 Millionen Ego-Shootern. Diesen Konflikt habe ich auch bei mir selbst gespürt: Ich bin ein politischer Mensch, wollte mich aber als junge Erwachsene nie auf eine Partei einlassen. Zu einer Gruppe zu gehören löste Unbehagen aus.
Warum waren Ihnen Gruppen damals unangenehm?
Wir alle sind infolge des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts sehr darauf getrimmt worden, uns nicht vereinnahmen zu lassen, selbst zu denken, alles zu hinterfragen, immer als Individuum dastehen zu können. Das kollidierte für mich früher mit einer Parteizugehörigkeit. Gruppen nicht blind zu vertrauen, das ist ja an sich auch sinnvoll. Aber wie mit allen Dingen, die man in eine Richtung übertreibt: Irgendwann kriegt Individualismus auch ein dunkles Gesicht.
Wenn Sie an die Figuren Ihrer Romane denken: Was sind die hellen und die dunklen Seiten des ständigen Selbstbezugs?
Literatur beschäftigt sich ja eher mit den Dingen, die schiefgehen, man diagnostiziert immer auch ein bisschen, was nicht optimal läuft. Deshalb zeigen meine Figuren überwiegend die psychologischen Probleme, die aus der Selbstbezogenheit entstehen: Kann man zufrieden sein, wenn man sich ständig die Verantwortung für alles, was einem widerfährt, aufbürdet? Wie ergeht es einem, wenn man sich als Angelpunkt des Universums begreift? Ich glaube beispielsweise nicht, dass das Hauptproblem heute Einsamkeit und Vereinzelung sind – die Menschen sind extrem sozial, nicht weniger als früher. Aber ich erlebe fast alle als überfordert von dem Versuch, immer alles richtig zu machen.
Vor allem das Ensemble Ihres Dorfromans Unterleuten spiegelt ja verschiedene Facetten einer Selbstoptimierung wider. Es gibt da etwa die ehrgeizige Linda und die unsicher um sich selbst kreisende Jule. War es geplant, solche Typen zu kreieren?
Absolut nicht. Der kreative Prozess ist bei mir weniger strukturiert, als man vielleicht denkt. Es fängt oft mit einer bildlichen Vorstellung an: Die Figuren entstehen, als würde man sich an einen Kinofilm erinnern, ich sehe, wie sie sind, wie sie wirken. Dann versetze in mich in die Figuren hinein, als seien es echte Menschen, ich lasse die Fantasie spielen, versuche die Protagonisten aber auch über eigene Erfahrungen und Gefühle, also quasi empathisch zu verstehen. Daneben haben Erzählungen ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten, entwickeln sich von selbst weiter. Im Fall von Unterleuten etwa kam eins zum anderen. Ich schrieb über eine Person, die etwas erlebt und jemanden trifft, der mir dann plötzlich auch interessant vorkam. So kam aus jeder Figur eine andere. Die vielen Personen waren jedenfalls nicht geplant.
Sie lernen Ihre Protagonisten beim Schreiben kennen. Gibt es etwas, das allen gemeinsam ist, ein verbindendes Problem?
Fast alle folgen einem Glücksimperativ, dem Befehl „Ich muss glücklich sein“. Wenn man nur einmal kurz drüber nachdenkt, wird klar, wie absurd das ist, denn Glück ist kein Dauerzustand. Deshalb gilt heute oft Erfolg als Indiz für Glück. Gleichzeitig sehen viele – anders als in den Nachkriegsjahrzehnten – im Erreichen von materiellen und beruflichen Zielen letztlich nur noch Zwischenschritte auf dem Weg zum Glück. Ein hoher Status allein reicht heute nicht mehr. Frust, Verzweiflung, Burnout sind da programmiert. Wenn man einen guten Job hat und eine Beziehung, aber nicht permanent glücklich ist, dann kommt schnell das Gefühl auf, dass man versagt hat. Dann muss man sich trennen, den Job wechseln und so weiter. Dieses Problem, das viele der Figuren aus Unterleuten umtreibt, macht auch sonst vielen Menschen Druck.
Wir wissen, dass Glück kein Dauerzustand ist. Warum ist es dennoch zum wichtigsten Lebensziel geworden?
Das hat mit dem Verlust sämtlicher anderer Lebensziele zu tun. Durch die Emanzipation ins Individuelle hat keine Religion, keine politische Rührigkeit, keine gesellschaftliche Weltverbesserungsidee mehr Gültigkeit. Und wenn man all das als Lebensziel wegnimmt, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Die Sinnfrage ist für Menschen aber unvermeidlich, wir stellen sie seit Jahrtausenden. Wenn die Antwort auf die Frage „Warum mache ich das alles?“ nicht mehr ist „weil Gott das will“, „weil es mein Schicksal ist“, wenn man auch den Rest der Menschheit nicht miteinbezieht, dann bleibt als Antwort nur noch: „Na ja, irgendwie will ich halt glücklich werden.“
Sie haben auch Sachtexte geschrieben, könnten über das Thema Selbstoptimierung also sicher einen erhellenden Essay verfassen. Warum entscheiden Sie sich immer wieder für Romane?
Ich verfolge beim Romaneschreiben keine konkrete Absicht. Ich setze mich nicht hin und denke: „Egozentrik ist ein wichtiges Thema, darüber schreibe ich jetzt.“ Wenn ich das wollte, würde ich tatsächlich eher einen Essay schreiben. Beim literarischen Erzählen ziehen mich andere konkrete oder ästhetische Sachen an, das kann der Beginn einer Geschichte sein, der mir im Kopf rumgeht und mich fasziniert, eine einzelne Figur, ein Tonfall. Erst während des Schreibens melden sich dann die politischen oder gesellschaftlichen Themen zu Wort, die mich sonst umtreiben, die stampfen in den Text mit hinein, ob ich will oder nicht. Beim Schreiben von Romanen gilt für mich immer: erst schreiben, dann denken. Wenn ich einen Essay verfassen würde, wäre der Weg umgekehrt: erst denken und dann schreiben.
Es scheint Ihnen wichtig zu sein, das Schreiben von Plänen und Absichten freizuhalten. In Ihrem Buch Gebrauchsanweisung für Pferde schreiben Sie sogar, dass Sie sich nicht als Schriftstellerin bezeichnen – weil Sie das ausbremsen würde.
Bei mir funktioniert das alles tatsächlich nur, wenn der Horizont offen ist. Ich habe es ein einziges Mal andersrum probiert, habe perfekt geplant, konzipiert und vorbereitet, bevor ich angefangen habe zu schreiben. Danach hatte ich eine einjährige Schreibkrise, war nicht in der Lage, den Text fertigzustellen. Deshalb auch meine Vorsicht, einen Berufsstempel draufzudrücken. Würde ich mich als Schriftstellerin bezeichnen, hätte ich schnell das Gefühl, die Arbeit müsste nach einem festen Muster ablaufen, planbar und messbar sein. Und das widerspricht allem, was ich übers Schreiben mittlerweile weiß. Als ich für das Buch über mein Leben mit Pferden nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass es Parallelen gibt in der Art, wie ich schreibe und wie ich mit Pferden umgehe. Da könnte man jetzt weiterdenken, inwieweit sich diese Haltung auch auf andere Bereiche übertragen lässt. Es könnte doch sein, dass Planung und Kontrolle nicht nur schlicht stressig sind, sondern in vielen Bereichen kontraproduktiv und nicht mal zum Erfolg führen.
Können Sie diese Arbeitshaltung noch genauer beschreiben?
Es geht darum, sich auf den Prozess einzulassen. Wenn man einen perfekten Plan hat, den man verfolgt, ist es jedenfalls schwierig, Dinge, die im Augenblick entstehen, überhaupt noch wahrzunehmen. Es ist aber oft so – egal ob man mit Menschen, Pferden oder Texten arbeitet –, dass sich während des Tuns zeigt, wie es weitergehen soll und was das Beste ist. Wer nur seinem Konzept folgt, kann diese Situationsintelligenz weder erkennen noch nutzen. Wenn ich schreibe, ist ja niemand da außer mir. Trotzdem weiß ich oft nicht, was in der nächsten Sekunde in meinem Kopf passieren wird. Und wenn ich das nicht aushalte, wenn ich den Prozess kontrollieren wollen würde und nicht warten könnte, was sich zeigt, dann würde wahrscheinlich oft gar nichts passieren.
Man könnte das, was Sie schildern, als achtsame Haltung bezeichnen. Es gibt in der Psychologie heute zahlreiche Trainings, mit denen Menschen lernen können, genau diese Art Offenheit für Situationen zu üben.
Achtsamkeit hat als spirituelle Haltung sicher eine Berechtigung. Ich habe allerdings den Verdacht, dass diese Techniken in unserer Gesellschaft vor allem dazu dienen, die Leute fitter zu machen, damit sie mehr leisten, damit sie ihr Leben noch besser meistern – nach dem Muster unzähliger Erfolgsratgeber. Da schnappt die Optimierungsfalle wieder zu.
Sie haben unter Pseudonym selbst einen solchen Ratgeber geschrieben, der knallharte Tipps für den persönlichen Erfolg gibt. Wie kam es dazu?
Nee, das war ich doch gar nicht. Das war Manfred Gortz! [Lacht.] Es kam so: Als ich die erste Fassung von Unterleuten Testlesern gegeben habe, meinem Mann und einigen Leuten vom Verlag, sind alle an der Figur Linda Franzen hängengeblieben und an den Sprüchen des Erfolgstrainers Manfred Gortz, die Linda häufig zitiert. Alle haben mich gefragt: Gibt es diesen Menschen, das klingt so echt? Ich hatte mir das aber natürlich nur ausgedacht. Dann kam die Idee auf, dass es doch lustig wäre, diesen nicht vorhandenen Ratgeber zu schreiben. Ich fand das gleich total spannend: Es macht mir eh Spaß, die Frage auszuloten, wie viele Ebenen Fiktion haben kann, wie real eigentlich die Wirklichkeit ist. Und tatsächlich bekomme ich bis heute Mails von Leuten, die Herrn Gortz zu Konferenzen einladen. Kaum einer hat durchschaut, dass es ein Fake, eine Satire war. Ich musste das im Netz irgendwann selbst aufdecken.
Erstaunlich, dass es keiner gemerkt hat, in dem Text stehen vollkommen überzeichnete und menschenverachtende Ratschläge.
Ja. Es wird ständig erklärt, wie man andere Menschen noch besser ausbeuten kann. Zum Beispiel wird empfohlen, dass man mit seiner Frau, bevor man sie heiratet, einen Vertrag abschließen soll, dass sie immer den Haushalt macht. Das Verrückte ist, dass trotzdem niemand protestiert hat. Ich fand das als Experiment im Nachhinein ziemlich erhellend. Es zeigt: Alles, was ich dort schreibe, ist durch unsere Mentalität und Leistungskultur abgedeckt. Die Selbstbezogenheit kann heute also auch menschenverachtende Züge annehmen.
Ihr Werk, das sich über 20 Jahre erstreckt, spiegelt ja auch die Entwicklung der Selbstbezogenheit wider. Was hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert?
Ich habe einen extremen Kulturwandel zwischen meinem ersten Roman Adler und Engel und dem darauffolgenden Roman Spieltrieb erlebt. Adler und Engel bezog sich noch auf das Lebensgefühl der 1990er Jahre, es wurde risikoreich und selbstzerstörerisch gelebt, es gab eine gewisse Freiheit. Ich bin selbst in dieser Zeit sozialisiert, habe damals eine Aufbruchstimmung und Offenheit erlebt. Alle Welt schien zu sagen: „Jetzt haben wir lange genug Wirtschaftswunder gemacht, jetzt wollen wir gucken, was es noch gibt.“ Man denke an die Spaßkultur der Technobewegung: „Der Sinn des Lebens ist eine gute Party.“ Dass all das stattgefunden hat, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Das Gemeinschaftserleben dieser Jahre war für mich und ich glaube auch für viele andere wichtig, es war eine Pause von der Egozentrik. Dann kam ein Bruch. Was genau passierte, kann ich nicht benennen. Der 11. September und der Umgang damit spielten sicher eine Rolle, plötzlich kamen weltweit wieder sehr rigide Prinzipien auf. Parallel dazu fand eine Hinwendung zu noch mehr Selbstoptimierung statt, alles wurde unter dem Leistungsaspekt bewertet, sogar private Details wie das Liebesleben, die Sexualität. Der 2004 erschienene Roman Spieltrieb hat schon mit der Optimierungs- und Dominanzkultur zu tun, die wir heute kennen. Vom Gemeinschaftsgeist der neunziger jahre ist nichts mehr spürbar.
In Ihrem Buch Unterleuten von 2016 geht es ebenfalls um die Schwierigkeiten, die entstehen, wenn Ichbezogenheit auf eine Gemeinschaft trifft. Sie haben es dort ausgelotet: Wie gelingt Gemeinschaft? Und wann scheitert sie?
Entscheidend ist doch die Frage, ob man als Einzelner gemeinschaftsfähig ist. Und das hängt damit zusammen, ob man überhaupt begreift, was eine Gemeinschaft ist. Viele Menschen haben die Vorstellung, Gruppen könne man frei wählen, eine Gemeinschaft entstehe immer dann, wenn einzelne Mitglieder oder Bestandteile für einen selbst gut und nützlich sind, wenn alle dasselbe denken. Das ist allerdings eine fehlgeleitete Vorstellung, so funktioniert Gemeinschaft höchstens ein paar Wochen lang. Es geht doch gerade darum, dass die Menschen nicht alle auf Anhieb zusammenpassen, dass alle anders sind und unterschiedliche Dinge wollen. Insofern ist jede relevante Gemeinschaft letztlich auch eine Zwangsgemeinschaft. In einem Dorf oder auch bei einer Familie ist es ja gerade das Besondere, dass man sich die anderen nicht ausgesucht hat. Man kann nicht weg, das ist nicht so einfach, wie eine Facebookgruppe zu kündigen. Selbstgewählte und vorselektierte Gemeinschaften à la Facebook sind ständig auf dem Prüfstand. Gerade dadurch entsteht viel Unsicherheit.
Sie leben selbst seit einigen Jahren auf einem Dorf im Havelland. Mögen Sie die Art des Zusammenlebens dort?
Ich habe jedenfalls gemerkt, dass die Menschen dort mehr daran gewöhnt sind, Andersdenkende – auch seltsame Leute – zu integrieren und mögliche Interessenkonflikte offen auszuhandeln. Sehr einfache, basale Grundregeln des Zusammenlebens sind hier ganz selbstverständlich und funktionieren: leben und leben lassen; wenn ich was will, gehe ich zu dir; wenn du was willst, höre ich dir zu. Aus dieser Art der Verbindlichkeit und Kommunikation folgen dann eine bestimmte Energie und Freude, die jenseits von Erfolg und Reichtum liegen, denn davon ist in dieser Region tatsächlich nur wenig vorhanden. Ein bisschen anpassen muss sich natürlich dennoch jeder. Doch die Dorfgemeinschaft bietet meiner Erfahrung nach mehr Freiheit als das moderne urbane Leben, die Leute sind viel weniger konformistisch. Es gibt hier Menschen, die machen Sachen, das kann man eigentlich gar nicht erzählen.
Was denn zum Beispiel?
Das kann ich doch eben nicht erzählen! [Lacht.] Vielleicht kann ich es aber an einer Nebenfigur aus Unterleuten erklären, es gibt dort einen Indianer. Den gibt es hier in der Gegend tatsächlich auch. Das ist schon speziell, dass jemand morgens wie Millionen andere mit dem Auto zu seinem Job fährt und abends dann nach Hause kommt, sich sein Gesicht anmalt wie Winnetou, sich einen Federschmuck auf den Kopf setzt und in den Wald geht. Ob das beispielsweise im Prenzlauer Berg so toleriert werden würde, wage ich zu bezweifeln. Hier interessiert das wirklich niemanden. Die Person wird aber auch nicht ausgeschlossen. Das erlebe ich schon als Freiheit.
Dem Helden in Ihrem neusten Roman Neujahr ergeht es anders. Er hat sich in die Kleinfamilie zurückgezogen, will dort alles richtig machen, entwickelt eine Angststörung. Ist er zu wenig in Gemeinschaft?
Was den Protagonisten Henning quält, ist sicher zu einem Großteil eine direkte Folge aus all dem, worüber wir hier sprechen. In dem Roman habe ich das zwar so zugespitzt, dass er irgendwann auf Lanzarote auf ein schweres Trauma stößt, das ihm in der Kindheit widerfahren ist. Er war dort als Fünfjähriger einige Tage ganz auf sich gestellt, musste wie ein Erwachsener funktionieren, war in Lebensgefahr, musste auch noch seine Schwester schützen. Doch diese sehr extreme Erfahrung von Verlassenheit und Überforderung ist vielleicht nur eine Metapher für das, was uns allen passiert: In einem gewissen Maße haben viele Menschen in ihrer Kindheit Situationen erlebt, in denen man viel zu viel von ihnen verlangt hat, Leistungsansprüche an sie gestellt hat, sie alleingelassen hat. Das wiederum bahnt bei vielen – so auch beim Protagonisten Henning – Ängste, Kontrollmechanismen und einen ausgeprägten Perfektionsdrang.
Es sind also auch familiäre Prägungen, die uns in Richtung Kontrolle und Perfektion treiben?
Ich denke jedenfalls, dass es sich lohnt, zu gucken, woher in der eigenen Geschichte die Anlagen zur Selbstoptimierung kommen. Nicht immer muss es so massiv sein wie bei Henning, aber danach zu forschen kann sicher gut sein. Ebenso wichtig finde ich heute die Frage, was wir unseren Kindern mitgeben wollen, was wir dem permanenten Leistungs- und Perfektionsdruck entgegensetzen wollen. Ich habe selbst zwei Kinder und erlebe immer mal wieder, wie hoch beispielsweise schon in der Grundschule die Ansprüche daran sind, dass Kinder funktionieren. Es wäre ziemlich wichtig, das ein bisschen zu durchbrechen.
Wenn Sie sich was wünschen dürften: Was wäre gut, um die permanente Tendenz zur Selbstoptimierung abzuschwächen?
Es ist schwer, dem Prinzip der Pläne, Absichten und Definitionen zu entkommen. Wer sich selbst als irgendetwas sieht oder sehen will, egal ob als moderne Mutter, als Schriftstellerin oder als Erfolgsmensch, der muss dieses selbstgewählte Bild permanent verfolgen. Das ist anstrengend. Vielleicht würde es uns guttun, diese Selbstdefinitionen und sogar die Suche nach Identität ein bisschen sein zu lassen. Ich würde mir wünschen, dass wir viel mehr sinnlose Sachen machen, dass wir das auch unseren Kindern zugestehen. Es wäre doch mal was, mehr Situationen zu erleben, die komplett gar nichts bringen, sondern nur so sind, wie sie eben sind. Das wäre ein Anfang.
Psychologie und Literatur
In unserer Reihe mit Schriftstellerinterviews sind zuletzt erschienen:
Stephan Thome: „Das Fremde ist bedrohlich und verlockend“ (Heft 5/2019)
Gerbrand Bakker: „Vieles bleibt unsagbar“ (Heft 2/2019)
John von Düffel: „Vielleicht gibt es das unabhängige Selbst irgendwann nicht mehr“ (Heft 12/2017)
Annette Mingels: „Meine Eltern haben sieben Jahre auf mich gewartet“ (Heft 9/2017)
Bodo Kirchhoff: „Ohne die Melancholie wäre mein Leben ärmer“ (Heft 3/2017)
Sie können diese Hefte über unsere Website nachbestellen: psychologie-heute.de/shop
Juli Zeh, 1974 in Bonn geboren, hat zunächst ein Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen, dann am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert und angefangen, Romane zu schreiben. Neben verschiedenen Preisen für ihre literarischen Texte hat sie auch Auszeichnungen für ihr politisches Engagement bekommen. Außerdem arbeitet Zeh seit 2019 als ehrenamtliche Richterin für das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg. – Eine Auswahl ihrer Romane: Adler und Engel (Schöffling 2001), Spieltrieb (Schöffling 2004), Unterleuten (Luchterhand 2016), Leere Herzen (Luchterhand 2017), Neujahr (Luchterhand 2018). Im März 2019 erschien bei Piper ihr Sachbuch Gebrauchsanweisung für Pferde