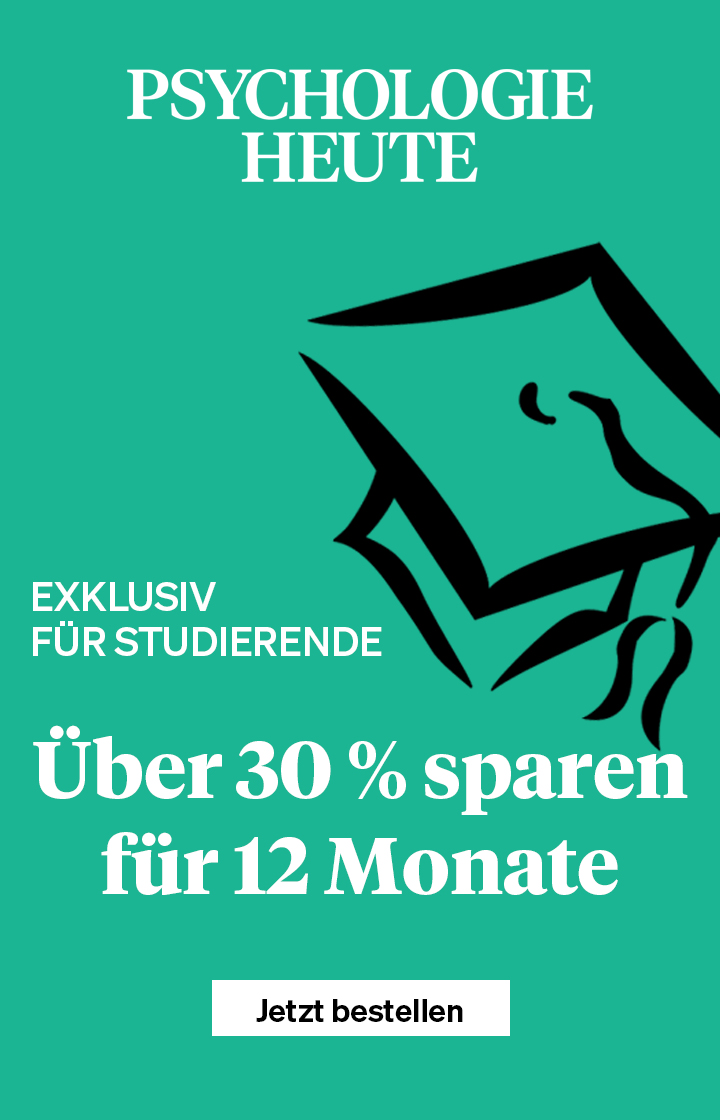Einem Siebtel der Patienten psychosomatischer Kliniken fehlt nach eigenem Bekunden – nichts. Jedenfalls kreuzen sie in einem häufig eingesetzten Fragebogen nicht mehr Symptome an als der Großteil der Bevölkerung. Trotzdem haben sie sich freiwillig in Behandlung begeben. Die Fachwelt nennt solche seltsamen Kranken „pseudogesund“. Forschung zu ihnen gibt es wenig.
Ein Team des Asklepios-Fachklinikums Tiefenbrunn nahe Göttingen beschäftigte sich in einer neuen Studie mit 590 solchen Fällen aus dem eigenen Haus und überprüfte gängige Erklärungen für das Phänomen. Viel Erhellendes fand sich nicht.
Die Betroffenen verteilen sich über die Altersgruppen, Geschlechter sowie Familienstände genau wie die restliche Patientenschar und warten mit ähnlichen Schulabschlüssen auf. Leiden sie womöglich an einzelnen schweren Beschwerden, die im Fragebogen einfach untergehen? Fehlanzeige: 80 Prozent der Männer und 64 Prozent der Frauen kreuzten nirgendwo den Höchstwert an. Besitzen sie vielleicht eine problematische Persönlichkeitsstruktur? Dann wären Persönlichkeitsstörungen, Suizidalität und Selbstbeschädigungen zu erwarten. Doch nichts davon kommt auffällig häufig vor.
Immerhin: Bei schizophrenen Patienten – sie verkennen durch die Krankheit häufig die Wirklichkeit – finden sich besonders viele Pseudogesunde. Bei depressiven, die zum Klagen neigen, gibt es besonders wenige.
Ob die Pseudogesunden die Wahrnehmung von Symptomen unterdrücken, hätte sich vielleicht durch körperliche Messungen des Stresslevels klären lassen. Doch solche lagen nicht vor. Zusammenfassend stellen die Forscher daher fest, dass „weitere Forschung wünschenswert“ wäre.
Übrigens bescheinigten auch die Therapeuten der Klinik einem beachtlichen Teil ihrer Patienten (8,4 Prozent), dass sie kaum belastet seien. Diese Einschätzung galt allerdings meist anderen als den Pseudogesunden. Bei immerhin zwei Prozent der Patienten waren sich Betroffene und Therapeuten einig, dass sie nicht ernsthaft litten. Warum die nicht längst nach Hause geschickt oder gar nicht erst aufgenommen worden waren, erschließt sich aus der Veröffentlichung nicht.
DOI: 10.1055/a-0853-1762