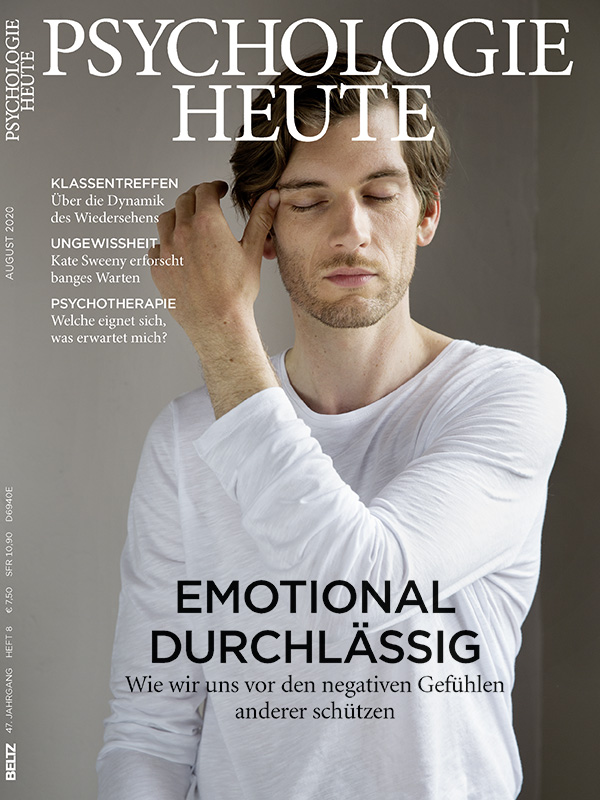Das Paar hat per E-Mail ein Erstgespräch vereinbart. Meine Ansprechpartnerin ist die Ehefrau. Sie schreibt von einer ernsten Krise, eigentlich sei die Partnerschaft am Ende, aber eine Trennung komme wegen der gemeinsamen Tochter nicht infrage. Termine bitte in der Mittagszeit, da sei die Kleine im Kindergarten und sie könnten beide die Arbeit unterbrechen. Ihr Mann habe lange gezögert, Hilfe anzunehmen, alle Paare hätten gute und schlechte Zeiten. Aber auch er sehe ein, dass es so nicht weitergehen könne.…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
Zeiten. Aber auch er sehe ein, dass es so nicht weitergehen könne. Ich notiere also einen Mittagstermin für Merve und Volker K. in meinen Kalender.
Sie kommen sehr pünktlich, beide um die vierzig, schlank, gut gekleidet, sehr ernst und sehr höflich. Sie fragen, ob sie die Schuhe ausziehen sollen, was ich verneine, und loben die Praxislage in einem Altbau. „Sie sind beide berufstätig?“ Die Frau antwortet: „Ja, wir teilen uns Berufs- und Kinderarbeit, das klappt auch gut. Ich bin selbständige Krankengymnastin, er ist in der IT-Branche, wir können uns beide die Arbeit einigermaßen einteilen. Das ist nicht unser Problem.“
„Seit wann kennen Sie einander?“, frage ich. Sie druckst ein wenig, er ergreift das Wort. „Noch nicht so lange. Knapp fünf Jahre. Über ein Internetportal. Wir wollten beide Kinder, waren spät dran und waren auch sehr froh, als es geklappt hat. Paula ist toll!“ Er strahlt. „Finde ich auch“, sagt sie. „Aber wenn du mich einmal so anstrahlen würdest wie Paula!“ „Immer diese Vorwürfe“, sagt er gereizt. „Paula sagt auch nicht, dass sie neben mir emotional verhungert!“ „Aber wenn es wahr ist!“
Der Vater? Ein Kümmerer
Auf jeden Fall macht dieses Paar keine Umwege, um zum Punkt zu kommen. Ich würdige ihr elterliches Engagement: „Ich sehe, dass Sie sich beide über das Kind gefreut haben, und es ist doch auch sehr positiv, dass sie so engagierte Eltern sind und sich die Arbeit teilen!“ Dann stelle ich die klassische Frage: „Wann haben die Spannungen angefangen?“
Jetzt meldet sie sich wieder: „Ich finde ja auch, dass Volker ein guter Vater ist. Aber er ist ein Kümmerer. Angefangen hat es damit, dass sein Bruder krank wurde, der schon immer schwierig war. Zu allem, was Volker sonst schon zu tun hatte, hat er dann auch noch die Verantwortung für seinen Bruder übernommen.“ „Es ist kein Geheimnis, dass sich die amtlichen Betreuer kaum kümmern“, setzt jetzt Volker wieder ein. „Mein Bruder war manisch-depressiv, er konnte nicht für sich sorgen, meine Eltern sind beide verstorben, ich musste es machen.“
„Ein Jahr war Volker fast jede Woche dort. Und immer völlig fertig, wenn er zurückkam. Mich hat er nicht mehr angerührt, ich war total allein mit dem Kind. Und was hat es gebracht? Am Ende hat sich der Bruder umgebracht!“ „Das tut mir sehr leid“, sage ich. „Schon gut“, sagt Volker. „Es war schlimm, aber der Psychiater hat gesagt, man kann Schwerkranken oft nicht helfen, er hat einfach keine Zukunft mehr für sich gesehen… Ich finde ja auch, dass Merve recht hat, ich war damals wirklich im Energiesparmodus unterwegs, es war einfach zu viel, ich hätte Ballast abwerfen müssen, wusste aber nicht, welchen. Im Beruf hatte ich gerade ein wichtiges Projekt angefangen – mein Bruder, Paula, Merve, die Beziehung… Aber wenn ich es jetzt wiedergutmachen will, dann klappt es nicht, Merve ist einfach immer unzufrieden, man kann ihr nichts recht machen.“
„Du freust dich nicht, wenn du mich siehst“
„Können Sie da eine konkrete Szene beschreiben?“ „Ich würde gerne Skifahren gehen. Merve kann mit meinem Sport nichts anfangen. Da habe ich angeboten, ich übernehme die Kleine ein Wochenende und sie kann machen, was sie will, Wellness oder so – und nächstes Wochenende tauschen wir dann, ich fahre ins Gebirge, und sie macht etwas mit Paula.“ Merve blickt noch etwas düsterer und sagt nichts.
„Sie hätten lieber etwas zusammen mit ihrem Mann gemacht?“ Sie nickt schwermütig. „Für meinen Mann bin ich ein Anhängsel an unsere Tochter. Er stellt sich seine Freizeit schöner vor ohne mich.“ „Das stimmt doch nicht. Du hast doch immer gesagt, dass es dir zu viel ist, immer allein für Paula zu sorgen. Aber wenn ich anbiete, sie dir ein ganzes Wochenende abzunehmen, damit du dich erholen kannst, ist es auch wieder nicht richtig.“ „Doch, schon, ich sehe ja, dass du dir Mühe gibst. Aber…“
Sie stockt. Eine Weile schweigen alle. Dann frage ich: „Sie wollten doch noch etwas sagen?“ „Ich meine … mir fehlt das einfach. Wissen Sie, mein Mann fasst mich nicht mehr an. Ich bin nicht attraktiv für ihn.“ „Das stimmt nicht“, sagt Volker. „Ich meine, damals, als ich so mit Scheuklappen unterwegs war, da konnte ich immer nur an die nächste Aufgabe denken. Ich finde dich attraktiv. Aber du bist immer so streng, und ich … ich denke, du freust dich nicht, wenn du mich siehst. Da kann ich dich doch nicht in den Arm nehmen.“
Die Ehe? Eine Elterngemeinschaft
„Es sieht so aus, als ob die einzige Person, die sich über einen Kontakt freut und auf die Sie zärtlich zugehen, Ihre Tochter ist“, sage ich. „In der Chemie nennt man das, glaube ich, Reduktion: Sie hat die ganze Freude an sich gezogen, für die Eltern ist nichts mehr übriggeblieben!“ „Aber ich will das nicht, ich halte das nicht aus!“, sagt Merve. Volker mustert mich. Ich frage mich, ob er sich damit abgefunden hat, dass seine Ehe zu einer Elterngemeinschaft geworden ist.
Ich finde solche Entwicklungen immer sehr traurig. Kinder aus solchen Ehen habe ich in Analysen kennengelernt und ihre Fantasien erforscht. Sie kreisen um das Rätsel, was die Eltern verbunden haben mag. Wird sich auch Paula irgendwann überlastet von der Aufgabe fühlen, der Glücksbringer für ihre aneinander freudlos gewordenen Eltern zu sein? Aber wie soll ich das dem Paar vermitteln, ohne meinerseits vorwurfsvoll zu wirken?
„Ich schlage vor, dass wir uns einige Male treffen, um herauszufinden, wo die Freude in ihrer Beziehung geblieben ist“, sage ich. Ich wende mich an Volker. „Wenn ich an Ihr Wochenendangebot denke, so haben Sie es sicher gut gemeint. Es hat doch nichts mit einem Fehler oder einer Schuld zu tun, wenn Ihnen der Glaube abhandengekommen ist, dass Ihre Frau gerne mit Ihnen zusammen ist und von Ihnen in den Arm genommen werden will. Es ist eigentlich nur schade und traurig, wenn Sie überzeugt sind, dass sie lieber allein in ein Wellnesshotel fährt, als Ihnen wieder näherzukommen. Sie brauchen beide auch mal eine paulafreie Zeit.“
Volker will es genau wissen: „Wäre dir das wirklich lieber gewesen?“ Merve errötet: „Muss ich das eigens sagen?“ Sie wendet sich an mich. „Daran müsste mein Mann doch von sich aus denken. Ich kann doch nicht bitten und betteln!“
Wünsche statt Vorwürfe
„Seine Wünsche klarzumachen hat mit Betteln nichts zu tun“, erkläre ich. „Natürlich sollten Sie das sagen! Sehen Sie, Paare müssen auf neue Art kommunizieren, wenn ein Kind kommt. Bisher haben Sie sich die Wünsche von den Augen abgelesen. Aber das Baby liest nichts, es schreit. Und da müssen die Eltern…“
„…auch schreien lernen“, setzt Merve hinzu. „Leicht fällt mir das nicht.“ „Und mir erst recht nicht“, ergänzt Volker. „Aber ich sehe ein, dass es richtig gewesen wäre, Merve ein gemeinsames Wochenende ohne Kind anzubieten. Ich müsste doch selbst auf solche Ideen kommen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe!“ Mich trifft ein kritischer Blick. „Bei Ihnen hört sich das so leicht an.“
Ich denke an Volkers Trauma durch den Selbstmord seines Bruders. Er hat recht – ich rede mich leicht, ich habe das nicht durchmachen müssen. Mir fällt ein, was ich einmal bei Freud in einem Aufsatz über Trauer und Melancholie gelesen habe: Um einen geliebten Menschen kann ich trauern, aber wenn es eine Hassliebe war, fällt ein Schatten auf das Ich. Der Tote wird zum Gespenst, das den Lebenden die Freude verbietet. Brüder sind zur Liebe verpflichtet, aber meist sind auch Rivalität und unbewusste Aggression im Spiel.
„Sie haben recht“, entgegne ich. „Zugegeben, ich rede mich leicht. Aber deshalb muss ja nicht falsch sein, was ich sage.“ Volker lächelt ein wenig. Wir vereinbaren erst einmal fünf Sitzungen; dann wollen wir eine Auswertung machen und besprechen, wie es weitergeht.
Wolfgang Schmidbauer arbeitet als Psychoanalytiker, Paar- und Familientherapeut und Autor in München. Sein neues Buch Du bist schuld! Zur Paaranalyse des Vorwurfs erscheint dieser Tage bei Klett-Cotta