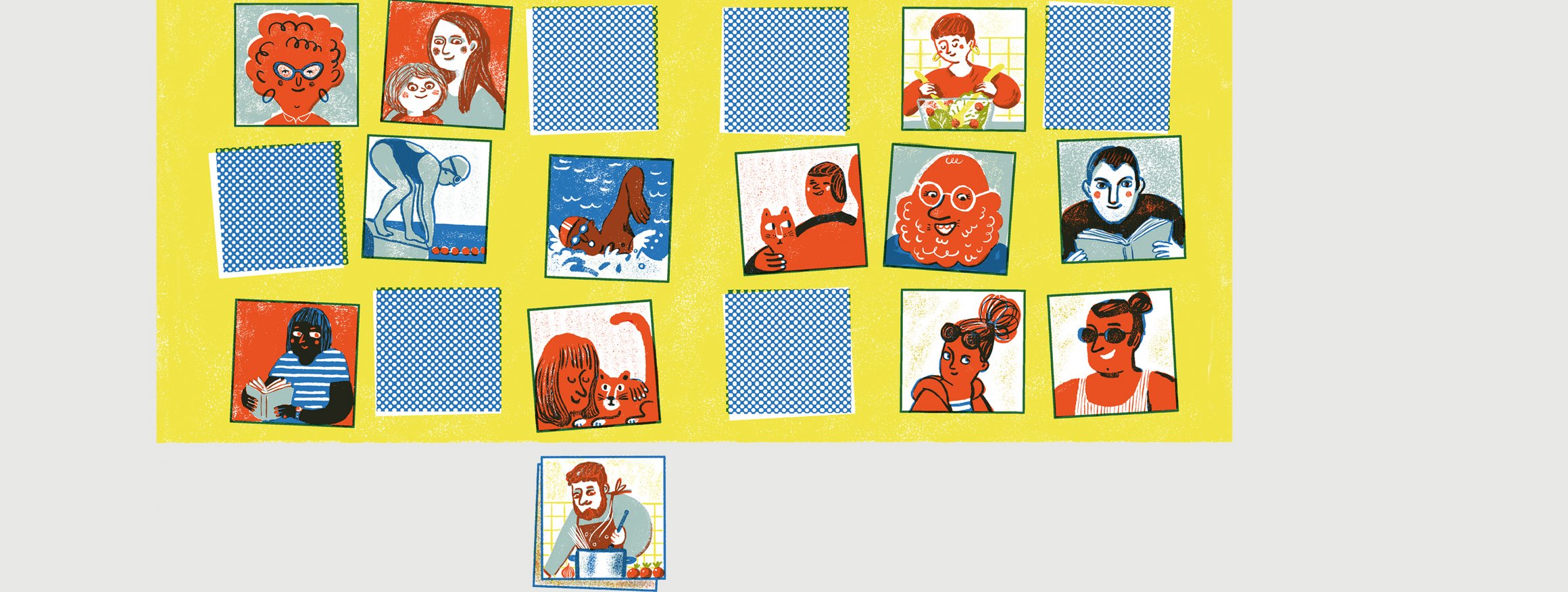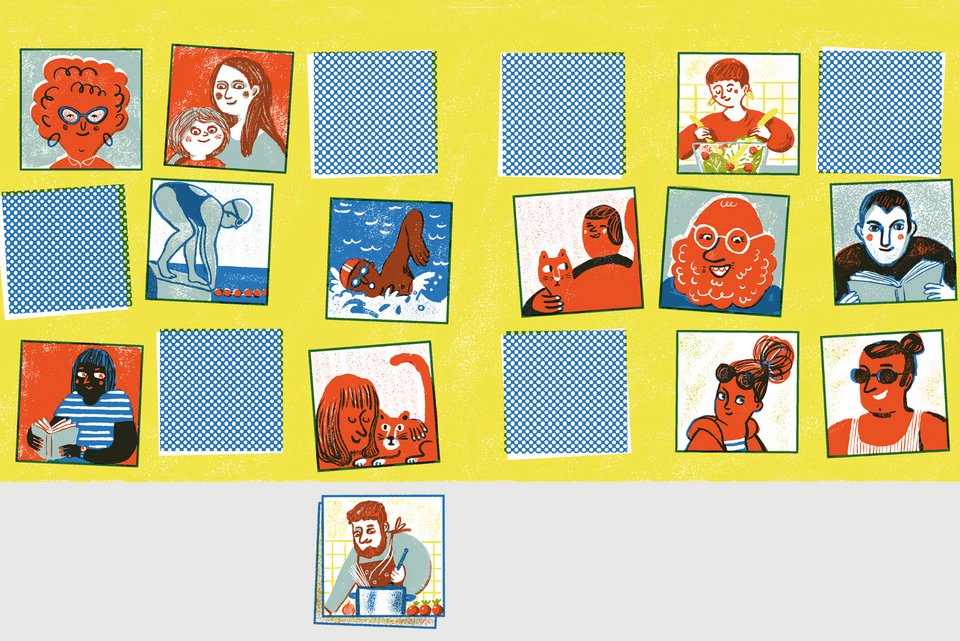Im September 2008 fiel in Deutschland der Startschuss zu einer aufwendigen Langzeitstudie. Die mehr als 12000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren nach dem Zufallsprinzip ausgewählt worden; sie stammten aus sämtlichen Ecken Deutschlands. Jahr für Jahr beantworten sie seitdem einen umfangreichen Fragenkatalog, unter anderem zu ihrer Persönlichkeit. Außerdem geben sie an, ob sie gerade liiert sind. Ihre Partnerin oder ihr Partner wird dann gegebenenfalls gebeten, ebenfalls einen Persönlichkeits-Fragebogen…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
Partnerin oder ihr Partner wird dann gegebenenfalls gebeten, ebenfalls einen Persönlichkeits-Fragebogen auszufüllen.
Immer wieder der gleiche Typ
Eigentliches Ziel der Studie ist, genauer zu verstehen, wie sich Paarbeziehungen über verschiedene Lebensphasen hinweg entwickeln. Die Sozialpsychologin Yoobin Park von der University of California hat die Daten jedoch zu einem anderen Zweck genutzt: Sie wollte wissen, ob wir uns bei der Partnerwahl immer wieder von denselben Eigenschaften angezogen fühlen. Ob es also so etwas wie einen spezifischen Typ gibt, auf den wir stehen: etwa den sensiblen Künstler, die organisierte Macherin oder den zielstrebigen Sportler, auf die wir uns immer wieder einlassen? Wenn dem so wäre, müssten sich in der Reihe unserer Liebschaften Gemeinsamkeiten feststellen lassen. Und dem scheint tatsächlich so zu sein, wie ihre Untersuchung aus dem Jahr 2019 belegt.
Darin hatte sich die Wissenschaftlerin, die damals an der University of Toronto arbeitete, die Befunde aus Deutschland genauer angeschaut. Viele Teilnehmende waren im Laufe der Jahre mehrere Beziehungen eingegangen. Die Sozialpsychologin untersuchte, wie sehr sich die Persönlichkeitsprofile der Lebensgefährtinnen und -gefährten glichen. Tatsächlich stieß sie bei der Analyse der Fragebögen auf deutliche Übereinstimmungen: Verflossene und aktuelle Partner hatten demnach ein vergleichbares Naturell. So trafen sich Personen, deren Ex kontaktfreudig und freundlich war, aber ständig zu spät kam, nach Bruch der Beziehung tendenziell wieder mit jemandem, der diese Eigenschaften hatte. „Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass wir bei der Partnerwahl relativ stabile Vorlieben für bestimmte Wesenszüge haben“, fasst Park zusammen.
Die ideal Partnerin
Für viele Menschen mag das nicht sonderlich überraschend sein. Die meisten von uns haben eine ziemlich genaue Vorstellung davon, mit wem sie am liebsten ihre Zweisamkeit genießen würden – wie groß der geliebte Mensch sein sollte, wie ehrgeizig, wie intelligent; ob lieber sportlich oder Bewegungsmuffel, Klassikliebhaberin oder Technofan, Veganer oder Fleischesserin. Kurz: wie unsere Partnerin idealerweise sein sollte. Und es gibt Hinweise, dass diese Präferenzen über Jahre hinweg einigermaßen konstant bleiben.
Einer der Hinweise stammt von den deutschen Psychologinnen Julie Driebe, Julia Stern und Tanja Gerlach sowie ihrem Kollegen Lars Penke. Penke hatte bereits 2006 in einer Studie untersucht, welche Beziehungen sich nach einer Speeddatingveranstaltung bilden und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Dabei hatten die Versuchspersonen unter anderem für 58 Eigenschaften angegeben, wie wichtig ihnen diese seien. Darunter waren Punkte wie Attraktivität, Treue, Humor, Selbstbewusstsein oder auch der Wunsch nach Kindern.
Dreizehn Jahre später nahmen die Forschenden nochmals zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Kontakt auf. Sie legten ihnen dieselbe Liste von Eigenschaften wie damals beim Speeddating vor. Das Ergebnis: Die Vorlieben der Befragten hatten sich in dieser langen Zeitspanne kaum geändert. Von welchen Menschen wir uns angezogen fühlen, scheint also ziemlich stabil zu sein. „Gerade die Priorisierung – welche Eigenschaft ist besonders wichtig, welche weniger ausschlaggebend – ist unseren Daten zufolge erstaunlich konsistent“, betont die Psychologin Gerlach.
Vorlieben in unser Erbgut eingraviert
Doch wodurch entscheidet sich, auf welchen Typ wir genau stehen? Wie entstehen unsere Präferenzen? Die Forschung zeigt, dass dabei ganz unterschiedliche Mechanismen eine Rolle spielen. So gibt es Eigenschaften, die sich fast jeder an seinem Mr. Right oder seiner Mrs. Perfect wünscht. Dazu zählt etwa ein gutes Aussehen. Männer messen einem hübschen Gesicht und attraktiven Körper Studien zufolge zwar etwas größeren Wert bei als Frauen, doch gänzlich unwichtig ist dieser Faktor auch für das weibliche Geschlecht nicht.
Zudem liegt Schönheit wohl nicht allein im Auge des oder der Betrachtenden: So ticken Menschen rund um den Globus in diesem Punkt ziemlich ähnlich, wie schon eine ältere Studie von 1995 bestätigte. Die Forschung kennt inzwischen eine Reihe von Merkmalen, die von den meisten Befragten als attraktiv empfunden werden: bei Frauen beispielsweise eine schmale Taille und breite Hüften. Bei Männern ein V-förmiger Oberkörper. Ein glatter, makelloser Teint. Vermutlich haben sich diese Vorlieben im Laufe der Evolution in unser Erbgut eingraviert. Denn sie signalisieren Jugend und Gesundheit – also Eigenschaften, die für eine erfolgreiche Fortpflanzung wichtig sind.
Gleich und gleich
Neben diesen universellen Präferenzen gibt es aber auch noch solche, in denen wir uns unterscheiden: Die einen mögen schwarze Haare mehr, die anderen rote. Manche finden einen schlanken Körper attraktiv, andere eher eine mollige Statur. Ein Teil bevorzugt ruhige Zeitgenossen, ein anderer extravertierte. Die Sorte Mensch, auf die wir stehen, ist also tatsächlich ein Stück weit individuell. Für die Frage nach dem Ursprung dieser ganz persönlichen Vorlieben gibt es verschiedene Hypothesen. Die erste davon lässt sich mit dem Satz „Gleich und Gleich gesellt sich gern“ zusammenfassen.
In der Wissenschaft spricht man von Homogamie oder positiver assortativer Paarung. Gemeint ist damit dasselbe: Wir bevorzugen Liebespartnerinnen, die uns gleichen – die aus derselben sozialen Schicht stammen wie wir, in etwa genauso intelligent sind, vergleichbare Interessen haben und ähnlich gut aussehen. Ein Grund dafür ist vermutlich, dass Beziehungen stabiler sind, wenn sich die Unterschiede zwischen den Beteiligten in Grenzen halten.
Die Augenfarbe ihres Vaters, die Haarfarbe seiner Mutter
Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Erklärungen, warum uns bestimmte Eigenschaften besonders wichtig sind. So scheinen wir uns bei der Wahl unserer Lebensgefährten auch daran zu orientieren, wie sehr diese unseren Eltern im Äußeren gleichen. Als Mann fühlen wir uns demnach zu Partnerinnen hingezogen, die unserer Mutter ähneln; als Frau bevorzugen wir Partner, die uns an unseren Vater erinnern. Forschende sprechen in diesem Zusammenhang von Prägung: Wir erlernen in unserer Kindheit durch den Kontakt zu dem gegengeschlechtlichen Elternteil unsere Präferenzen – welche Augen- oder Haarfarbe uns also etwa besonders anspricht oder welche Stimmlage und Statur wir attraktiv finden. Diese Vorlieben behalten ihren Einfluss dann während unseres kompletten Erwachsenenlebens.
Unter anderem hat die italienische Wissenschaftlerin Paola Bressan dazu vor einigen Jahren eine Studie veröffentlicht. Basis bildete eine Stichprobe von über eintausend Frauen. Bressan konnte zeigen, dass diese auf die Augenfarbe ihrer Väter geprägt waren: Sie fühlten sich besonders zu Männern hingezogen, deren Augen dieselbe Farbe hatten.
Eltern als Erfolgsmodell
Eine mögliche Erklärung ist, dass unsere Eltern schon bewiesen haben, dass sie überlebensfähig und evolutionär insofern ein Erfolgsmodell sind. Außerdem tendieren wir dazu, uns bei der Bewertung eines Menschen von unseren Vorerfahrungen leiten zu lassen. Mal angenommen, wir lernen auf einer Party jemanden kennen, der uns an einen guten Freund erinnert. Dann ist uns diese Person häufig auf Anhieb sympathisch. Umgekehrt empfinden wir dem Doppelgänger unseres Erzfeindes gegenüber direkt eine starke Abneigung. In der Psychologie wird das als Transferenz bezeichnet. Zu dieser Interpretation passt auch eine weitere Beobachtung Bressans: Frauen, die sich in ihrer Kindheit von ihrem Vater abgelehnt gefühlt hatten, orientierten sich bei der Suche nach ihrem Traumtypen nicht an der väterlichen Augenfarbe. Analoges galt für Männer – der Ähnlichkeitseffekt ließ sich bei ihnen nur feststellen, wenn ihre Beziehung zur Mutter gut war.
Liebe durch Vertrautheit
Dass wir immer wieder auf den gleichen Typ abfahren, könnte aber noch einen anderen Grund haben: Wir scheinen einfach Menschen zu mögen, die uns vertraut sind. Ein klassisches Beispiel dafür zeigt eine Studie an der University of Pittsburgh. Der Psychologieprofessor Richard Moreland und sein Mitarbeiter Scott Beach hatten darin vier junge Frauen gebeten, sich als Studentinnen auszugeben. Die vier waren in einem Vortest als ähnlich gutaussehend bewertet worden. In dem eigentlichen Experiment nahmen sie an Psychologie vorlesungen teil. Sie erschienen aber unterschiedlich oft – zu keiner, fünf, zehn oder 15 Sitzungen. Danach verließen sie den Saal sofort wieder; sie hatten also keinen direkten Kontakt zu den anderen Studierenden. Dennoch hatte allein die Zahl ihrer Vorlesungsbesuche einen Einfluss darauf, wie sie von ihren insgesamt 130 Kommilitoninnen und Kommilitonen wahrgenommen wurden: Je häufiger sie dort gewesen waren, desto höhere Attraktivitätsnoten ernteten sie.
Dieser sogenannte mere exposure effect (der englische Begriff bedeutet so viel wie „bloßer Kontakt“) ist auch aus anderen Zusammenhängen bekannt: So mögen wir Songs oft umso mehr, je öfter wir sie hören. Möglicherweise trägt er ebenfalls dazu bei, dass wir nach einer zerbrochenen Beziehung wieder Partner bevorzugen, die unserer oder unserem Ex ähneln – einfach, weil sie uns vertraut erscheinen. Wie groß die Rolle ist, die dieser Mechanismus bei der Entstehung unserer romantischen Präferenzen spielt, lässt sich allerdings nicht sagen.
Klar ist jedoch, dass unsere Vorerfahrungen einen Einfluss darauf haben, mit wem wir zusammenkommen und mit wem nicht. Und gerade wenn wir das Gefühl haben, in Beziehungen immer wieder dasselbe schlechte Händchen zu haben, lohnt es sich, genauer hinzuschauen – und uns schon bei bei den ersten Dates zu fragen: Mögen wir wirklich unser Gegenüber oder nur das vertraute Gefühl, das es auslöst? So können wir uns womöglich von diesen subtilen Effekten etwas frei machen.
So entscheidend ist unser Idealbild gar nicht
Doch wie sehr beeinflussen unsere Vorlieben tatsächlich, mit wem wir am Ende eine Beziehung eingehen? Die Wissenschaftlerin Tanja Gerlach ist auch dieser Frage nachgegangen: Zusammen mit einem Forschungsteam befragte sie insgesamt 763 Singles zwischen 18 und 40 Jahren. Sie sollten angeben, wie wichtig ihnen Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Attraktivität, Humor und beruflicher Erfolg waren. Fünf Monate später befand sich ein gutes Drittel der Teilnehmenden in einer Beziehung. Sie wurden gebeten, ihre Partnerin oder ihren Partner hinsichtlich derselben Charakteristika zu bewerten.„Tatsächlich zeigten sich dabei Überschneidungen zum anfangs erhobenen Idealbild“, sagt Gerlach.
Das sei aber noch kein sicherer Beweis, dass wir vor allem mit Personen zusammenkommen, die unserem Traumtyp entsprechen: „Ein Teil des Effektes könnte zum Beispiel darauf zurückgehen, dass wir unsere neuen Partner oder Partnerinnen so wahrnehmen, als seien sie so, wie wir es uns wünschen.“ Eventuell reden wir sie uns also auch etwas schön.
Der kalifornische Beziehungsforscher Paul Eastwick findet jedenfalls kaum Hinweise dafür, dass unsere Wunschvorstellungen – etwa vom sensiblen, rücksichtsvollen Mann oder der strukturierten, starken Frau – viel darüber aussagen, in wen wir uns im echten Leben wirklich verlieben. Er hat in den letzten Jahren die weltweit bislang umfassendste Untersuchung zur Wirkung von Präferenzen koordiniert, in insgesamt 43 Ländern rund um den Globus. Die Ergebnisse sind gerade erschienen. Unsere persönlichen Vorlieben haben demnach zwar einen Einfluss – allerdings viel weniger, als wir denken. „Mal angenommen, vor Ihnen stehen zwei Menschen, die beide Eigenschaften mitbringen, die allgemein als begehrenswert gelten“, verdeutlicht der Wissenschaftler. „Der eine entspricht genau Ihrem Idealtypus, der andere dagegen nicht. Dann werden Sie unseren Daten zufolge nur in rund 56 Prozent der Fälle denjenigen bevorzugen, der passt. Das ist mehr, als bei einer Zufallsentscheidung zu erwarten wären, aber kein riesiger Effekt.“
„Unsere Umwelt beschränkt unsere Wahlmöglichkeiten“
Doch wie passen dazu die Ergebnisse der Psychologin Yoobin Park, dass sich unsere aktuellen und verflossenen Liebschaften hinsichtlich ihrer Persönlichkeit gleichen? Sie sprechen zwar dafür, dass unsere Vorlieben eine gewisse Rolle spielen könnten, „sind aber kein Beweis, dass wir unsere Lebensgefährtinnen oder -gefährten gezielt danach aussuchen“, betont Park. Ihre Befunde ließen sich nämlich genauso durch einen ganz anderen Mechanismus erklären, sagt sie: Nämlich die Tatsache, dass im Umfeld eines Menschen ein bestimmter Personenschlag einfach besonders häufig vorkomme.
Mal angenommen, Anton lebt in einem tiefkatholischen Dorf in Westfalen, in dem der wöchentliche Kirchgang zum Alltag gehört. Seine aktuelle Freundin Greta ist praktizierende Katholikin, seine Ex Jenny ebenfalls. Er hatte also zwei Partnerinnen, die sich in diesem Punkt gleichen. Aber vielleicht nicht, weil Anton es so wichtig findet, dass seine Lebensgefährtinnen religiös sind. Sondern einfach, weil in seiner Umgebung eben viele Katholikinnen leben.
„Unsere Umwelt beschränkt unsere Wahlmöglichkeiten“, so die Sozialpsychologin. „Und das beeinflusst natürlich, mit wem wir zusammenkommen.“ Die Ergebnisse ihrer Studie könnten durch solche Effekte mit verursacht worden sein. Denn es sprächen doch auch gute Gründe dafür, nicht immer mit Menschen mit derselben Persönlichkeit anzubandeln. „In der Psychologie gibt es die Idee, dass man aus schlechten Erfahrungen lernt“, sagt sie. „Wenn dem so ist, sollten wir dann nicht nach einer zerbrochenen Beziehung erst recht jemand anderes wählen?“
Tatsächlich gibt es in der Analyse von Tanja Gerlach zur Stabilität unseres Typs Befunde, die sich in diese Richtung deuten lassen: Denn die Befragten, die im Laufe der dreizehn Jahre mehrere Beziehungen gehabt hatten, legten bei der zweiten Befragung mehr Wert auf Wärme und Vertrauenswürdigkeit als bei der Eingangserhebung ein gutes Jahrzehnt zuvor. Bei Versuchspersonen mit nur einer Beziehung zeigte sich in diesem Punkt dagegen keine signifikante Änderung. „Wenn mehrere Partnerschaften in die Brüche gegangen sind, lernt man vielleicht aus dieser Erfahrung, wie wichtig Vertrauenswürdigkeit ist“, sagt Gerlach. „Die Vorlieben können sich dadurch also möglicherweise ändern – zumindest lassen sich die Ergebnisse so lesen.“
Die Resultate basieren allerdings auf kleinen Fallzahlen und sind daher mit etwas Vorsicht zu genießen. Und dennoch machen sie Hoffnung: Wer immer wieder mit dem unverbindlichen Chaoten oder der unerreichbaren Perfektionistin an seine Grenzen gekommen ist, ist nicht dazu verdammt, dabei zu bleiben. Wenn wir uns unsere vermeintlichen Vorlieben und die dahinterliegenden Phänomene bewusstmachen, können wir beim nächsten Mal neue Prioritäten setzen – und selbst unserem Typ entkommen.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback! Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.
Quellen
Paul W. Eastwick u. a.: A worldwide test of the predictive validity of ideal partner preference matching. Journal of Personality and Social Psychology, 128/1, 2025, 123–146
Yoobin Park, Geoff MacDonald: Consistency between individuals’ past and current romantic partners’ own reports of their personalities. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116/26, 2019, 12793–12797
Paola Bressan: In humans, only attractive females fulfil their sexually imprinted preferences for eye colour. Scientific Reports, 10/1, 2020, 1-10
Tanja M. Gerlach u. a.: Predictive validity and adjustment of ideal partner preferences across the transition into romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 116/2, 2019, 313–330
Zuzana trbová u. a.: Consistency of mate choice in eye and hair colour: testing possible mechanisms. Evolution and Human Behavior, 40/1, 2019, 74–81
Melinda Williams, Danielle Sulikowski: Implicit and explicit compromises in long-term partner choice. Personality and Individual Differences, 166, 2020, 110226
Jehan Sparks u. a.: Negligible evidence that people desire partners who uniquely fit their ideals. Journal of Experimental Social Psychology, 90, 2020, 103968
Katelin E. Leahy, William J. Chopik: Proof of concept and moderators of transference processes in an online setting. Collabra: Psychology, 7/1, 2021, 1-18
Tamas Bereczkei u. a.: Sexual imprinting in human mate choice. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 271/1544, 2004, 1129–1134
Julie C. Driebe u. a.: Stability and change of individual differences in ideal partner preferences over 13 years. Personality and Social Psychology Bulletin, 50/8, 2024, 1263–1279
Michael R. Cunningham u. a.: „Their ideas of beauty are, on the whole, the same as ours“: consistency and variability in the cross-cultural perception of female physical attractiveness. Journal of Personality and Social Psychology, 68/2, 1995, 261–279
Sybil A Streeter, Donald H McBurney: Waist–hip ratio and attractiveness: new evidence and a critique of “a critical test”. Evolution and Human Behavior, 24/2, 2003, 88–98
Anthony E. Coy u. a.: Why is low waist-to-chest ratio attractive in males? the mediating roles of perceived dominance, fitness, and protection ability. Body Image, 11/3, 2014, 282–289
Guy Madison, Gunilla Schiölde: Repeated listening increases the liking for music regardless of its complexity: implications for the appreciation and aesthetics of music. Frontiers in Neuroscience, 11, 2017, 1-13
Richard L Moreland, Scott R Beach: Exposure effects in the classroom: the development of affinity among students. Journal of Experimental Social Psychology, 28/3, 1992, 255–276