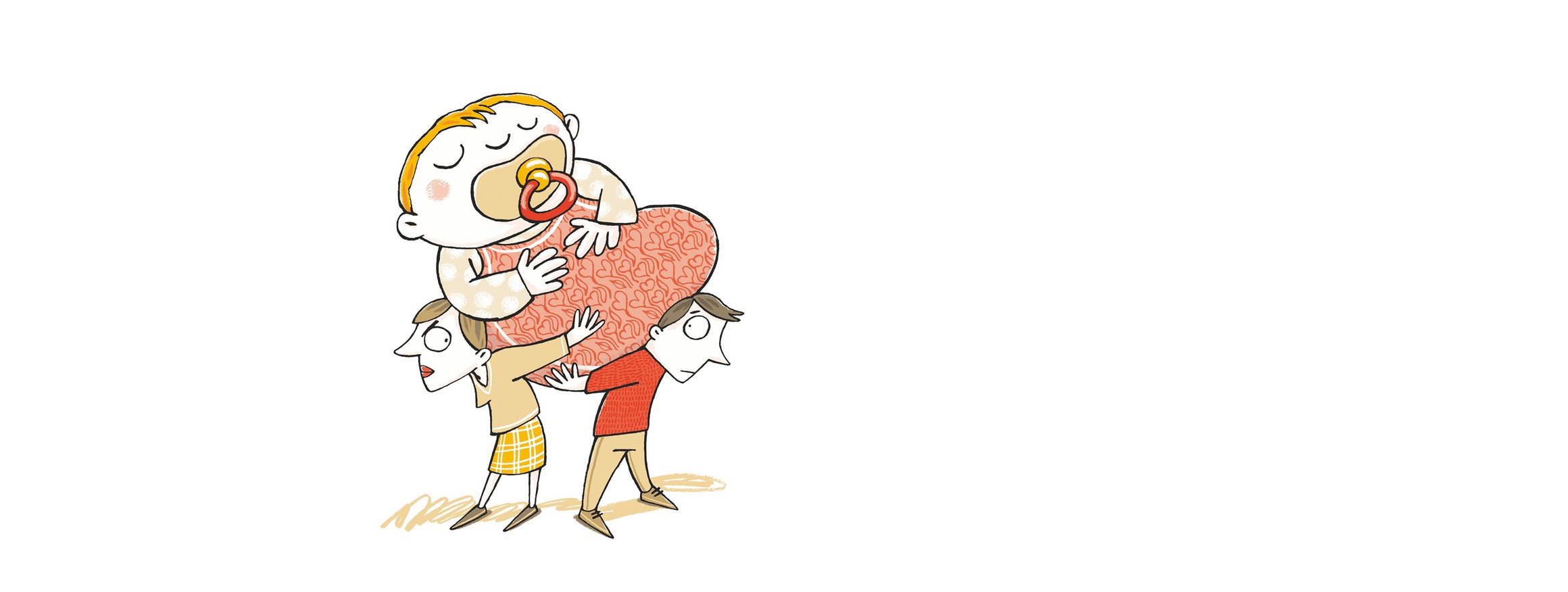Wenn nach acht Sitzungen ein Paar händchenhaltend schweigt und die Frage: „Hast du etwas?“, mit einem liebevollen Blick und: „Eigentlich nicht, und du?“, beantwortet wird, worauf erst einmal alles still ist, und wenn am Ende der Sitzung beschlossen wird, die Paartherapie probeweise zu beenden, dann ist das kein typisches Ergebnis. Aber Erfolge sind ebenso lehrreich wie Misserfolge, deshalb hier ein Bericht, was in dieser Therapie geschehen ist. Jedenfalls hätte ich diesen Ausgang nicht erwartet, als ich die…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
was in dieser Therapie geschehen ist. Jedenfalls hätte ich diesen Ausgang nicht erwartet, als ich die beiden vor vier Monaten im Erstgespräch sah. Sie standen kurz vor der Trennung, an erotische Nähe war seit Monaten nicht mehr zu denken, nach wenigen Gesprächsminuten flossen ihre Tränen, sein Gesicht versteinerte.
„Ich halte mich selbst nicht aus und ihn auch nicht“
Maria* ist an die vierzig, brünett, mit großen grauen Augen und einem schmerzlichen Zug um den Mund. Es sprudelt aus ihr heraus: „Es ist mir alles zu viel, ich schimpfe nur noch herum, ich bin so unbeherrscht, ich schreie meinen Mann an und die Kinder, ich halte mich selbst nicht aus und ihn auch nicht! Er sitzt dann immer da wie jetzt auch und hilft mir überhaupt nicht, mich wieder einzukriegen. Ich will dann nur noch weg, ich empfinde nichts mehr für ihn.“
Richard* ist dunkelhaarig, schlank, und blickt ratlos auf seine Frau. „Ich tue, was ich kann, für die Familie. Aber es ist Maria nicht recht zu machen! Wenn sie mit unserem Sohn streitet, und ich sage nichts, dann lasse ich sie im Stich. Wenn ich mich einmische und versuche, ihn zur Vernunft zu bringen, dann bin ich übergriffig und will zeigen, wie viel besser ich mit ihm umgehen kann.“
So kurz wie möglich, so lang wie nötig
Wenn ein Paar sich nach dem gemeinsamen Erstgespräch für eine Therapie entscheidet, vereinbare ich immer zwei Einzelsitzungen, zehn Sitzungen zu dritt und eine Auswertung. Ein Dritter sollte sich so kurz wie möglich, so lange wie nötig in die Paardynamik einmischen. In den Einzelgesprächen untersuche ich die Ehe der Eltern, die Geschwisterdynamik, die jugendliche Suche nach beruflicher Identität und was aus ihr geworden ist, sowie die eigene Einschätzung des Ehekonflikts.
Richard erzählt, dass er Maria während eines Marathonlaufs kennengelernt hat. Ihretwegen hat er seine Bestzeit nicht mehr steigern können, sie sind die letzten Kilometer zusammengelaufen. Sie waren sehr verliebt und seither eigentlich unzertrennlich. Richard kommt aus einer Arbeiterfamilie, er hat eine sehr dominante Mutter, die auch durchgesetzt hat, dass ihr Erstgeborener studierte. Gegenüber dem streng religiösen, engen Elternhaus fühlte er sich im Gymnasium befreit und wollte Lehrer werden. Gegenwärtig arbeite er voll, Maria habe reduziert; seit dem zweiten Kind sei sie sehr erschöpft, schlecht gelaunt, der Haushalt sei ihr zu viel, er helfe, wo er könne, aber das mache Maria nicht zufriedener.
Auch Maria glaubt, dass die Ehekrise mit dem zweiten Kind begonnen hat: „Ich war glücklich mit Richard, wir haben alles zusammen gemacht, auch als wir unsere Tochter hatten, es war so viel Liebe da. Dann wollten wir noch ein Kind. Schon als ich schwanger war, musste ich immer weinen. Ich dachte, ich schaffe das nicht, ich habe nicht so viel Liebe, und ich kann sie doch nicht der Ersten wegnehmen. Richard hat mich nicht verstanden.“
Das Wort verstehen macht mich hellhörig. Wenn Menschen zusammenarbeiten, müssen sie sich verständigen. Die Erwartung, Liebe verpflichte zu wissen, wie sich das Gegenüber fühlt, ist riskant und gibt Anlass zu Streitigkeiten. Einer der gefährlichsten Sätze in der Paarkommunikation ist: „Du weißt doch genau!“ Er fällt, wenn mir etwas wichtig ist, ich überzeugt bin, es mitgeteilt zu haben – und mein Gegenüber es ignoriert. In dem Vorwurf wird ein Sehnsuchtsmodell aktiv, in dem alle Wünsche, einmal gesagt, dauerhaft erfüllt werden. „Du weißt doch genau, dass ich es nicht ertrage, wenn deine Haare im Waschbecken liegen!“ „Du weißt doch genau, dass ich allergisch auf Erdbeeren reagiere, jetzt hast du schon wieder welche zum Nachtisch gekauft!“
Wer verständlich machen will, was ihm wichtig ist, muss damit rechnen, dass er sozusagen auf einem bereits vielfältig beschriebenen Papier eine neue Botschaft notiert. Daher ist es bei Störungen viel hilfreicher, Unterschiede zu klären als die Kränkung zu pflegen, unverstanden zu sein.
Sie wollen mehr Geschichten aus der Therapiestunde als Buch lesen?
Die 50 besten Therapiestunde-Kolumnen, die in den letzten Jahren an dieser Stelle erschienen sind, versammelt das Buch „Wenn Sie wüssten, wie ich wirklich bin“. Therapeuten erzählen aus ihrer Praxis, das aktuell bei Beltz erschienen ist (272 S., € 20,–)
Maria hat seit der Geburt des zweiten Kindes viele Eindrücke gesammelt, dass Richard ihre Überlastung nicht versteht und im Grunde denkt, sie sei faul und ungeschickt, wie sie das oft von ihrer Mutter hörte.
In der paaranalytischen Arbeit erkennt Maria, dass sie ihre perfektionistische Mutter auf Richard projiziert und ihm unterstellt, dass er sie faul und schlampig findet, wenn sie mit den Kindern ein Bilderbuch anschaut und die Küche chaotisch aussieht. Warum würde er sonst anfangen, aufzuräumen, kaum ist er nach Hause gekommen? Beiden wird bewusst, dass sie einander nicht mehr als Mann und Frau sehen, sondern eher als Haushaltsroboter und Erziehungsautomaten, die sich gegenseitig Druck machen, Höchstleistungen zu bringen.
Eine fröhliche Frau oder eine saubere Wohnung
Maria entdeckt, wie sie unter Richards emotionaler Abwesenheit leidet – und ahnt allmählich, dass gerade der Leistungsdruck, unter den sie sich und ihn setzt, ihn blockiert. Sie lächelt über meine Bemerkung zu Richard, dass es wichtiger ist, seine Frau zum Lachen zu bringen, als die Spülmaschine einzuräumen; Richard grinst, als ich sage, Maria denke wohl, dass ein blitzend sauberer Haushalt ihren Mann glücklicher machen würde als eine Frau, die ihn anstrahlt, wenn er nach Hause kommt.
Immer wieder gibt es Krisen und heftige Missverständnisse, weil Richard Konflikte zwischen den Kindern schlichten und Marias Position stärken möchte, während sie findet, dass sein Einmischen ihre Autorität untergräbt. Wir erarbeiten klare Absprachen. Wenn ein Elternteil Kinderdienst hat, hat der andere frei. Ein Zwischenbericht von Maria: Es geht uns viel besser, seit wir uns da loslassen. Richard macht jetzt wieder mehr Sport, das tut ihm gut, und mir auch.
Wann und wie der erotische Frost in der Ehe von Maria und Richard taute, habe ich nicht erfragt und nicht erfahren. Die beiden gingen fühlbar anders miteinander um, Maria flippte weniger aus, Richard war besser gelaunt und nicht mehr so verkniffen. Vielleicht war eine kleine Szene der Wendepunkt, von der Maria in der letzten Sitzung erzählte: Sie ist todmüde, schickt die Kinder in ihre Zimmer, legt sich aufs Sofa, schreckt hoch, als Richard nach Hause kommt, er legt sich stumm neben sie.
Konflikte sind nicht das einzige, was sich multipliziert
Andere Paare erholen sich nicht so schnell von der Krise durch das zweite Kind wie Maria und Richard. Sie wurzelt darin, dass die Eltern sich überschätzen. Sie haben die erste Geburt gemeistert! Jetzt können sie alles besser, es wird einfacher, die Erstgeborenen werden sich über eine Spielkameradin freuen. In Wahrheit multiplizieren sich nicht nur die Konflikte. Zwei Kinder sind längst nicht mehr so leicht mal bei Freunden zu parken wie eines. Und bisher haben sich die Eltern gegenseitig die Erlaubnis gegeben, mit ihrer neuen Rolle zu spielen und sie zu erproben. Jetzt ist die richtige Familie da, alles muss klappen.
Sicher hatte es geholfen, dass Maria schon einmal in Therapie war und Richard ihr die Treue hielt, als er monatelang kein gutes Wort von ihr bekam. Ich hatte wenig mehr getan, als beiden die Falle des Perfektionismus zu zeigen, in die sie geraten waren. Unter dem wechselseitigen Leistungsdruck, den Vorwürfen und Schuldgefühlen war die Liebe erhalten geblieben. Wenn Äste und Laub einen Bach stauen, müssen wir nicht alle Hindernisse hinwegräumen. Es genügt, wenn wir so viele entfernen, dass die Strömung den Rest bewältigen kann.
Wolfgang Schmidbauer arbeitet als Autor, Psychoanalytiker und Familientherapeut in München und ist Autor vieler Sachbücher, etwa Böse Väter, kalte Mütter? Warum sich Kinder schlechte Eltern schaffen (Reclam 2024)
* Persönliche Daten und alle Einzelheiten, welche das Paar erkennbar machen könnten, wurden verändert
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback! Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.