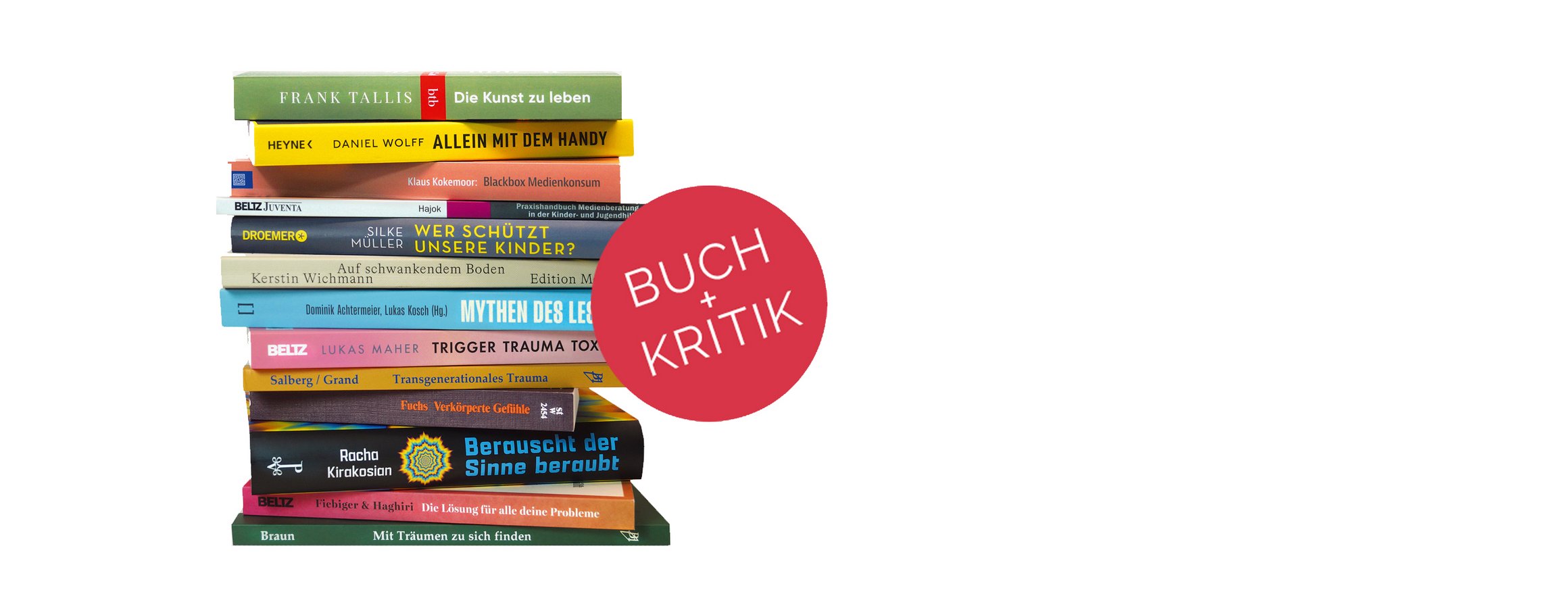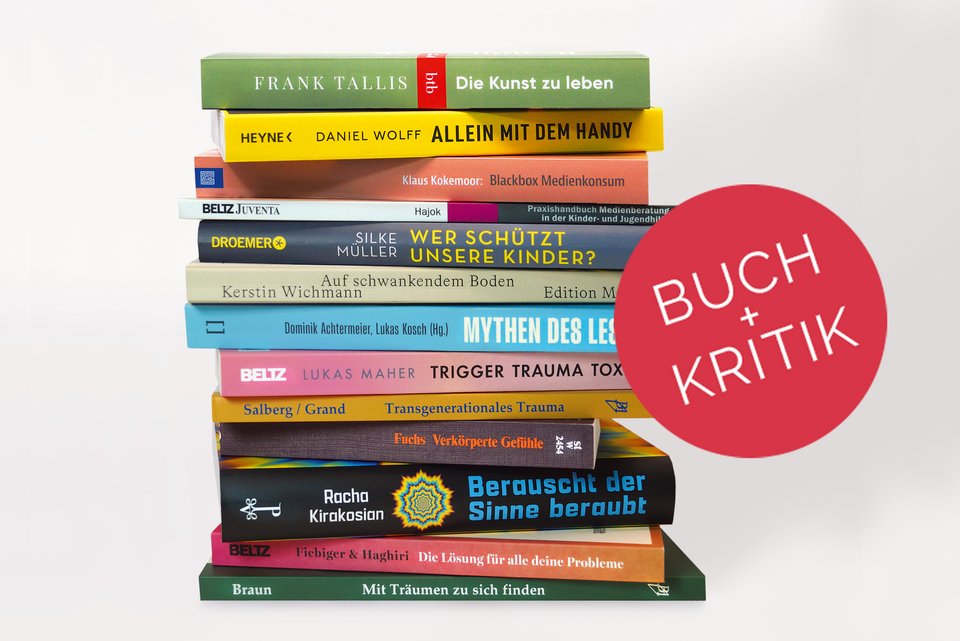Allzu euphorische Gemütszustände scheinen der psychologischen Forschung nicht geheuer zu sein. Wer auf PubPsych, der Suchmaschine für Psychologiepublikationen, den Begriff „Ekstase“ eingibt, kommt auf kümmerliche 85 Treffer, darunter kaum empirische Arbeiten. Zum Vergleich: „Angst“ bringt es auf 66.257 Einträge.
Jauchzende Euphorie, Visionen bis hin zur Auflösung von Zeit
Auch Racha Kirakosians neuem Buch wird wohl ein Eintrag in PubPsych verwehrt bleiben. Denn die Professorin für Mediävistik an der Universität Freiburg erkundet die Ekstase, „eine der ungreifbarsten Erfahrungen fühlender Lebewesen“, nicht aus psychologischer, sondern aus historischer Perspektive. Die akademische Kontaktscheu, so erfahren wir, rührt wohl von der Aufklärung her. Jauchzende Euphorie, Visionen, Weltentrückung bis hin zur Auflösung von Zeit und Ich – das war nicht der Stoff eines Weltbilds, das auf nüchterner Vernunft gründete.
In vorhergehenden Zeiten war das anders, schreibt die Historikerin. „In der Antike galten ekstatische Momente als Ereignisse, in denen der Mensch mit dem Göttlichen in Kontakt tritt.“ In der Ekstase, so Philon von Alexandria, vertreibe der göttliche Geist das menschliche Verständnis. Auch im Mittelalter galt nach Kirakosians Darstellung neben der Scholastik auch die Ekstase als gleichberechtigte „Modalität der Gotteserkenntnis“.
Das beglückende Gefühl, Teil einer Masse zu sein
Schon immer, angefangen beim Dionysoskult, waren bei ekstatischen Höhenflügen oft Rauschdrogen im Spiel, ebenso wie der Tanz – von den Sufi-Derwischen bis zur Love-Parade. Dort zeigt sich auch eine andere Zutat der Ekstase: das beglückende Gefühl, Teil einer Masse zu sein: im Fußballstadion, bei einem Ritus oder aber beim Reichsparteitag der Nazis. Das, so Kirakosian, ist „die dunkle Seite der Ekstase“.
Ein überraschender Weg zur Verzückung führt über den Schmerz. „Schmerz und Süße, Leid und Wonne … sind mitunter wie zwei Seiten einer Medaille“, schreibt die Autorin. Die glückseligen Visionen von Nonnen wie Christina von Hane oder Elsbeth von Oye waren begleitet von Askese und Selbstgeißelungen. Die Einstellung gegenüber solchen Frauen war höchst ambivalent: Sie wurden als Heilige verehrt oder als Hexen verfolgt. Die Frauen waren immer auch Zielscheibe männlicher Projektion: Bis hin zur Hysteriediagnose im 19. Jahrhundert unterstellte man ihnen fehlgeleitetes sexuelles Verlangen.
Racha Kirakosian schreibt elegant, kenntnisreich, sympathisch. Doch an manchen Stellen rutscht die Darstellung in die vorgestanzten Diskursschablonen des Zeitgeists – und damit vom Thema ab. Ein Beispiel: In einer spannenden Passage beleuchtet die Autorin Parallelen zwischen ekstatischen Zuständen und dem weltvergessenen Flow-Erleben, wie es der Psychologe Mihály Csìkszentmihályi beschrieben hat. Doch statt in diesem ergiebigen Feld weiterzuschürfen, verliert sich Kirakosian in einer seitenlangen Kritik an dümmlicher Flowvermarktung im Coaching. Korrekt! Aber auch: geschenkt!
Wenig Gnade kennt die Autorin gegenüber jedweder Stimme, die das ekstatische Treiben kritisch kommentiert. Ihr Bannstrahl trifft etwa den anglikanischen Kleriker Thomas Boone, der 1857 Zeuge einer methodistischen Erweckungszusammenkunft wird und entsetzt über „das wilde Geschrei, die wahnsinnigen Handlungen, das Tanzen und Springen“ berichtet. Prompt hält Kirakosian dem verschreckten Glaubensmann vor, er schmähe „nahezu zwanghaft ekstatische Tanzgebärden als verstörend“.
Bisweilen gönnt sich die Autorin eine Prise Ressentiment, etwa wenn sie auf die Arbeit eines Forschungsteams um Henry Spiller, John Hale und Jelle de Boer zu sprechen kommt. Sie wiesen in dem Gestein unter der Kultstätte von Delphi Spuren der Gase Methan, Ethan und Ethylen nach. Die Vermutung der Forscher: Die legendäre Pythia könnte bei ihren Orakeln unter dem Einfluss psychedelischer Ausdünstungen gestanden haben. Empört verwahrt sich Kirakosian gegen solcherlei „naturwissenschaftliche Kausalitätsmodelle“.
An anderer Stelle schlagen die Vorbehalte dann aber ins andere Extrem um: Die Weissagungen der Klimaforschung, so lesen wir, seien moderne „Weissagungen im basal religiösen Sinne“. Gütige Pythia, nein! Forschung ist keine Mystik – was der Mystik mitnichten ihre Existenzberechtigung abspricht.
Dessen ungeachtet: Berauscht der Sinne beraubt ist ein lesenswertes, streckenweise fesselndes Sachbuch mit dem Verdienst, ekstatische Phänomene in ihrem zeitlichen und kulturellen Umfeld zu beleuchten. Auf eine psychologische Darstellung, die das ekstatische Erleben selbst in den Fokus rückt, müssen wir indes noch warten.
Racha Kirakosian: Berauscht der Sinne beraubt. Eine Geschichte der Ekstase. Propyläen 2025, 416 S., € 28,–