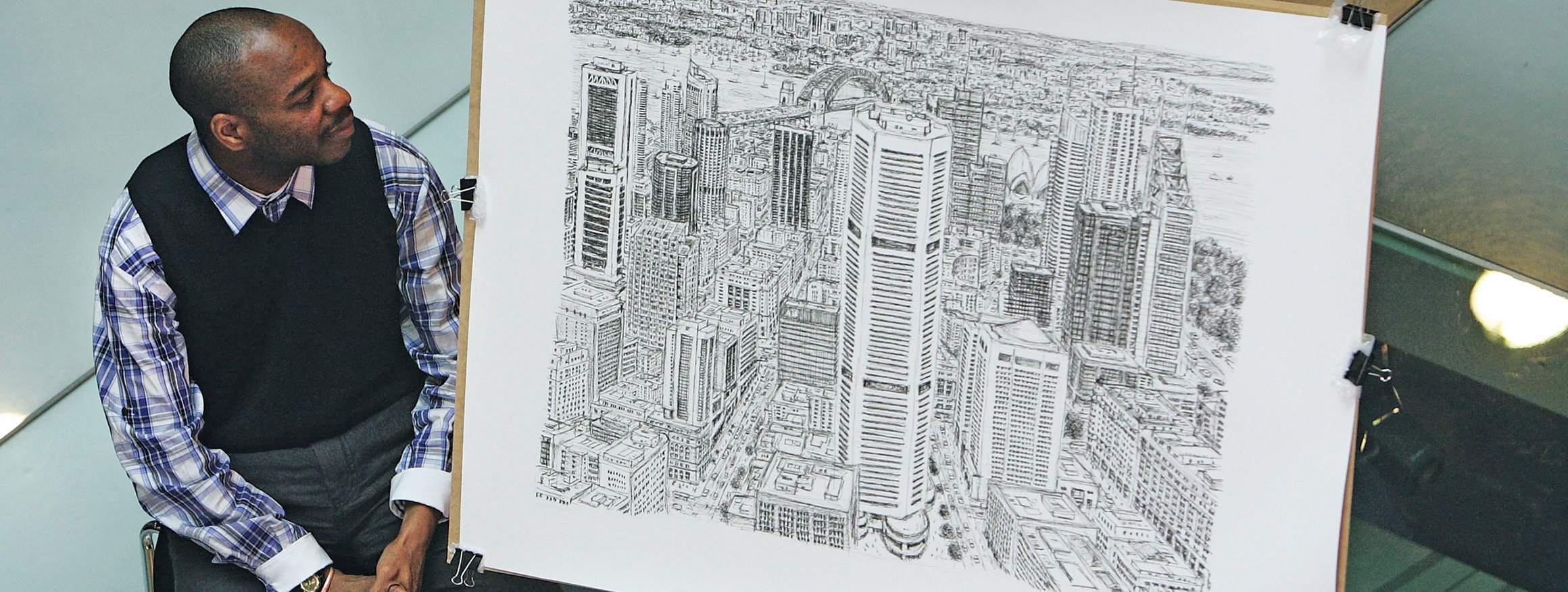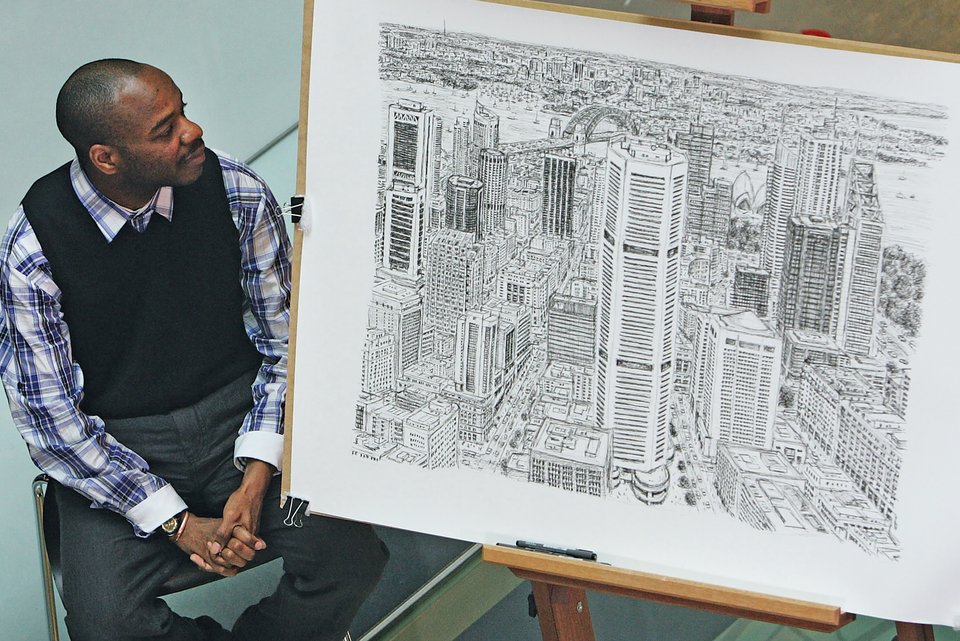Bei seiner Geburt im Jahr 1951 gab es vermutlich niemanden, der Laurence Kim Peek als kommenden Überflieger betrachtet hätte. Sein Schädel war um ein Drittel größer als bei anderen Babys, so dass er für die Nackenmuskulatur zu schwer war und immer wieder nach vorn sackte. Kim hatte zwar nicht den berüchtigten Wasserkopf, aber die Ärzte in Salt Lake City empfahlen den Eltern trotzdem, nicht allzu viel von ihrem Sohn zu erwarten. Der Junge habe eine Behinderung und gehöre in eine Pflegeeinrichtung.
Tatsächlich…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
allzu viel von ihrem Sohn zu erwarten. Der Junge habe eine Behinderung und gehöre in eine Pflegeeinrichtung.
Tatsächlich lernte Kim erst spät laufen und sprechen, das Schuheschnüren und Knöpfen von Hemden gelang ihm bis zu seinem Tod im Jahr 2009 nicht so recht. Er sortierte lieber Papierschnipsel, und wenn man ihn dabei störte, reagierte er stark aufgewühlt. Gleichaltrige sahen in ihm einen Außenseiter. So tauchte er in seine eigene Welt ab, begann zu lesen und sich das Gelesene einzuprägen. Und wie.
Im Alter von vier Jahren konnte der Junge bereits acht Lexikonbände auswendig und fast fehlerfrei vortragen. Sein Vater erkannte, dass man Kim anders fördern musste als bei Kindern sonst üblich. Also löste er jeden Tag Kreuzworträtsel mit seinem Sohn und gab ihm stapelweise Bücher und Zeitungen zu lesen, und als man den Jungen wegen Verhaltensauffälligkeit von der Schule verwies, wurde ein Hauslehrer engagiert. Kim machte seinen Schulabschluss. Ein IQ-Test im Jahr 1988 ergab für ihn einen Quotienten von nur 87 – je nach Aufgabe waren seine Werte aber weit gestreut und erreichten in manchen Gebieten den Bereich hoher Intelligenz.
Der Junge, der sich alles merkte
Als Zwölfjähriger rezitierte Kim bei einem Gottesdienst 40 Zeilen aus der Bibel, obwohl er sie nie gelesen, sondern nur ein einziges Mal gehört hatte. Die Öffentlichkeit wurde nun aufmerksam auf ihn. Er inspirierte den Drehbuchautor Barry Morrow zu Rain Man, jenem Film aus dem Jahr 1988, in dem Dustin Hoffman die Rolle eines Mannes mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) und außergewöhnlichen Begabungen spielte und die Herzen des Publikums eroberte.
Kim Peek selbst gab fortan viele Interviews und brillierte an Schulen und Universitäten mit seinen Gedächtniskünsten. Dabei entwickelte er – was ihm kaum jemand zugetraut hätte – auch soziale Kompetenzen. Er kommunizierte zwar staksig und für andere teilweise verblüffend („Ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben. Ich bin gern in Ihrer Zeit“), außerdem brauchte er immer wieder seine Auszeiten für die hochkonzentrierte Beschäftigung mit Dingen, für die sich kaum jemand interessierte. Ansonsten suchte er aber die Gegenwart seiner Mitmenschen, von denen er respektiert und verstanden werden wollte.
Alles (un)auffällig im Gehirn?
Neurologinnen und Neurologen interessierte, was sich unter Peeks Schädelkalotte verbarg. Sie entdeckten nicht nur ein besonders voluminöses Großhirn, sondern auch, dass es kaum mit den unteren Hirnschichten verbunden war. Das Kleinhirn war zudem kleiner, was Peeks motorische Defizite erklären könnte. Besonders auffällig aber war, dass das Corpus callosum, also der verbindende Nervenstrang zwischen den beiden Hemisphären, nicht ausentwickelt war. Dadurch können sich die beiden Hirnhälften nicht gegenseitig kontrollieren, so dass Informationen weniger gefiltert werden, bevor sie ins Bewusstsein vordringen. Aber das erklärt Peeks Fähigkeiten nur unvollständig. Es bedient vielmehr ein Vorurteil, wonach ein Savant-Syndrom, auch als Inselbegabung bezeichnet, nur möglich ist, wenn im Gehirn etwas schiefläuft, wodurch wir gleichsam getröstet sind, dass wir selbst zwar nicht gerade helle, dafür aber wenigstens „gesund im Kopf“ sind.
Tatsache ist jedoch, dass nur 50 Prozent der inselbegabten Personen eine Autismus-Spektrum-Störung aufweisen. In der anderen Hälfte finden sich durchaus Persönlichkeiten, die zwar durch besondere Fähigkeiten auffallen, ansonsten aber ähnlich denken wie andere. Was die Frage aufwirft, ob prinzipiell jede und jeder von uns außergewöhnliche Begabungen haben könnte. Denn manchmal wäre es doch ganz nett, nicht universal-durchschnittlich, sondern wenigstens in einer Sache richtig gut zu sein.
Noch bis in die 1990er Jahre wurde ein Mensch mit Savant-Syndrom mit der diskriminierenden Diagnose idiot savant, also „gelehrter Idiot“ bedacht. In Deutschland etablierte sich sogar der Begriff „deppertes Wunderkind“. Man gestand ihm zwar bemerkenswerte Fähigkeiten auf einem bestimmten Gebiet zu, hielt ihn aber auf der anderen Seite für so stark zurückgeblieben, dass er ohne fremde Hilfe nicht lebensfähig wäre. Mittlerweile hat sich diese Sichtweise geändert.
Eine andere Form der Wahrnehmung
Einer der führenden Experten auf dem Gebiet des Savant-Syndroms ist der 2020 verstorbene US-amerikanische Psychiater Darold Treffert. Er empfahl, das Syndrom in zwei Ausprägungen zu unterteilen: prodigious (erstaunlich, wunderbar) und talented (begabt). Die besondere Fähigkeit der Letzteren ist nicht unbedingt herausragend, aber sie fällt bei dem betreffenden Menschen ins Auge, weil andere mentale Bereiche eher schwach ausgeprägt sind. Demgegenüber besitzt jemand mit der Ausprägung prodigious eine bestimmte kognitive Kompetenz, die man weltweit nur extrem selten findet, die also weit über dem Durchschnitt der Bevölkerung liegt. Wobei sie sich prinzipiell auf alle Bereiche erstrecken kann: also nicht nur auf Gedächtnisleistungen sowie Zahlen, Daten und Computerprogramme, wie man es von den klischeehaften Nerds der Big Bang Theory kennt, sondern ebenso auf Musik, Literatur und Kunst. „Unter normalen Umständen würde man hier von Genies sprechen“, so Treffert.
Es ist daher kein Wunder, dass mittlerweile auch herausragenden Persönlichkeiten der Kulturgeschichte eine solche Begabung zugesprochen wird, wie etwa Albert Einstein, Marie Curie, Lise Meitner, Charles Darwin und anderen Größen der Naturwissenschaft, aber genauso Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Leo Tolstoi, Wolfgang Amadeus Mozart, Sigmund Freud und Friedrich Nietzsche aus dem künstlerischen und geisteswissenschaftlichen Bereich. Sie sind genial in ihrem ganz speziellen Fachgebiet, ansonsten empfinden sie alltägliche Dinge – vor allem soziale Kontakte – häufig als Herausforderung.
Doch selbst das ist nicht in Stein gemeißelt: Vielen gelingt es, einzelne Bereiche zu stärken und einen guten Umgang damit zu finden. „Sie entwickeln oft eine Fülle an gezielten Selbsthilfestrategien und ein hohes Maß an Resilienz“, erklärt die deutsche Psychologin und Hochbegabtenexpertin Andrea Brackmann. So hätte anfangs niemand erwartet, dass Kim Peek irgendwann einmal unterhaltsame Interviews geben würde.
Was passiert im Gehirn?
Die Annahme, dass eine Inselbegabung das Gehirn so in Beschlag nimmt, dass für andere mentale und soziale Fähigkeiten weniger Kapazitäten übrig sind, greift zu kurz. Doch was passiert stattdessen im Gehirn? Niels Birbaumer und sein Forschungsteam gingen an der Universität Tübingen dieser Frage nach. Mit verschiedenen bildgebenden Verfahren untersuchten sie, wie das Gehirn von Personen mit Savant-Syndrom in unterschiedlichen Wahrnehmungsaktionen arbeitet. „Es zeigte sich, dass es bei einer Wahrnehmungsaktion deutlich schneller aktiv wird“, so der Neurobiologe. „Es werden vor allem jene Gehirnareale mobilisiert, die für das präattentive Wahrnehmen, also die frühe, vorbewusste Verarbeitung von Signalen zuständig sind, die in den ersten 50 bis 100 Millisekunden stattfindet.“ Wo genau diese Areale liegen, hänge wesentlich davon ab, über welche Kanäle – zum Beispiel optisch oder akustisch – die Wahrnehmung gerade erfolgt.
Es dominiert also nicht das bewusste und gefilterte, sondern das vorbewusste und ungefilterte Wahrnehmen. Menschen mit einer Inselbegabung rufen leichter ab, was zwar aktuell nicht bewusst, aber gerade im Gedächtnis abgelegt ist (denn sonst könnten sie ja nicht auf entsprechende Inhalte zugreifen). Der bessere Zugang zum Vorbewussten bedeutet jedoch nicht, dass die Reaktionszeiten extrem schnell sind. Im Gegenteil. Bei einer roten Ampel würde man eher langsamer das Bremspedal drücken, könnte dafür aber – bei entsprechender Begabung – genauso schnell sagen, wie viele Ampeln an der besagten Kreuzung auf Rot stehen oder wie viele Autos und Fußgänger sich dort befinden.
Oder es würde dazu führen, dass – ähnlich wie bei Rain Man – eine Person sofort erfasst, wie viele Streichhölzer beim Bremsen aus ihrer Schachtel gefallen sind. Die Geschwindigkeit, mit der andere bremsen, entspricht der Geschwindigkeit, mit der ein Mensch mit Inselbegabung zählt. Was allerdings fehlt, ist der Filter, der ihm aus dem Meer an Informationen die zentrale Information zukommen lässt – etwa die Notwendigkeit, schnell auf die rote Ampel zu reagieren. Stattdessen werden Dinge in unglaublicher Perfektion registriert, die für den Moment weniger relevant sind.
Talente, die in uns allen stecken könnten
Die Studien des Neurobiologen Birbaumer haben überdies gezeigt, dass nicht nur zum Autismus tendierende, sondern ebenso sozial unauffälligere Menschen mit Inselbegabung einen flinken und ausgeprägten Zugriff auf das Vorbewusste haben. Die Hirnstromkurven und MRT-Untersuchungen ließen da keine Zweifel. Was einerseits untermauert, dass eine solche Begabung nicht automatisch mit einer schweren Hirnstörung einhergehen muss, und andererseits Hoffnung weckt, dass auch ein kognitiv nicht überragender Mensch bis zu einem gewissen Grad „savanthafte Fähigkeiten“ entwickeln könnte.
Wie der Harvard-Forscher Alvaro Pascual-Leone herausgefunden hat, führt ein Weg dahin wohl über die elektrische Hirnstimulation. Seinen Probandinnen und Probanden wurde zunächst eine Geschichte vorgelesen, die sie später nacherzählen sollten. Bei der einen Hälfte stimulierte man während des Vorlesens den Frontal- und Schläfenlappen im Großhirn, wo Planung, Aufmerksamkeit und Lernen gesteuert werden. Dies erfolgte per transkranieller Magnetstimulation (TMS), die das Gehirn pulsierenden Magnetfeldern aussetzt. Die übrigen Testpersonen hatten zwar die typischen TMS-Spulen am Kopf, doch diese waren inaktiv, funktionierten also nur als Placebo. Das Ergebnis: Die elektrisch stimulierten Teilnehmenden konnten beim Erzählen 15 Prozent mehr Details aus der Geschichte abrufen.
Robyn Young von der Flinders University im australischen Adelaide behandelte ihre Versuchspersonen mit wiederholter TMS, bei der die magnetischen Impulse in kurz aufeinander folgenden Salven von 10 bis 20 Hertz pro Sekunde abgefeuert wurden. Sie konzentrierte sich dabei vor allem auf jene Hirnareale, die für das vorbewusste Wahrnehmen zuständig sind. Fünf ihrer insgesamt siebzehn Testpersonen erlangten dadurch tatsächlich so etwas wie eine Inselbegabung: Sie konnten sich plötzlich alle möglichen Kalenderdaten merken oder entwickelten überragende zeichnerische Fähigkeiten, die man vorher von ihnen nicht gewohnt war.
Wie wir das Gehirn trainieren
Dennoch bleibt festzuhalten, dass die elektrische Stimu-lation in zwölf von siebzehn Fällen wirkungslos blieb. Zudem haben solche Verfahren immer etwas von einer Manipu-lation: Einer macht die Maschine an, und dann ändert sich der Mensch, den man daran angeschlossen hat. Und am Ende kann niemand sagen, wie lange der erzielte Effekt noch andauert, wenn der Proband nicht mehr zwischen den Magnetspulen sitzt.
Alternativen zum Öffnen des Wahrnehmungsfensters liegen in meditativen Techniken, wie sie in asiatischen Religions- und Philosophieschulen angewendet werden. Das ihnen zugrunde liegende Prinzip der ziellosen Vergegenwärtigung, also der absoluten Aufmerksamkeit für den Augenblick birgt bereits viele Aspekte der präattentiven Wahrnehmung. Der Zenmeister Takuan Sh sagte schon im 17. Jahrhundert: „Wenn ihr einen Baum anschaut und ein einziges seiner roten Blätter betrachtet, werdet ihr die anderen überhaupt nicht sehen. Wenn aber das Auge sich an keines der Blätter heftet und ihr den Baum betrachtet, ohne irgendetwas im Sinn zu haben, so sind Blätter ohne Zahl dem Auge sichtbar. Nimmt aber nur ein einziges Blatt das Auge gefangen, so ist es, als wären die übrigen Blätter nicht da.“ Dieser nicht anhaftende, zweckfreie Blick auf den Baum als Ganzes erinnert schon stark an das weit geöffnete Wahrnehmungsfenster.
In der psychologischen Forschung ging man lange davon aus, dass unser Gehirn aufeinanderfolgende visuelle Reize nur dann verarbeiten kann, wenn zwischen ihnen mindestens 500 Millisekunden liegen. So lange bräuchte es eben, bis nach dem Erblicken eines ersten Signals wieder genug neuronale Kapazitäten zur Verfügung stehen, um das nächste Signal erfassen zu können.
Doch 2007 fand die amerikanische Neurowissenschaftlerin Heleen Slagter heraus, dass sich diese Spanne durch ein dreimonatiges Meditationstraining deutlich verkürzen lässt. Ihre Testpersonen konnten danach zwei Buchstaben erkennen, auch wenn man sie ihnen in einem Abstand von weniger als 500 Millisekunden präsentierte. Ihr Gehirn hatte gelernt, wie es wirklich nur die einzelnen Buchstaben sehen konnte, ohne gleichzeitig zu versuchen, sie in irgendeine Struktur, in einen Sinnzusammenhang oder eine Bedeutungshierarchie einzuordnen. Und dadurch blieben genug neuronale Kapazitäten, um sich direkt nach dem Verarbeiten des ersten Buchstabens wieder mit voller Aufmerksamkeit dem nächsten widmen zu können.
Die Freiheit, sich entfalten zu dürfen
Treffert und Birbaumer gehen davon aus, dass viele Menschen genetisch über savanthafte Eigenschaften verfügen. Doch diese müssten trainiert werden, um nicht verlorenzugehen. So wäre Kim Peek ohne die Förderung seines Vaters schlichtweg untergegangen, am Ende womöglich sogar zum Pflegefall geworden. Und Thomas Alva Edison wäre wohl nie zum Erfinder geworden, wenn seine Mutter ihn nicht unermüdlich gefördert hätte. Sie brachte ihm Lesen, Schreiben und Rechnen bei – in einem ihm angemessenen, langsamen Tempo –, weckte sein Interesse für Weltgeschichte und Literatur von William Shakespeare bis Charles Dickens. Als sie ihm Richard Green Parkers School Compendium of Natural and Experimental Philosophy schenkte und ein Labor im Keller einrichtete, fing Thomas endgültig Feuer: Er versenkte sich in naturwissenschaftliche Experimente und wurde schließlich zum wohl bekanntesten Erfinder der Welt.
Thomas Alva Edison bekam also auf intuitive Weise eine Begabtenförderung, wie sie heute für Höchstbegabte empfohlen wird. „Er wurde nicht gezwungen, sich sozial anzupassen“, betont Andrea Brackmann. Und er wurde ebenso wenig der Reizüberflutung einer regulären Schulklasse ausgesetzt, sondern seinem individuellen Tempo gemäß unterrichtet sowie in seiner besonderen Begabung unterstützt. Letztlich geht es um gezielte Förderung und die Freiheit, sich individuell entfalten zu dürfen. Nur so können Talente wachsen – und manchmal Fähigkeiten entstehen, die andere staunen lassen.
Sechs Fakten zur Inselbegabung
Wie häufig das Savant-Syndrom vorkommt, lässt sich schwer sagen. Viele Betroffene fallen im Schulalltag kaum auf und werden eher als verhaltensauffällig eingestuft. Außerdem ist unklar, ab wann man von einer Inselbegabung spricht: Genügen 500 auswendig gelernte Pi-Ziffern – oder braucht es 5000?
Expertinnen und Experten schätzen, dass eine von einer Million Personen vom Syndrom betroffen ist.
Das Savant-Syndrom wird häufiger in bildungsnahen Familien erkannt – vermutlich weil man dort eher auf besondere Talente reagiert und sie gezielt fördert.
Das Verhältnis von Männern zu Frauen liegt bei sechs zu eins. Psychologin Andrea Brackmann betont jedoch, dass Jungen mit auffälligen Begabungen von klein auf mehr Aufmerksamkeit erhalten, während Mädchen oft „unter dem Radar bleiben“.
Rund 90 Prozent der betroffenen Personen kommen mit ihrer besonderen Fähigkeit auf die Welt. Bei zehn Prozent ist sie erworben: Sie tritt nach einem Unfall oder einer Erkrankung auf, bei der das Gehirn geschädigt wurde. Plötzlich können die Menschen Dinge, die vorher kaum Teil ihres Lebens waren, etwa wie aus dem Nichts ein Musikinstrument spielen
Fast alle betroffenen Personen leiden anfangs unter dem Impostor- oder Hochstaplersyndrom: Sie zweifeln trotz offensichtlicher Fähigkeiten an den Leistungen und haben Angst, als Hochstapler oder Betrügerin entlarvt zu werden. Denn für ihr Können gibt es oft keine einfache Erklärung.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback! Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.
Quellen
Park, H.O. (2023). Autism spectrum disorder and savant syndrome: A systematic literature review. Journal of Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34(2), 76–92
Darold Treffert: Extraordinary People. Understanding Savant Syndrome. iUniverse 2006
Chung, S., & Son, J. W. (2023). How well do we understand autistic savant artists: A review of various hypotheses and research findings to date. Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34(2), 93–111
Hyun Park, H. O. (2023): Autism spectrum disorder and savant syndrome: A systematic literature review. Journal of Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34(2), 76–9
Hyltenstam, K. (2016). The exceptional ability of polyglots to achieve high-level proficiency in numerous languages. In: Kenneth Hyltenstam: Advanced Proficiency and Exceptional Ability in Second Languages. De Gruyter Moutin 2016, 241–272
Laukkonen, R. E., & Slagter, H. (2012). From many to (n)one: Meditation and the plasticity of the predictive mind. Neurosci Biobehavioral Reviews, 128, 199-217
Neumann, N., Dubischar-Krivec, A. M., Braun, C., Löw, A., Poustka, F., Bölte, S., Birbaumer, N. (2010). The mind of the mnemonists: An MEG and neuropsychological study of autistic memory savants. Behavioural Brain Research, 215(1), 114-121
Treffert, D. A., & Ries, H. J. (2021). The sudden savant: A new form of extraordinary abilities. Wisconsin Medical Journal, 120(1), 69–73
Andrea Brackmann: Extrem begabt. Klett-Cotta 2020