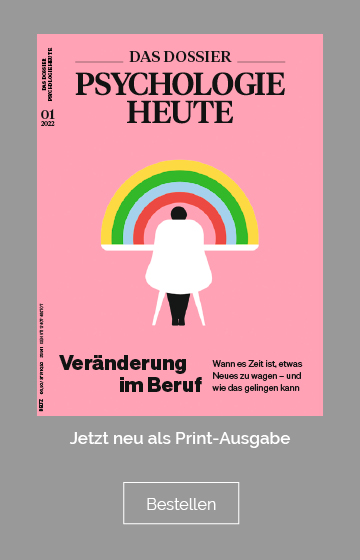Frau Starker, in einer Studie aus dem Jahr 2022 haben Sie festgestellt, dass Beschäftigte im Schnitt alle unglaubliche vier Minuten in ihrer Tätigkeit unterbrochen werden. Was sind die häufigsten Ursachen für eine Unterbrechung?
Die häufigste Unterbrechung ist die gute alte E-Mail; Menschen überprüfen unglaublich oft, ob eine neue E-Mail eingegangen ist. Und von den 15 Unterbrechungen pro Stunde kommen sechs sogar von innen, das heißt, ich unterbreche mich selbst, ohne äußere Not. Unser Gehirn hat sich an den Dopaminausstoß gewöhnt, der sich ereignet, wenn wir uns etwas Neuem zuwenden, so dass wir anfangen, selbst die Unterbrechungen zu suchen, wenn sie uns gerade nicht zur Verfügung gestellt werden.
Neben E-Mails bietet das Handy zahlreiche Anlässe. Das Smartphone ist mit unserem Gehirn inzwischen so verdrahtet, dass es ausreicht, wenn wir es sehen – und schon setzt die Belohnungserwartung ein: „Schau doch einfach mal rein!“ Das gilt selbst, wenn es ausgeschaltet ist.
Würden Sie vor diesem Hintergrund empfehlen, dass wir als Angestellte unser Mobiltelefon am Empfang der Firma abgeben – so wie das Kinder und Jugendliche in der Schule tun?
So weit würde ich nicht gehen. Aber wenn ich Unternehmen zum Thema Fokussierung berate, empfehle ich den Leuten: „Macht es euch leicht und packt das Smartphone während der Arbeit unten in die Handtasche oder in den Rucksack.“
Ich selbst mache eine große Studie pro Jahr und schreibe zwei Bücher, zusätzlich zu meiner Beratungstätigkeit. Dieses Pensum schaffe ich nur, weil ich einen wirklich sehr strikten Umgang mit meinem Handy habe. Nicht weil ich besser bin als andere, sondern weil ich entschieden habe, dass ich mir vom Smartphone nicht meine Prioritäten diktieren lassen möchte.
Cal Newport ist Sachbuchautor und Verfasser des Bestsellers Deep Work – auf Deutsch heißt das Buch „Konzentriert arbeiten“. Er sagt, dass er überhaupt nicht in Sozialen Medien aktiv ist. Und dennoch – oder deswegen? – ist er enorm erfolgreich.
Ja, er hat dieses bemerkenswert gute Buch über Konzentration geschrieben. Ich würde sagen, es kommt auf das Berufsfeld an, in dem man tätig ist, ob und wie man sich in Sozialen Medien engagiert. Ich zum Beispiel bin nur auf LinkedIn, für meine beruflichen Kontakte.
Die Zerstreuungsangebote in den meisten Social-Media-Apps sind so entwickelt, dass es schwer ist, ihnen zu widerstehen. Wenn wir den ganzen Tag versuchen, die Social Media News zu ignorieren, verbrauchen wir dabei so viel Willenskraft, dass abends nur noch wenig übrig ist. Und dann fahren wir nach Hause und es geht nur noch Netflix, Smartphone, Pizza.
Ich vergleiche das mit einem Portemonnaie: Wenn dort 100 Euro Willenskraft drin sind, dann muss ich mich fragen: Wofür gebe ich diese Willenskraft in meinem Leben aus? Und wenn ich schon 90 Euro ausgeben muss, um nicht von Katzenvideos und Empörungsnachrichten verführt zu werden, dann bleibt nicht mehr viel übrig für Anderes. Das ist ein Missverhältnis, das sich Menschen bewusst machen sollten – und überlegen, was ihnen ihre eigenen Ressourcen wert sind.
Dieses Interview ist eine ausführliche Version des Editorials aus Psychologie Heute 9/2025 Heil bleiben im Beruf.
Wenn wir bei einer Tätigkeit – sei es beim Lesen, Schreiben oder dem Entwickeln einer Strategie – oft unterbrochen werden, schadet das dem, was unser Gehirn eigentlich leisten könnte. Warum?
Man kann sich das so vorstellen, als hätte man eine Taschenlampe auf eine Sache gerichtet. Wenn ich jetzt unterbrochen werde, muss ich die Taschenlampe ausmachen, muss sie umschwenken, wieder anmachen und die andere Sache anleuchten. Dann guckt mein Gehirn: Ist das dringlich, nicht dringlich, relevant, nicht relevant? Und dann mache ich die Taschenlampe wieder aus und schwenke sie zurück zu meiner Ausgangstätigkeit. Es kostet viel Zeit, bis ich mich dann wieder vertiefen kann, im Schnitt 23 Minuten. Und es kostet Energie – permanente Aufmerksamkeitswechsel erschöpfen uns. Verrückterweise, ich sagte es schon, kriegen wir trotzdem einen kleinen Dopaminschub, wenn wir uns dem Neuen zuwenden, weil die Erwartung einer Belohnung unser Dopaminsystem ankurbelt. Aber Stress und Erschöpfung steigen.
Trotzdem ist das Neue immer interessanter?
Ja, wir sind mittlerweile wie der Pawlowsche Hund – wir fangen gedanklich an zu sabbern, wenn wir sehen, dass eine neue E-Mail eingegangen ist. Das ist fast wie ein Reflex. Aber es geht darum, das ganze Thema nicht moralisch zu betrachten. Ich frage in Unternehmen immer: Wollt ihr das so haben? Und die meisten Menschen antworten: Ehrlich gesagt, nein. Weil sie merken, dass es ihnen nicht guttut.
Verlernen wir, uns in eine Sache wirklich zu vertiefen?
Viele Menschen merken, dass ihre Aufmerksamkeitsspanne kürzer geworden ist und sie sich früher besser konzentrieren konnten. Eine Geschäftsführerin hat neulich zu mir gesagt, dass sie seit über 25 Jahren „Die Zeit“ liest und merkt, dass sie nicht mehr durch die langen Artikel kommt. Es ärgert sie maßlos. Das heißt, Menschen können anhand von Selbstbeobachtung sagen, dass sie die gleiche Tätigkeit seit über 20 Jahren machen – und sich ihre Fähigkeit, sich darauf zu fokussieren durch das Smartphone und die Informationsdichte verändert hat.
Grundsätzlich – das sei vielleicht ergänzend gesagt – gibt es Menschen, die sich leichter, und manche, die sich schwerer konzentrieren können. Eher extrovertierte, beziehungsorientierte Menschen lassen sich schneller ablenken als introvertierte, sachorientiertere Typen, so meine Beobachtung.
Lange Zeit galt es aber doch als wünschenswertes Talent, das man als Arbeitnehmer mitbringen sollte: mehrere Dinge gleichzeitig tun können – multitaskingfähig sein.
Wir sind neurobiologisch bei konzentrationsbedürftigen Tätigkeiten gar nicht multitaskingfähig. Wir haben nur einen Arbeitsspeicher und das bedeutet eben: Taschenlampe an, Taschenlampe aus. Man müsste es eigentlich „Multiswitching“ nennen. Es gibt Menschen, die können so schnell zwischen zwei Inhalten wechseln, dass sie es als gleichzeitig erleben. Aber es bleibt ein Wechsel, den wir auf Dauer mit Erschöpfung, Zeitverlust und gedanklicher Verflachung bezahlen.
In Unternehmen hat das mittlerweile eine völlig neue Dimension. Microsoft hat jetzt gemessen, dass Zwei-Drittel der Teilnehmenden an Online-Meetings währenddessen an anderen Dingen arbeiten. Ergo stundenlanges Multitasking.
Manche gehen ja auch während Meetings einkaufen.
Wenn wir bedenken, dass wir seit 2020 153 Prozent mehr Meetings haben und wenn wir das mit der Zwei-Drittel-Quote paaren derer, die währenddessen etwas anderes tut – dann schrotten wir schlicht unseren Denkapparat, das kann man nicht anders sagen. Dass die Erschöpfung unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so stark gestiegen ist, ist vor diesem Hintergrund für mich nicht verwunderlich. Die Studienlage ist da eindeutig – ob es medizinische, psychologische oder neurobiologische Studien sind: den Anstieg der Erschöpfung kann man als gesichert ansehen.
Warum hat die Zahl der Meetings so stark zugenommen?
Zu Beginn von Corona, in den Zeiten der Lockdowns, waren Online-Meetings eine wirklich hilfreiche Coping-Strategie, um überhaupt Bindung zwischen Kolleginnen und Kollegen herzustellen und weiterhin produktiv arbeiten zu können. Jetzt ist diese Lösung zum Problem geworden, weil ein Gewöhnungseffekt eingesetzt hat: Wir sind teilweise oder überwiegend wieder zurück in die Büros gegangen. Und haben dann nicht gesagt: „Oh, jetzt brauchen wir das Instrument nicht mehr.“ Nein, wir haben einfach noch einen obendrauf gesetzt und noch mehr Meetings anberaumt. Und jetzt sind die ersten Studien da, die zeigen, dass Online-Meetings Menschen tief erschöpfen. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung hat ja schon einen Fragebogen herausgegeben zur Zoom-Fatigue, mit dem man prüfen kann, ob man ein tiefes Erschöpfungssyndrom durch permanente Online-Meetings hat.
Warum sind Online-Meetings so anstrengend?
Dazu wird gerade viel geforscht. Ein Untersuchungsansatz lautet, dass die Bildschirmnähe der Gesichter überfordernd ist – so nah würden wir im analogen Meeting ja nicht vor einem Kollegen stehen, und schon gar nicht vor zwölf anderen Menschen gleichzeitig. Unser Gehirn versucht – so ein weiterer Untersuchungsansatz – die vielen Mikroexpressionen in den Gesichtern gleichzeitig wahrzunehmen, was natürlich nicht geht. Auch dass wir uns permanent selbst sehen, laugt aus. Häufiger kommt es zudem zu Verzögerungen zwischen Ton und Bild – diese Asynchronität zwischen Sprache und Mundbewegung ist für das Gehirn ebenfalls anstrengend.
Firmen, die wir zum Thema Fokussierung begleiten, denen raten wir daher zu der klaren Regel: Wenn Online-Meetings, dann machen alle die Kamera aus. Oder man telefoniert lieber gleich. Und bewegt sich dabei idealerweise noch. Viele, vor allem Führungskräfte, bewegen sich viel zu wenig. Das verursacht an anderer Stelle mittlerweile somatische Probleme. Anstatt vor dem Rechner zu sitzen, kann man sich zum Beispiel einige Telefonate hintereinander legen und dabei ums Gebäude laufen.
Betreiben wir im Homeoffice noch mehr Multitasking – oder -switching – als im Büro? Also Wäsche zusammenlegen, Aufsatz der Tochter korrigieren, Online-Meeting und E-Mail schreiben, alles gleichzeitig?
Für Menschen, die sich gut organisieren können, ist das Homeoffice optimal. Diese arbeiten zwei Stunden, dann machen sie die Wäsche, dann machen sie eine Stunde Strategiearbeit, dann kochen sie das Mittagessen. Immer nur ein Task zu einer Zeit, zwischendurch mal etwas Bewegung und das Laub rechen, und dann wieder frisch an die Arbeit – das ist gut für unsere geistige Leistungsfähigkeit.
Aber das setzt eine gewisse Selbstdisziplin voraus, dass man sich klare Ziele setzt und dass man gut organisiert ist. Wobei selbst Menschen, die nicht so gut organisiert sind, zu Hause zumindest ungestörter arbeiten können.
Weniger Meetings, Kameras aus in Online-Meetings, Führungskräfte beim Telefonieren um den Block schicken: Was müssen Unternehmen noch verändern, damit ihre Mitarbeitenden sich wieder besser konzentrieren können?
Wir können das Thema nicht allein auf der Mindset-Ebene lösen, wir brauchen strukturelle Veränderungen in den Unternehmen, und die wichtigste davon ist die Fokuszeit. Das heißt, es gibt Zeiten, in denen ungestört gearbeitet werden kann. Es gibt währenddessen keine Sitzungen und es muss nicht kommuniziert werden.
Für alles Dringliche legt man einen Kanal fest, auf dem einen eine Nachricht erreichen kann, wenn etwas wirklich Wichtiges passiert – und dieser Kanal sollte auf keinen Fall die E-Mail sein. So muss man dann auch nur noch drei Mal am Tag E-Mails checken, weil man weiß: Was wichtig ist, kommt woanders an – vielleicht übers Telefon? Das reduziert die Unterbrechungseffekte deutlich. Hier braucht es allerdings eine einheitliche Lösung im Team, idealerweise auf Unternehmensebene.
Ein weiterer Punkt ist, dass sich das Unternehmen selbst fokussieren muss, also auch strategisch. Wir haben in Organisationen unglaublich viele parallele Veränderungsprozesse, und das kostet viel Energie und spaltet die Aufmerksamkeit. Mitarbeitende springen von Projekt zu Projekt zu Projekt – das ist Multitasking auf systemischer Ebene. Firmen müssen sich fragen: Auf welche Veränderung fokussieren wir uns? Diese Veränderung müssen sie dann anstoßen, durchhalten, zu Ende bringen, Korken knallen lassen. Und dann die nächste Veränderung starten. Also Singletasking auf Unternehmensebene.
Und das dritte ist, dass es eine Wertschätzung, eine explizite Erwünschtheit von Fokus und Qualität geben muss. Wir haben immer noch eine Kultur, in der wir Menschen Anerkennung zollen dafür, dass sie im Urlaub erreichbar sind, dass sie Pausen auslassen, dass sie Überstunden machen. Dadurch sind sie aber nicht nur gestresster – ihre Leistungsfähigkeit sinkt auch, was gerade in Zeiten, wo sich viele Unternehmen verändern müssen, schlecht ist für den Erfolg. Wenn man das ernsthaft umstellen und zu seinen Mitarbeitenden sagen würde: „Sie bekommen ein Kritikgespräch mit mir, wenn sie nicht Urlaub machen oder ihre Pausen nicht nehmen“ – das wäre ein großer Hebel.
Sieht der Arbeitsalltag unterschiedlich aus, je nachdem, auf welcher Hierarchieebene ich arbeite?
Wir haben in unserer Studie gemessen, dass je weiter oben sie in der Hierarchie sind, umso weniger Zeit haben die Menschen, weil: noch mehr Meetings, noch mehr Unterbrechungen. Unternehmen müssen überlegen, wie ihre Chefetagen Raum bekommt, nachzudenken. Nur dann sind sie erfolgreich und können ihre Organisationen gut durch Krisen und Komplexität steuern.
Bei allen strukturellen Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen: Kann ich persönlich die Tendenz, dass ich mich nur noch kurz konzentrieren kann, und dass mein Gehirn gewohnt ist, von E-Mail-Nachricht zu Smartphone checken zu Meeting verfolgen zu springen – kann ich diese Tendenz bei mir wieder rückgängig machen?
Ja, wir können Konzentration und Fokussierung ganz gut trainieren, zum Beispiel über das Lesen langer Texte. Aber auch wenn ich abends abspüle nicht denken: Ich muss noch, ich muss noch. Sondern einfach abspülen, das Wasser fühlen, das Spülmittel riechen, Omas Teller angucken, nicht die To-do-Liste im Kopf durchgehen. An der Stelle brauchen wir ein bisschen italienische Basta-Kompetenz: Ich mache jetzt das hier und den Rest schiebe ich weg. Es ist eine Art, der aktuell ziemlich herausfordernden Welt zu begegnen, sich einen eigenen Rhythmus zu schaffen und sich nicht drängen zu lassen. Weder von anderen noch von den eigenen Gedanken. Wenn Sie das tun, merken Sie nach drei bis vier Wochen eine echte Veränderung.
Vera Starker ist Wirtschaftspsychologin und Mitgründerin des Berliner Thinktanks Next Work Innovation. Ihre Studie zu Kosten von Arbeitsunterbrechungen in Unternehmen finden Sie hier.