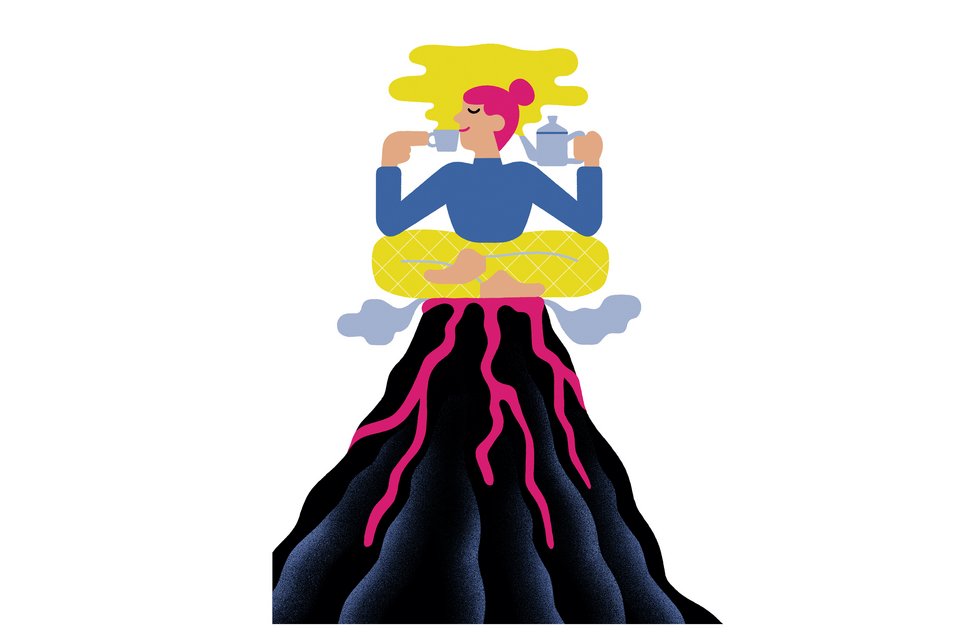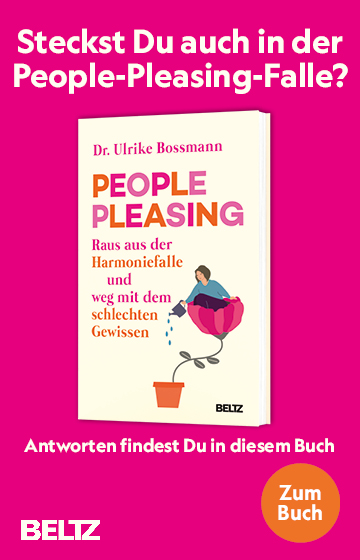Extremismus ist keine so exotische Eigenschaft, wie wir uns gern weismachen. Jedenfalls wenn man den Begriff so weit fasst, wie dies Arie Kruglanski und Sophia Moskalenko tun, die sich in der Terrorismusforschung einen Namen gemacht haben. Laut den beiden begegnen wir dem Extremismus unentwegt – auch bei uns selbst. Dessen zentrales Merkmal sei die Einspurigkeit: Ein dominantes Bedürfnis, ein Motiv, eine Idee – sei es fanatisch betriebenes Fitnesstraining, ein Ernährungsfimmel, die Karriere oder eben eine politische oder religiöse Ideologie – bestimmt sämtliche Ziele und Handlungen. Alles andere, alles Relativierende wird beiseitegeschoben. Was hilft, wenn man einer Obsession derart verfallen ist? In ihrem neuen Buch skizzieren Kruglanski und Moskalenko eine Reihe von Strategien.
1 Mäßigen
Extremismus ist ein Auswuchs dessen, was der kanadische Psychologe Robert Vallerand eine „Leidenschaft obsessiven Typs“ nennt. Es ist die Sorte Enthusiasmus, die nicht unter der Kontrolle der von ihr befallenen Person steht, sondern umgekehrt: Obsessive Leidenschaft kontrolliert den Menschen. Sie beherrscht das Denken, Fühlen, Handeln, Sozialleben. Die Obsession dominiert alles. Dem stellt Vallerand die „Leidenschaft harmonischen Typs“ gegenüber. Auch sie ist eine innere Kraft, die Energien freisetzt – aber dabei nicht die Regie übernimmt. Sie lässt Platz für andere Bedürfnisse.
Ein Schlüssel zur Mäßigung besteht folglich darin, dem leidenschaftlichen Engagement feste Zeiten und weitere Regeln zu geben. So soll es Ernest Hemingway gehalten haben. Schrieb er sich anfangs jeden Nachmittag bis in die Nacht die Finger wund – mit der Folge, dass er sich ausgelaugt und depressiv fühlte –, so ging er schließlich dazu über, pro Tag nicht mehr als 500 Wörter zu Papier zu bringen. Dafür aber regelmäßig, als tägliche Routine. Das bekam ihm besser. Mäßigung könnte auch heißen: Social Media mit ihren Entrüstungskaskaden auf eine Viertelstunde am frühen Abend beschränken – oder gleich ganz abschaffen.
2 Auf Abstand gehen
Der Buddhismus lehrt den „mittleren Weg“: keine Völlerei, kein Zuviel von irgendwas – aber auch keine Askese. Seine Übungsmethode, um zu den Extremen auf Abstand zu gehen, ist die Meditation. In einem entspannten, auf den Körper fokussierten Zustand beobachtet man all die Gedanken, Begierden, Gefühle, die einem durch den Kopf ziehen – jedoch von einer distanzierten Warte aus, ohne in den Bewusstseinsstrom einzutauchen und sich dessen Treibgut zu eigen zu machen. Auf diesem Grundprinzip bauen Therapieansätze wie die mindfulness-based stress reduction auf.
In Studien wurde beobachtet, dass bei einer Achtsamkeitsmeditation die Aktivität der Amygdala, einer emotionalen Schaltstelle des Gehirns, gedimmt wird: Der Geist ist aufmerksam, aber nicht aufbrausend. Interessant ist die folgende Beobachtung: Werden Versuchspersonen während der Meditation mit emotional aufgeladenen Bildern belästigt, dann werden bei Meditationsneulingen Hirnareale aktiv, die für kognitive Kontrolle zuständig sind: Die emotionale Erregung wird unterdrückt. Bei erfahrenen Meditierenden hingegen sinkt die Aktivität der Kontrollinstanz – und das führt uns zu Punkt drei.
3 Zum Tee einladen
Noch einmal Buddha: Eine Parabel erzählt von dessen erschöpfendem Kampf mit dem Dämon Mara, der ihn fortwährend in Versuchung führt und mit Gier, Zorn, Lust, Zweifel überzieht. Es ist ein zermürbendes Spiel: Kaum hat Buddha der Verlockung widerstanden und den Dämon abgewehrt, kehrt dieser in einer neuen Verkleidung zurück, wieder und wieder. Eines Tages wechselt Buddha die Strategie: Statt den Widersacher zu bekämpfen, lädt er ihn zum Tee ein. Da sitzen die beiden nun friedlich schlürfend beisammen, dann geht jeder seines Weges. Kruglanski und Moskalenko sehen in der Teestrategie ein profundes Hilfsmittel gegen das Extreme innerhalb und außerhalb von uns: nicht abwehren, sondern einladen, es in seinen vielen Verkleidungen betrachten, die Auslöser erkennen, die Bedrängnis, die einen dazu treibt, sich fanatisch einer Idee zu verschreiben und alles andere auszublenden.
4 Horizont erweitern
Indem Extremismus sich auf ein dominantes Ziel versteift, klammert er all die schönen oder notwendigen Dinge aus, die das Leben sonst noch bereithält. Eine Gegenstrategie besteht darin, diesen anderen Dingen wieder Gewicht zu geben. Genau darauf zielen manche Deradikalisierungsprogramme. Kruglanskis Forschungsteam begleitete auf Sri Lanka ein solches Programm, zu dem ehemalige Kämpfer der Liberation Tigers of Tamil Eelam von der Regierung verpflichtet wurden. Doch das Programm selbst setzte nicht auf Zwang. Die Kurse, geleitet von tamilischen Kräften, zielten auf Bildung, künstlerische und berufliche Fertigkeiten. Nach Abschluss des einjährigen Camps stellte das Forschungsteam fest, dass bei den Trainees die extremistische Haltung und die Gewaltbereitschaft nachgelassen hatten. Mehr noch: Das Gefühl von Selbstwert und persönlicher Bedeutung war nun deutlich höher. Der Hass dominierte nicht mehr alles andere.
5 Mitfühlen
Extremismus entfremdet Menschen von der Familie, vom Freundeskreis. Das liegt einerseits an der schieren Zeit, die sie für ihre fanatische Sache aufwenden. Doch es liegt auch daran, dass sie in ihrer Besessenheit auf soziale Normen und die Bedürfnisse anderer wenig Rücksicht nehmen. Kann man Mitgefühl und Hilfsbereitschaft kultivieren? In einer Studie wurden Jugendliche mit einer App ausgestattet, die sie zu Empathiespielen animierte: erkennen, wie andere sich fühlen, ein weinendes Baby umsorgen, einen Hund streicheln. Nach zwei Monaten zeigten die so Trainierten, verglichen mit einer Kontrollgruppe, mehr Mitgefühl für jemand in Not, mehr Empathie bei Gesprächen und weniger Aggression gegenüber Gleichaltrigen.
Ungleich schwerer ist es natürlich, als Erwachsener in einer konfliktgeladenen Situation Menschen einer fremden Community Hilfe zu leisten. Die Initiative I Am Your Protector hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau solche realen Heldengeschichten zu sammeln und zu verbreiten. Etwa die Geschichte des syrischen Lehrers Hesham Ahmad Mohammad, der in der Kölner Silvesternacht 2015 einer sexuell bedrängten jungen Amerikanerin gegen die Männerhorde beistand. Vorbilder sind ansteckend.
Quelle
Arie W. Kruglanski, Sophia Moskalenko: The Psychology of the Extreme. Routledge 2025