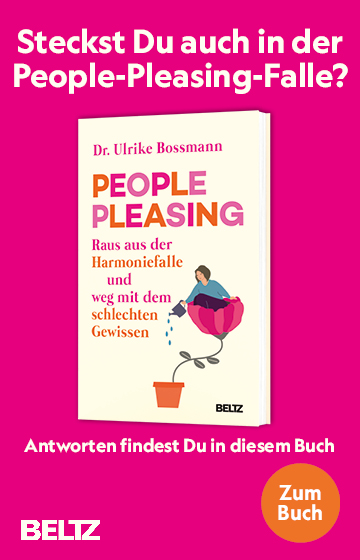Herr Bernhardt, die Suche nach einem Psychotherapieplatz gestaltet sich heute häufig schwierig und langwierig. Wie finde ich denn die passende KI für therapeutische Zwecke?
Eine KI sollte für therapeutische Zwecke vor allem zwei Dinge erfüllen: Sie muss einfach zu bedienen sein, und die Ratschläge, die sie gibt, sollten ausschließlich auf einer validen therapeutischen Wissensbasis erfolgen. Für mein Buch habe ich 14 Monate lang alle gängigen KI-Modelle getestet und mich schließlich für ChatGPT-4 entschieden, da ich damit während der Schreibphase die besten Ergebnisse erzielen konnte. Zudem ist es mir in der ganzen Zeit nicht gelungen, diesem Chatbot eine Antwort zu entlocken, die unsinnig oder gar gefährlich gewesen wäre. Auch das war für mich ein wichtiger Punkt, weshalb ich letztendlich bei ChatGPT-4 geblieben bin.
Für welche psychischen Probleme eignet sich Ihren Recherchen zufolge eine KI am besten?
Bei der Behandlung von Angststörungen, leichten Depressionen und Burnout kann ein Chatbot durchaus Erstaunliches leisten. Vor allem wenn man dafür einen maßgeschneiderten Custom-GPT verwendet, der speziell für solche Anwendungsfälle trainiert wurde. Gerade bei der Auflösung von negativen Glaubenssätzen, die ja vielen psychischen Problemen zugrunde liegen, kann eine KI eine enorme Hilfe sein. Vor allem auch dann, wenn es darum geht, nötige Veränderungen wie zum Beispiel einen Jobwechsel in die Tat umzusetzen. Hier kann die KI – besser als ein Therapeut mit begrenzter Zeit – Schritt für Schritt durch einen beliebig langen Prozess führen. Bis dahin, dass der Chatbot sogar Bewerbungsschreiben professionell formulieren kann.
Wie würde zum Beispiel ein erster Prompt aussehen, mit dem ich die KI bitte, mir bei Prüfungsangst zu helfen?
„Hallo ChatGPT, ich habe große Angst vor Prüfungen. Bitte hilf mir dabei, eine für mich passende Strategie zu finden, mit der ich diese Angst überwinden kann. Arbeite dazu mit mir wie ein einfühlsamer Therapeut und stelle mir in jeder deiner Antworten immer nur eine Frage oder Aufgabe.“
Es gibt bislang wenig Erfahrung mit KI. Worauf stützen sich Ihre Erkenntnisse? Gibt es belastbare Studien zum Thema?Die gibt es. Zum Beispiel die Wysa-Studie von 2018 oder die Woebot-Studie von 2017, bei der nach nur zwei Wochen KI-Therapie eine signifikante Reduktion von Depressionssymptomen bei den Testpersonen nachgewiesen werden konnte. Und das, obwohl diese KI-Systeme längst nicht so leistungsfähig waren, wie die heutigen Versionen von Claude oder ChatGPT.
In welchen Fällen raten Sie, Therapeutinnen und Therapeuten aus Fleisch und Blut aufzusuchen?
Bei akuten Lebenskrisen, Suizidgedanken und schweren Depressionen würde ich ausschließlich menschliche Therapeutinnen und Therapeuten empfehlen. Das Gleiche gilt für Zwänge, Schizophrenie und Borderlinestörungen sowie schwere Formen von Hypochondrie und bipolaren Störungen.Wer die Möglichkeit hat, zeitnah mit einem guten Therapeuten zu arbeiten, sollte das auch tun. Leider ist das aber nicht die Regel. Wenn man nur die Wahl hat, monatelang auf Hilfe zu warten oder sofort von einer Maschine Hilfe zu bekommen, kann auch ein KI-Therapeut eine gute erste Anlaufstelle sein.
Klaus Bernhardt arbeitete viele Jahre als Wissenschafts- und Medizinjournalist, bevor er selbst therapeutisch tätig wurde. Heute leitet er in Berlin das Institut für moderne Psychotherapie und bildet jährlich hunderte von Ärzten und Therapeuten weiter.
Klaus Bernhardts Buch Der KI-Therapeut. Psychische Probleme mit künstlicher Intelligenz überwinden – KI-Tools als erste Hilfe für Betroffene ist bei Ariston erschienen (272 S., € 20,–)
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!
Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an:redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.