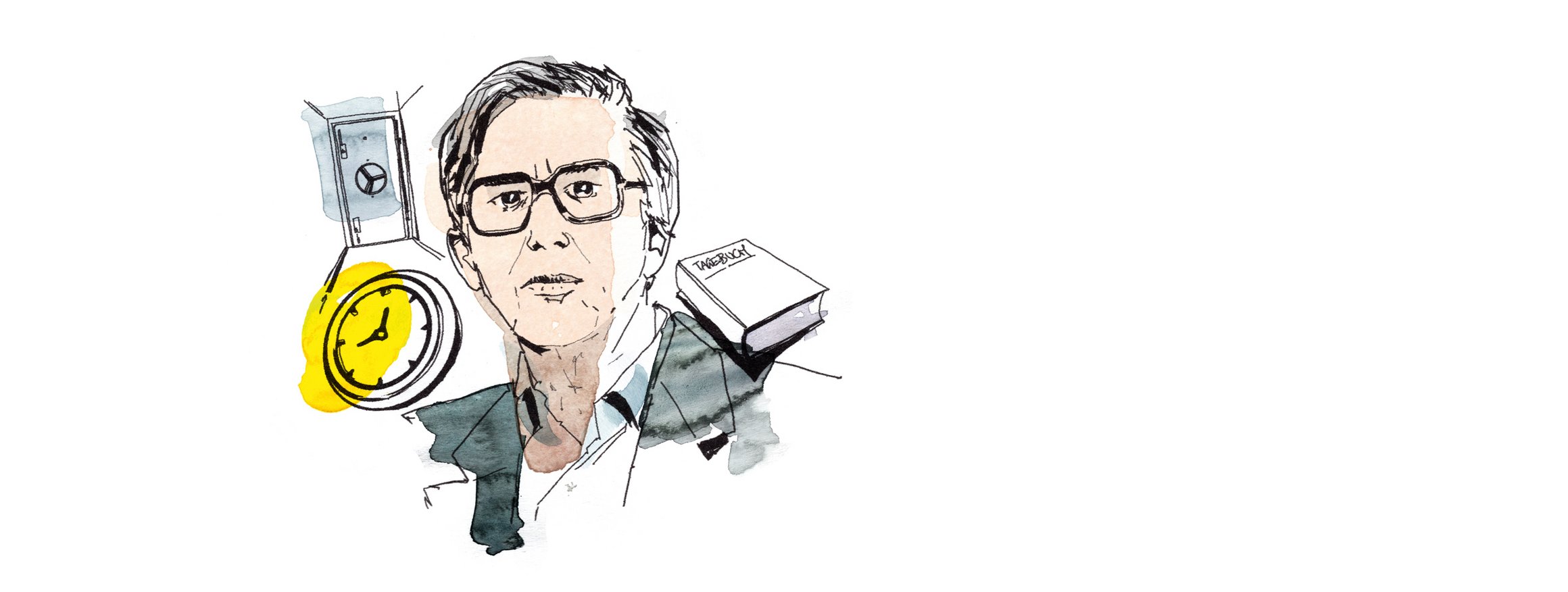Der Wechsel von Tag und Nacht ist ein mächtiger Taktgeber für alles, was lebt. Körpertemperatur, Hormone, Reaktionszeit, Gedächtnis, Stimmung: kaum etwas in unserem Organismus, das nicht in tagesperiodischen Wellen verläuft. Was aber geschieht mit diesem Rhythmusensemble, wenn man ihm den Taktstock entzieht?
Diese Frage beschäftigte Jürgen Aschoff, Leiter des Max-Planck-Instituts für Verhaltensphysiologie, und Anfang der 1960er machte er sich mit seinem Team daran, ihr experimentell auf den Grund zu gehen. Im tiefen Bayern, nahe dem Ammersee beim Kloster Andechs, ließ er in einem Hügel einen unterirdischen „Bunker“ (die Pilotversuche hatten tatsächlich in einem alten Wehrmachtsbunker stattgefunden) mit zwei Appartements errichten. Sie waren von allem abgeschirmt, was draußen vorging: fensterlos, isoliert gegen Schall und Vibrationen.
Die Freiwilligen, die sich hier einzeln oder in kleinen Gruppen für wenige Wochen einquartierten, lebten ohne Uhren, Radio, Fernsehen und alles, was ihnen über die Zeit draußen hätte Auskunft geben können. In einer Schleuse platzierten sie Einkaufsliste und Urinproben, in einem Tagebuch notierten sie, wie sie sich fühlten. Sie folgten ihrem eigenen Rhythmus: Wann immer sie müde waren, löschten sie das Licht.
Aschoffs wegweisendes Experiment, an dem über die Jahre mehrere hundert Personen teilnahmen, brachte eine Fülle von Resultaten. Das wichtigste: Auch jenseits von Tageslicht und Zivilisation behalten Menschen einen Tagesrhythmus bei, sie folgen einer inneren Uhr. Doch ist dieser innere Tag ein wenig verschoben vom äußeren, bei den meisten umfasst er eher 25 als 24 Stunden. Spätere Forschung sollte zeigen, wie schädlich es ist, wenn dieser innere Rhythmus gestört wird, etwa durch Schichtarbeit, Jetlag oder die Lichtverschmutzung unserer Nächte.
Noch mehr Meilensteine der Psychologie: Zeit
2009 Heather Mann testet Synästhesiebegabte, die Zeit räumlich wahrnehmen
2003 Till Roenneberg vergleicht Menschen unterschiedlichen „Chronotyps“
1990 Tom Wehr studiert den Schlaf in Nächten ohne jedes Kunstlicht
1864 Karl Ernst von Baer spekuliert, dass Zeit für Tierarten verschieden schnell vergeht
1729 Jean Jacques d’Ortous de Mairan beobachtet bei Pflanzen Tagesrhythmus im Dauerdunkel
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback! Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.