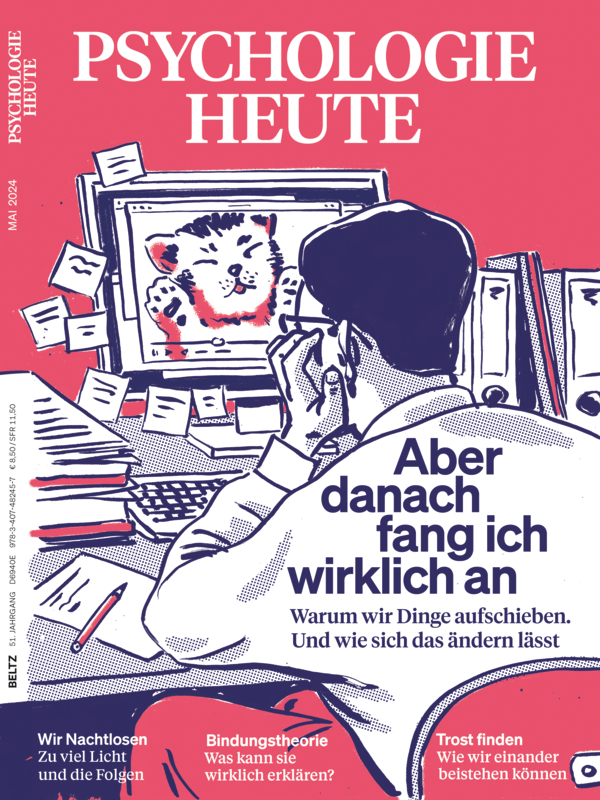Die Dunkelheit verschlingt uns. Der Ranger Oma Sao führt uns in die Tiefen der Kalahari im äußersten Osten Namibias, wo er und seine Vorfahren vom Volk der San aufgewachsen sind. Wir sind auf der Suche nach dem meistgeschmuggelten Tier der Welt, dem Schuppentier. Und weil das Schuppentier seinen Bau nur nachts verlässt, müssen wir Taggeschöpfe unseren Rhythmus anpassen. Schon nach wenigen Minuten verliere ich die Orientierung.
Das Schlimmste aber sind die Geräusche: War das ein Elefant? Ein Löwe? Ich muss…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
verliere ich die Orientierung.
Das Schlimmste aber sind die Geräusche: War das ein Elefant? Ein Löwe? Ich muss den Impuls unterdrücken, meine Handytaschenlampe einzuschalten und loszurennen. Es ist, als würde mich eine innere Kraft wie eine Motte antreiben: Schnell zurück zum Licht, egal wie.
Ein Schuppentier werden wir in dieser Nacht nicht finden. Aber ich gewinne eine Erkenntnis, die ich gar nicht gesucht hatte: Mir wird schmerzlich bewusst, wie fremd mir die Dunkelheit ist. Und wie verloren ich ohne Licht bin. Ranger Sao zeigt uns den Weg zurück durch die afrikanische Wildnis. Nach etwa einer Stunde Fußmarsch erreichen wir das rettende Auto. Als ich Sao später frage, wie er den Weg gefunden hat, schaut er mich verwundert an.
Dann zeigt er über uns: Die Milchstraße zieht sich wie ein weiß-silbernes Band durch den Nachthimmel. Dazu funkeln am Firmament das Kreuz des Südens und das Sternbild Skorpion. Ich war so überwältigt von der Dunkelheit, dass ich all das gar nicht wahrgenommen habe.
Glocke des Lichts
Namibia hat einen der klarsten Nachthimmel der Welt. Das Land im Südwesten Afrikas ist dünn besiedelt, die Industrie kaum entwickelt. Lichtverschmutzung, also die Erhellung der Nacht durch künstliches Licht, gibt es in dem Wüstenland so gut wie gar nicht. Im Gegensatz zu vielen anderen Teilen der Welt.
Studien zeigen, dass der Nachthimmel Jahr für Jahr um bis zu zehn Prozent heller wird. Etwa 80 Prozent der Menschen erleben keine wahre Dunkelheit mehr. In Europa und den USA sind es sogar 99 Prozent. Stattdessen spielt sich das nächtliche Leben in einer Dämmerung aus künstlichem Licht ab. Wie eine Glocke wölbt es sich über das Land und scheidet uns vom Nachthimmel und den Sternen. Mehr als ein Drittel der Menschheit wird die Milchstraße nie von der Heimat aus beobachten können.
Bereits in den 1880er Jahren beklagten englische Astronomen, dass die nächtliche Beleuchtung in London ihre Sicht auf den Weltraum einschränke. Würden sie heute in den Himmel blicken, sie würden ihn wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Der Alltag der San im Osten Namibias ist eine letzte Erinnerung daran, wie das Leben vor der Industrialisierung gewesen sein muss. Kontraste bestimmen ihren Lebensrhythmus: Tagsüber erhellt die Sonne ihre Welt. Nachts regiert die Dunkelheit, durchbrochen nur vom Mond, den Sternen und der Milchstraße.
Nacht folgt auf Tag, dunkel auf hell
„Die Menschen haben das Gefühl dafür verloren, wie der Nachthimmel aussieht“, sagt Johan Eklöf. Der schwedische Zoologe ist einer der wohl leidenschaftlichsten Verfechter des Appells, die Dunkelheit zu schützen. Als Fledermausforscher ist er auf sie ebenso angewiesen wie die Tiere, die er studiert. Eines Tages besuchte er Kirchen in Südschweden, um dort die Fledermausbestände zu erfassen. Und stellte fest: Scheinwerfer hatten die Dunkelheit aus vielen Gebäuden vertrieben – und mit ihr die Fledermäuse.
Für Eklöf war es ein Schlüsselmoment: „Als wir diese Studie durchführten, wurde mir klar, dass es nicht nur um Fledermäuse gehen kann“, sagt er. „So viele andere lebende Organismen müssen betroffen sein, wenn wir die Nacht auslöschen. Uns Menschen eingeschlossen.“ Der Zoologe widmete dem Thema ein Manifest in Buchgestalt: Das Verschwinden der Nacht.
„Seit rund drei Milliarden Jahren gibt es Leben“, sagt Eklöf. „Alles hat sich in einer Welt mit einem sehr vorhersehbaren Zyklus aus Licht und Dunkelheit entwickelt: Der Tag folgt auf die Nacht, die Nacht auf den Tag.“ Erst vor 144 Jahren, als Thomas Edison das Patent für die elektrische Glühbirne erhielt, wandelte sich unsere Lebenswelt drastisch. Licht wurde zur allzeit verfügbaren Massenware – mit wachsender Leuchtkraft.
„Seitdem man überall LED-Lampen kaufen kann, ist die Lichtverschmutzung noch einmal geradezu explodiert“, sagt Eklöf. Zwar sei es eine Entwicklung, die wir auf kurze Sicht nicht wahrnähmen. Wenn man aber Satellitenbilder aus den vergangenen Jahrzehnten vergleiche, dann sehe man den gewaltigen Unterschied. An derart rasante Veränderungen können sich Lebewesen nicht anpassen, so der Fledermausforscher. „Da können wir evolutionär nicht mithalten.“
Die Gefahr der Nacht?
Ich werfe online einen Blick auf den „Weltatlas der Lichtverschmutzung“: Die wirtschaftlich starken Regionen – die Vereinigten Staaten, Europa und Südasien – bilden ein Lichtermeer. In Australien, Afrika und Südamerika strahlen höchstens einzelne Punkte. Wir verbinden Licht mit Fortschritt, Wachstum, Produktivität. „Wir haben das Licht erfunden, um mit ihm die Dunkelheit zu vertreiben“, sagt Eklöf. „Und das tun wir auch, wir leben in einer 24/7-Gesellschaft.“ Das heißt 24 Stunden Licht, 24 Stunden Daueraktivität.
Ich kenne beide Welten. Bevor ich nach Namibia ausgewandert bin, habe ich in Frankfurt am Main gelebt und im Schichtdienst gearbeitet. Von 9 bis 17 Uhr, von 12 bis 20 Uhr, von 15 bis 23 Uhr, ständig im Wechsel. Im Büro leuchteten die Neonröhren erbarmungslos über mir, als wollten sie mich antreiben und sagen: Es gibt keine Ausreden, die Arbeitswelt schläft nie.
Dunkel war es nur auf dem letzten Stück meines Heimwegs, vorbei am großen Friedhof. Kopfhörer raus, Herzfrequenz rauf, Sprint zur nächsten Laterne. Dunkelheit löste in mir ein Gefühl der Beklemmung aus, bis hin zur Panik. Vielleicht war diese Angst nicht ganz ungerechtfertigt, sexuelle Übergriffe und andere Bedrohungen in der Dunkelheit sind in Städten ja eine reale Gefahr.
"Wir sind doch nicht im Mittelalter!"
Doch auch von der Lichtverschmutzung geht für uns alle eine „unterschätzte Gefahr“ aus. So steht es im Untertitel des Buches Licht aus!?. „Wir leben sehr stark in künstlichem Licht, vor allem in Europa“, sagt dessen Autorin Annette Krop-Benesch. Warum, frage ich die Biologin,verdrängen wir die Dunkelheit immer mehr aus unserem Leben?
Zum einen gebe uns Licht ein Gefühl der Sicherheit, antwortet sie. Das leuchtet allein aus evolutionären Gründen ein: Wer seine Feinde sehen kann, ist ihnen nicht hilflos ausgeliefert. „Zum anderen ist es eine Frage der Modernität“, fügt Krop-Benesch hinzu. Für viele Menschen steht Licht nun mal für Fortschritt. Wenn die Biologin über Lichtverschmutzung spricht, stößt sie immer wieder auf Widerstand. „Ich höre oft Sätze wie: Sie wollen uns hier das Licht ausknipsen – wir sind doch nicht im Mittelalter!“
Doch diese Art von Fortschritt hat ihren Preis, vor allem für viele Lebewesen, mit denen wir die Erde teilen. In ihren Büchern beschreiben Krop-Benesch und Eklöf, wie künstliches Licht immer häufiger zur tödlichen Falle wird: Frisch geschlüpfte Meeresschildkröten können sich auf dem Weg zum Wasser nicht mehr an Mond und Sternen orientieren. Viele verirren sich und fallen Fressfeinden zum Opfer, noch bevor ihr Leben richtig angefangen hat. Vögel und Insekten werden von hell erleuchteten Gebäuden angezogen, ihr Blindflug ins Licht endet oft mit einem tödlichen Aufprall. Fachleute sprechen vom towerkill.
Sogar Bäume und Pflanzen kommen nicht mehr zur Ruhe, weil das künstliche Licht sie auch nachts zur Photosynthese anspornt. Die Liste ließe sich fortsetzen. Es scheint, als sei die ganze Welt aus dem Rhythmus geraten. Und natürlich kann sich auch der Mensch den Folgen nicht entziehen, wie Zoologe Eklöf schon lange geahnt hatte. „Am deutlichsten zeigt sich das daran, dass unser Schlaf gestört ist“, sagt er.
Es ist hell! Zeit, aufzuwachen!
Wenig später treffe ich mich virtuell mit Andrew Phillips vom Turner Institute for Brain and Mental Health im australischen Clayton. Der Psychologe erforscht unter anderem den Einfluss von Licht auf unseren zirkadianen Rhythmus, unsere innere Uhr also. Schon in seiner ersten Mail hatte Phillips geschrieben: „Die Wirkung von künstlichem Licht ist enorm und wird allgemein unterschätzt.“
Denn für unsere innere Uhr ist Licht der mit Abstand wichtigste Taktgeber. Ihre Steuerungszentrale sitzt im Gehirn, im suprachiasmatischen Kern (SCN). Wenn morgens die ersten Lichtreize auf die Netzhaut unserer Augen treffen, leiten sogenannte Fotorezeptoren ein Signal an den SCN weiter: Es ist hell! Zeit, aufzuwachen! Wenn das Licht abends dann wieder verschwindet, werden die Wachsignale blockiert. Unser Körper schüttet Melatonin aus. Wir werden müde und schlafen, bis der Zyklus am nächsten Morgen neu beginnt. So weit die Theorie. Die Realität sieht heute häufig anders aus.
„Das zirkadiane System regelt alle Prozesse in unserem Körper – wie ein Dirigent, der ein Orchester harmonisch spielen lässt“, sagt Phillips. „Wenn man dieses System durcheinanderbringt, kann das überall im Körper Auswirkungen haben“, sagt er. So steigt zum Beispiel das Risiko für Diabetes, Übergewicht und Krebs. Wer im Schichtdienst arbeitet, ist besonders gefährdet. In Deutschland ist das immerhin rund jede und jeder siebte Erwerbstätige.
Die Psyche im Nonstoptag
Phillips ging noch einen Schritt weiter: Gemeinsam mit seinem Team wollte er herausfinden, wie sich Lichtexposition auf die Psyche auswirkt. Also führten sie die bislang größte repräsentative Studie zu dem Thema durch. Das Team stattete mehr als 85000 Versuchspersonen mit Messgeräten aus, die Tag und Nacht die Lichtumgebung dokumentierten. Zusätzlich füllten die Teilnehmenden Fragebögen zu ihrem mentalen Wohlbefinden aus.
Das Experiment zeigte: Wer nachts einer hohen Lichtmenge ausgesetzt war, war anfälliger für psychische Erkrankungen. So stieg zum Beispiel das Risiko für Depressionen um 30 Prozent. Ähnliche Ergebnisse ergaben sich für posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen, Selbstverletzungen, bipolare Störungen und Psychosen. Umgekehrt galt aber auch: Wer tagsüber viel Zeit in natürlichem Licht verbrachte, konnte sein Erkrankungsrisiko um bis zu 20 Prozent senken.
„Wir hatten vorab die Hypothese aufgestellt, dass sich die Lichtexposition deutlich auf die mentale Gesundheit auswirkt“, sagt Phillips. „Trotzdem waren wir überrascht, wie stark der Zusammenhang ist.“ Hell am Tag, dunkel in der Nacht: Das ist der Rhythmus, den unser Organismus zum Wohlbefinden braucht.
Eine Studie aus den USA kam 2020 zu einem ähnlichen Ergebnis. Demnach schlafen Jugendliche in hell erleuchteten Gegenden schlechter und leiden häufiger an Stimmungs- und Angststörungen. Die Autoren stellten auch sozioökonomische Unterschiede fest. Je niedriger das Einkommen einer Familie, desto höher die Lichtverschmutzung in ihrer Wohngegend – und desto höher das Risiko, an psychischen Störungen zu erkranken. Im Zeitalter der Lichtverschmutzung scheint Dunkelheit zum neuen Luxus zu werden. „Es gibt eine Sache, die noch beängstigender ist als die Dunkelheit selbst“, schreibt die Autorin Emma Beddington im Guardian. „Eine Welt ohne sie.“
Risikofaktor: Die Stadt
Für ein gesundes Leben brauchen wir ein gleichmäßiges Wechselspiel von Licht und Dunkelheit. Das zeigt auch eine Studie aus dem Jahr 2015. Dafür untersuchte ein Forschungsteam die Schlafgewohnheiten der letzten verbliebenen Jäger-und-Sammler-Kulturen der Welt, darunter die San in Namibia. Im Durchschnitt schliefen die Bevölkerungsgruppen sieben Stunden, etwa genauso viel wie Menschen in der industrialisierten Welt.
Der große Unterschied: Die Mehrheit der Befragten in Jäger-und-Sammler-Gemeinschaften schlief friedlich durch. Schlafstörungen oder gar Schlaflosigkeit ist diesen Menschen so fremd, dass es in ihrer Sprache nicht einmal ein Wort dafür gibt. Sie schliefen durchschnittlich zweieinhalb Stunden nach Sonnenuntergang ein und wachten um den Sonnenaufgang herum auf – je nach Jahreszeit und Region eine Stunde früher oder später. Neben Licht beeinflusste zum Beispiel auch die Umgebungstemperatur den Schlaf.
Dass so vieles unseren Schlaf beeinflusst, mache Studien zu dem Thema so schwierig, sagt die Schlafforscherin Christine Blume von der Universität Basel: Was ist die tatsächliche Ursache und was eine Begleiterscheinung? In hell erleuchteten Städten gebe es meist noch andere Stressfaktoren, etwa eine höhere Bevölkerungsdichte.
„Möglicherweise ist den Menschen in urbanen Regionen zudem Arbeit sehr wichtig, während Menschen in ländlichen, dunkleren Gebieten ein eher ruhigeres Leben führen.“ Zumal unsere Lichtempfindlichkeit stark individuell ausgeprägt ist. „Einige unserer Studien haben gezeigt, dass Menschen ganz verschieden auf die gleiche Lichtumgebung reagieren können“, bestätigt der australische Forscher Phillips. In den nächsten Jahren will er entschlüsseln, woran das liegt. „Damit wir unsere Umwelt entsprechend gestalten können“, sagt er. Wie, fragt sich der Psychologe immer wieder, können wir das Wissen über die Wirkung von Licht in der Praxis umsetzen?
Sehnsucht nach visueller Stille
Phillips ist überzeugt: „Wenn die Erkenntnisse erst einmal in unseren Alltag einfließen, wird das die Art und Weise revolutionieren, wie wir an die Gesundheitsversorgung herangehen.“ Außerhalb der Expertenblase sei das Bewusstsein allerdings eher gering. Viel zu oft gingen die Menschen sorglos mit künstlichem Licht um – und auch in der Medizin finde das Thema zu wenig Beachtung.
Die Biologin Krop-Benesch sieht das ähnlich. „Wenn wir keine Kontrolle über das Licht um uns herum haben, dann erzeugt das Stress“, sagt sie. Es sei in etwa so, als ob jeden Abend laute Musik aus dem Nachbarhaus dröhnen würde: Selbst von unseren Lieblingsliedern hätten wir schnell genug. „Bei Lärm haben wir dieses Bewusstsein inzwischen“, sagt Krop-Benesch, „bei Licht noch nicht.“
Bleibt die Frage: Wie finden wir zurück zu unserem uralten, natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus? In einem sind sich all meine Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen einig: Ein Zurück zu einem Alltag ohne künstliches Licht wird es nicht geben. Lebenswelten wie die der San werden eine Seltenheit bleiben oder ganz verschwinden. „Vielleicht werden wir Auszeiten von künstlichem Licht in Zukunft als neue Art des Urlaubs sehen“, sagt Phillips. „Aber im Alltag wird das nie geschehen. Die Welt wird für immer und ewig nach größerem Wachstum streben.“
So viel größer, als wir selbst
Und doch: Es gibt immer mehr Menschen, die sich für den Schutz der Dunkelheit einsetzen. Da ist zum Beispiel die internationale Vereinigung DarkSky, die Gebiete mit klarem Nachthimmel auszeichnet und schützt. Oder der interdisziplinäre Forschungsverbund „Verlust der Nacht“, dem sich auch Krop-Benesch angeschlossen hat. Sie alle machen darauf aufmerksam, was wir mit der Dunkelheit verlieren: eine Orientierungshilfe für zahllose Lebewesen; die Chance, in visueller Stille innezuhalten und zur Ruhe zu kommen; den Blick in den Sternenhimmel. Die Sehnsucht danach ist heute so weit verbreitet, dass es sogar Begriffe dafür gibt, etwa noctalgia oder auch sky grief.
Als ich in den Nachthimmel über der Kalahari blicke, lehrt mich die Dunkelheit noch etwas anderes. Sie lässt mich demütig werden. So geht es auch dem Fledermausforscher Eklöf bei seiner Arbeit immer wieder. „Es ist ein Gefühl der Ehrfurcht, das sich nur schwer in Worte fassen lässt“, sagt er. „Für mich ist ein klarer Sternenhimmel eine Brücke zur Vergangenheit: So hat es da oben während der gesamten Erdgeschichte ausgesehen – und sogar noch darüber hinaus. All das ist so viel größer als wir selbst.“
Die Milchstraße – so lehrt es ein Mythos der San – entstand eines Abends, als ein Mädchen um ein Lagerfeuer tanzte. Sie warf die Glut in die dunkle Nacht, um ihrem Volk den Weg nach Hause zu weisen. Von da an leuchtete das silberne Band als Kompass für die Verirrten am Himmel – für immer, so hieß es.
Wollen Sie mehr zum Thema erfahren? Dann lesen Sie gerne fünf Empfehlungen für einen gesunden und natürlichen Tag-Nacht-Rythmus in So bringen Sie sich in Takt.
Quellen
Fabio Falchi u.a.: The new world atlas of artificial night sky brightness. Sci. Adv. 2, e1600377, 2016. doi: 10.1126/sciadv.1600377
Johan Eklöf: Das Verschwinden der Nacht. Wie künstliches Licht die uralten Rhythmen unserer Umwelt zerstört. Ein Sachbuch über Lichtverschmutzung und die Folgen für die Natur. Droemer 2022
Annette Krop-Benesch: Licht aus!? Lichtverschmutzung – Die unterschätzte Gefahr. Rowohlt Taschenbuch 2019
A. C. Burns, D. P. Windred, M. K. Rutter u.a.: Day and night light exposure are associated with psychiatric disorders: an objective light study in >85,000people. Nat MentHealth. Published online October 9, 2023. doi: 10.1038/s44220-023-00135-8
P. J. Sollars, G. E. Pickard:The neurobiology of circadian rhythms. Psychiatr ClinNorth Am., 38/4, 2015, 645–65. doi: 10.1016/j.psc.2015.07.003
C. Blume, C. Garbazza, M. Spitschan: Effects of light on human circadian rhythms, sleep and mood. Somnologie, 23/3, 2019, 147–156. doi: 10.1007/s11818-019-00215-x. Epub 2019 Aug 20. PMID: 31534436; PMCID: PMC6751071
D. Paksarian u.a.: Association of Outdoor Artificial Light at Night With Mental Disorders and Sleep Patterns Among US Adolescents. JAMA Psychiatry, 77/12, 2020, 1266–1275. doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.1935
E. Lucassen u.a.: Environmental 24-hr Cycles Are Essential for Health. Current Biology, 26, 2016, 1843–1853. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2016.05.038
G. Yetish u.a.: Natural sleep and its seasonal variations in three pre-industrial societies. Curr Biol., 25/21, 2015, 2862–2868. doi: 10.1016/j.cub.2015.09.046. Epub 2015 Oct 17. PMID: 26480842; PMCID: PMC4720388.
M. Kyba u.a.: Citizen scientists report global rapid reductions in the visibility of stars from 2011 to 2022. Science, 2023. https://doi.org/abq7781
Travis Longcore, Catherine Rich: Ecological light pollution. Frontiers in Ecology and the Environment, 2/4, 2004, 191–198, http://cybrary.fomb.org/pages/20040500%20Ecological%20light%20pollution.pdf