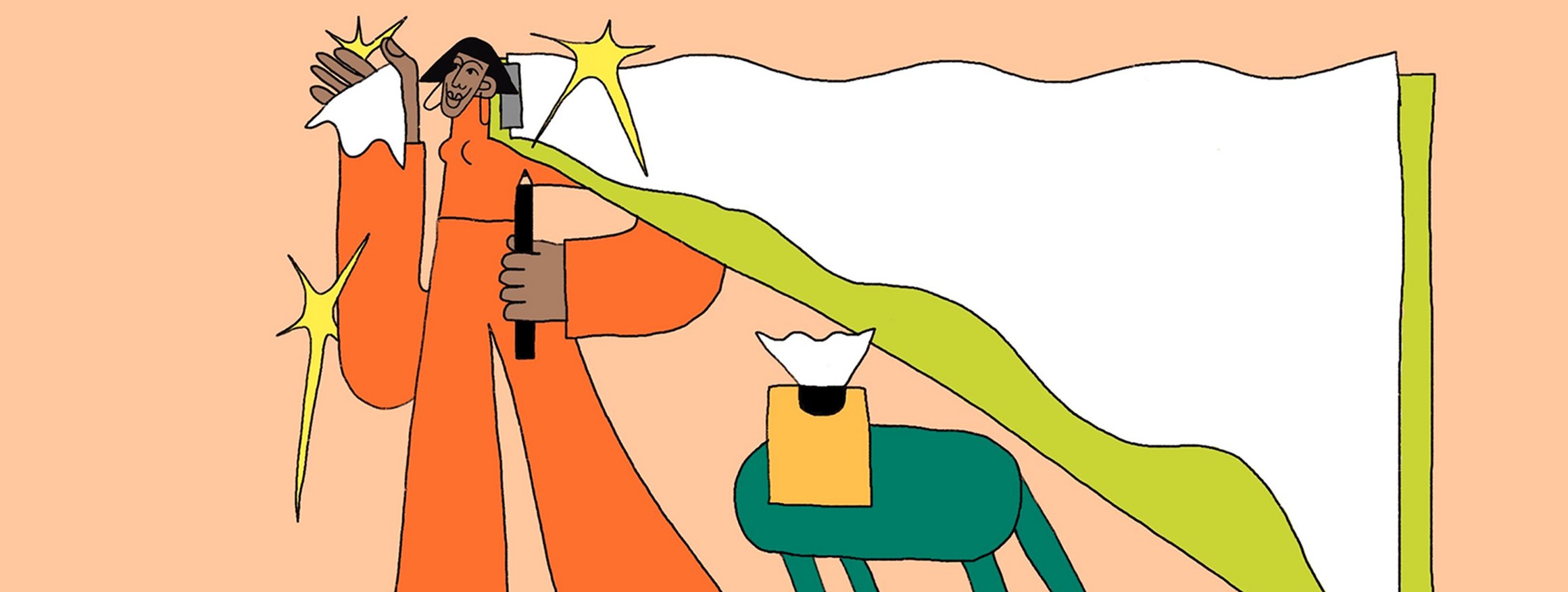Meine erste Sitzung als Psychotherapeutin in Ausbildung war an meinem allerersten Arbeitstag. Der Patient ließ sich auf einen Stuhl fallen und seufzte: „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin ein bisschen aufgeregt, heute ist ja mein erster Tag.“ Er fasste damit mein Gefühlsleben gut zusammen. Ich erinnere mich so gut an die Mischung aus Euphorie, Interesse und Nervosität, mit der ich das Gespräch führte. Mein Masterabschluss half mir bei der Diagnosestellung, aber nicht bei der Navigation durch das wunderschöne Chaos, das jede zwischenmenschliche Interaktion ausmacht.
Dass ich Therapeutin sein wollte, wusste ich bereits seit einer Weile, aber was bedeutet das eigentlich? Als Kind der 90er brauchte ich nur den Fernseher einzuschalten, um Vorbilder für die berufliche Entwicklung zu finden: Ob Serien über junge und übernächtigte Ärztinnen im Krankenhaus (wie in Greys Anatomy), scharfsinnige Rechtsanwaltsgehilfinnen (Suits, The Good Wife), idealistische Journalistinnen (The Bold Type) oder naive Filmemacher (Dawson‘s Creek) - Die Popkultur meines Jahrhunderts ist begeistert von hustle culture, jungen Talenten und intensiven Gefühlen. Die Protagonistinnen dieser Serien erleben Krisen, machen berufliche und private Fehler.
Ich träumte von den Anfängen, dem Versuchen, dem Scheitern. Für meine therapeutische Entwicklung gab es das nicht. Ich träumte nie davon, Therapeutin zu werden – sondern nur, zu sein. Therapeutinnen im Film sagen entweder orakelhaft all die richtigen Dinge – oder sie sind schlechte, moralisch zweifelhafte Behandlerinnen. Der allwissende, mittelalte Fernsehtherapeut mit Hemd, zu hoch sitzender Hose und zu weit hochgezogenen Augenbrauen schweigt über seine Entwicklung. Passend dazu, stellte ich mich meinem ersten Patienten als „Psychologin“ vor und ließ weg, dass ich auch Psychotherapeutin in Ausbildung bin. Beide Titel sind wahr und stehen in meinem Arbeitsvertrag. Aber ein Titel verbirgt, der andere zeigt die Entwicklung, in der ich mich befinde.
Ist das schon Therapie?
Die Vorbilder nach denen ich suche, sind junge, zweifelnde, und zeitgleich leidenschaftlich strebende Therapeutinnen. Solche, die gemeinsam mit einem Kaffeebecher in der Hand und Tränen in den Augen eine misslungene Sitzung mit Kolleginnen nachbesprechen. Die sich häufig fragen, ob das, was da in ihrem Büro stattfindet, wirklich Therapie ist – oder einfach das beste Gespräch, das sie gerade anbieten können. Die einen Meilenstein im therapeutischen Prozess feiern. Oder einfach nur angefressen von eigenem Liebeskummer, Schlafmangel und Klinikalltag über die Chefärzte schimpfen.
Diese Therapeutinnen gibt es tatsächlich: Wir sitzen in kleinen Büros mit zu vielen Schreibtischen, mit Haarbürsten im Aktenschrank und geteilter Kaffeemaschine. Wir leihen uns gegenseitig hilfreiche Arbeitsblätter zu Borderline- Störung oder Depressionen und klagen über anstrengende Therapieverläufe. Wir rätseln über Diagnosen und erzählen einander begeistert von unseren Ausbildungsseminaren. Die meisten von uns sind gleichzeitig unsicher und verliebt in diesen Beruf. Ich bin es jedenfalls.
Wieso dürfen wir das in der Popkultur nicht kennenlernen? Wo sind die Heldinnen? Vielleicht, weil die meisten Menschen nicht wissen wollen, dass ihr Therapieprozess Arbeit ist. Grund für (Selbst-)Zweifel und Wachstum. Weil es in der Therapie verständlicherweise um sie selbst gehen soll. Vielleicht auch, weil es ganz schön unheimlich ist, sich vorzustellen, dass die Person, mit der wir gerade unsere intimsten Gedanken teilen, selbst unsicher ist, was sie dazu sagen soll. Mich verletzlich zu zeigen ist leichter, wenn ich vertraue. Und zu vertrauen ist leichter, wenn mein Gegenüber erfahren zu sein scheint. Vielleicht wäre es aber auch heilsam zu wissen, dass die Therapeutin vor mir ein Mensch unter Menschen ist. Noch dazu einer, der so motiviert ist, wie selten im Laufe des Berufslebens. Fehlbar, aber auch gut vorgebildet. Vielleicht. Vielleicht nicht.
Die Antwort ändert nichts daran, dass wir jungen Therapeutinnen eine Stimme brauchen. Mittlerweile stelle ich mich deshalb häufiger als „Psychotherapeutin in Ausbildung“ vor. Wir müssen in unserer Entwicklung sichtbar sein. Für uns und die träumenden Teenager.


Transparenz-Hinweis: Es gibt keine Therapeutin ohne Patientinnen –- deshalb erzählt diese Kolumne von Menschen in der Psychiatrie. Da der Schutz der Behandelten an oberster Stelle steht, werden die Fallbeispiele bezüglich ihrer soziodemographischen und biografischen Daten stark verändert und erscheinen mit zeitlichem Abstand. Die berichteten Begegnungen ereignen sich in unterschiedlichen Ausbildungskontexten. Sie bleiben in ihrem emotionalen Kern erhalten.