Der Therapieprozess mit Frau F. fühlte sich an, wie ein Lauf über eine Penrose-Treppe. Penrose-Treppen sind optische Täuschungen und gehen immer wieder in sich selbst über. Auch Frau F. und ich kamen immer wieder zum selben Punkt: Sie hatte keine Hoffnung für sich selbst. Frau F. hatte während ihrer langandauernden psychischen Belastung ihre Anstellung, ihre Partnerschaft und einen großen Teil ihrer finanziellen Reserven verloren. Nach einer längeren Reihe von Behandlungen kam sie zu uns. Frau F. ging es besser und schlechter zugleich. Einerseits konnte sie wieder klarer auf sich und ihr Leben blicken. Andererseits sehnte sie sich nach der Zeit vor ihrer Erkrankung zurück.
Ich hatte große Sympathien für Frau F. Sie war eine warmherzige Mutter und bestechend klug. Zu Beginn jeder Stunde lächelten wir uns herzlich zu – und dann begannen ermüdende Sitzungen, in denen sich weder die Verluste betrauern, noch die Zukunftsperspektiven betrachten ließen. Während wir auf dem Gang manchmal einen kurzen Scherz austauschten und in den Gruppentherapien ein flüssiges Gespräch entstand, saßen wir hier einander ratlos gegenüber. Wir steckten fest.
Diese Stunde sollte das anders sein. Ich hatte zwei zusätzliche Stühle bereitgestellt. Nach zehn Minuten regulärem Dialog bat ich Frau F., mit mir auf die beiden freien Stühle zu wechseln. Ich lud sie ein, sich mit mir vorzustellen, wir könnten das vergangene Gespräch wie auf einem Fernseher betrachten. Als ich Frau F. fragte, was sie sehe, sagte sie, wie für sie üblich knapp und präzise: „Frau Farnbacher stellt positive Fragen und Frau F. ist auf Abwehr.“ Wir mussten kurz lachen, dann fragte ich sie, ob sie sich vorstellen könnte, welche Verhaltensweisen von Frau Farnbacher hilfreich für Frau F. sein könnten. Sie schwieg kurz, blickte mich dann verschmitzt an und sagte: „Dranbleiben.“ Es war ihre Art, mir zu sagen, dass sie noch Zeit brauchte. Dass die Therapie sich für uns beide manchmal zäh anfühlte, aber vielleicht doch eine nach oben führende Wendeltreppe statt einer Penrose-Treppe war.
Ich würde gern behaupten, dass danach alles anders war. Das war es nicht. Bis zuletzt blieb unser Prozess kleinschrittig und anstrengend. Aus dem Studium weiß ich, dass jede Therapie auch sogenannte Non-Responder hat. Personen, die trotz korrekter Therapiedurchführung und Engagement (noch) keine Veränderungen erleben. Aber wann ist der Punkt erreicht, an dem ich zu diesem Schluss kommen darf und will? Frau F. hatte so viele Belastungen erlebt, durfte sie nicht alle Zeit der Welt brauchen? Ich verwandte meine Supervisionssitzungen auf diesen Fall, sprach mit Kolleginnen, probierte so ziemlich alles zwischen mehr Gelassenheit und mehr Engagement. Ich gab ihr, was ich ihr geben konnte und blieb mit der Frage zurück, was eine erfahrenere Therapeutin wohl getan hätte.
Dennoch ging es mir nach dem „Stuhlwechsel“ besser mit unserem Prozess. Ich hatte einen Weg gefunden, mich mit Frau F. auf einer Meta-Ebene auszutauschen. Ab diesem Punkt waren „hakelige“ Stunden besprechbar, konnte ich kenntlich machen, dass es erwünscht war, unseren Prozess beidseitig zu hinterfragen. Frau F. und ich waren transparent miteinander. Sie berichtete offen, wenn Methoden und Fragen ihr nichts brachten, ich fühlte mich freier, zur Debatte zu stellen, ob sie von der Behandlung profitierte und sie in die Therapieplanung miteinzubeziehen.
Ein Teil von mir war erleichtert, als sie ging – ein Teil von mir vermisste sie. Eigentlich verstehe ich meine Arbeit als Prozess, in dem ich mich selbst abschaffe. Im Idealfall geschieht das durch mehr Selbstwirksamkeit und „Werkzeuge“, die die Patientinnen erlangen . Manchmal wohl auch durch ein schieres Ende der Behandlungszeit oder eigenen Kapazität. Denn irgendwann heißt es in jedem Prozess: loslassen.

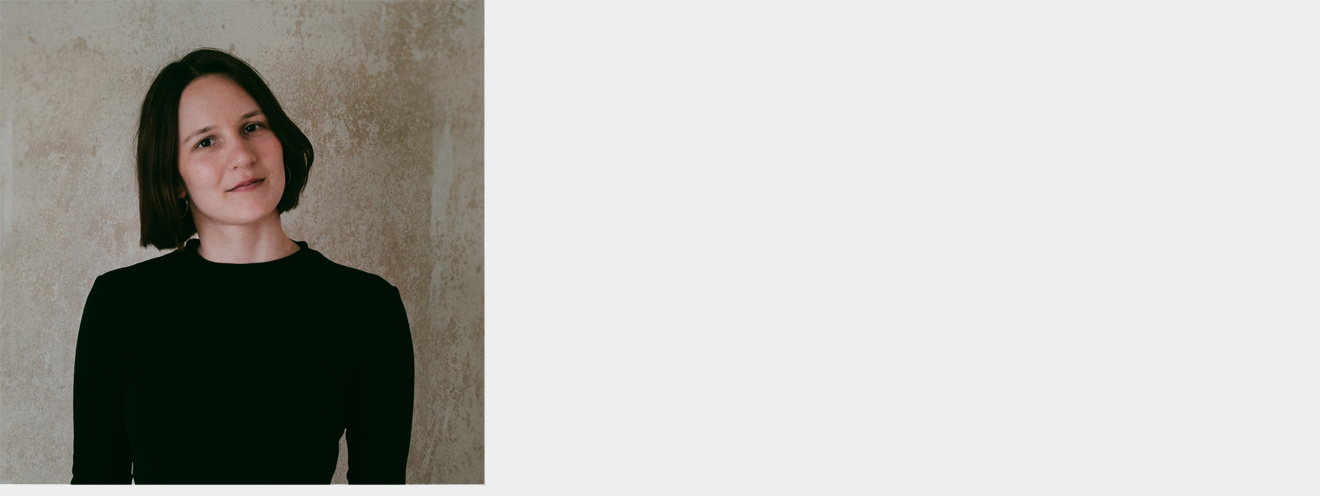
Transparenz-Hinweis: Es gibt keine Therapeutin ohne Patientinnen – deshalb erzählt diese Kolumne von Menschen in der Psychiatrie. Da der Schutz der Behandelten an oberster Stelle steht, werden die Fallbeispiele bezüglich ihrer soziodemographischen und biografischen Daten stark verändert und erscheinen mit zeitlichem Abstand. Die berichteten Begegnungen bleiben in ihrem emotionalen Kern erhalten.







