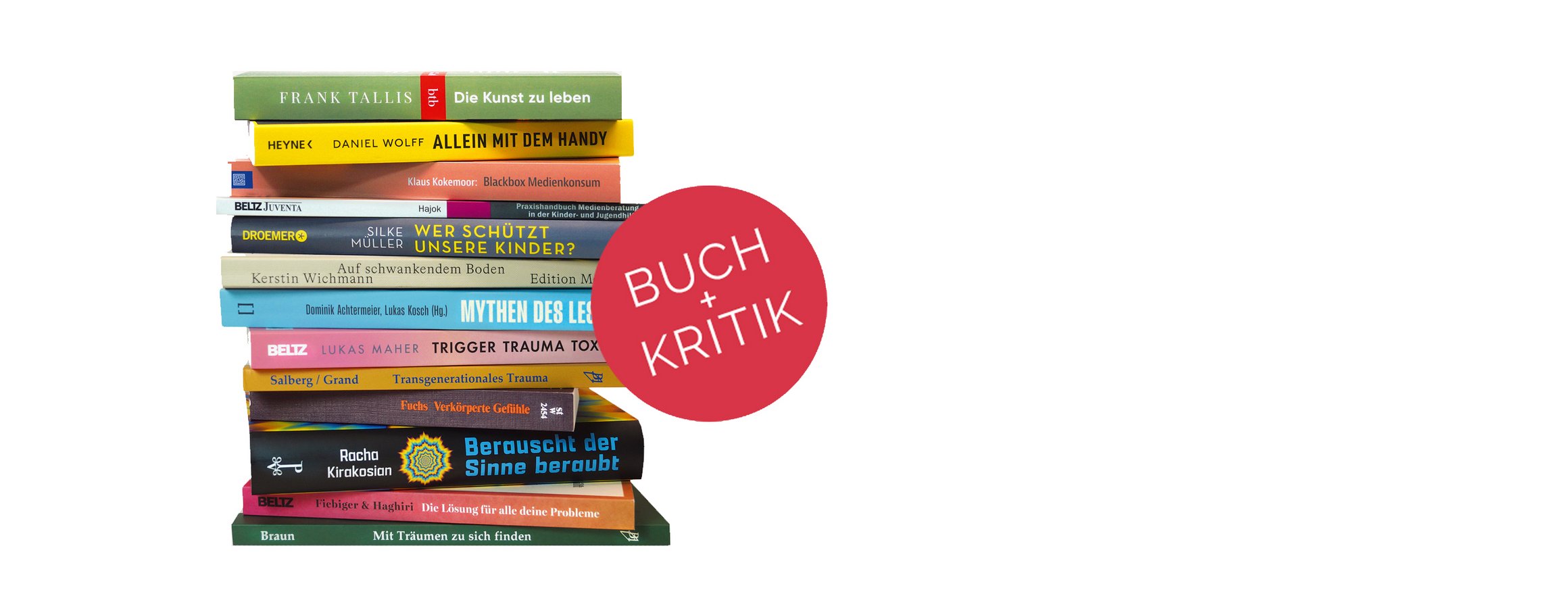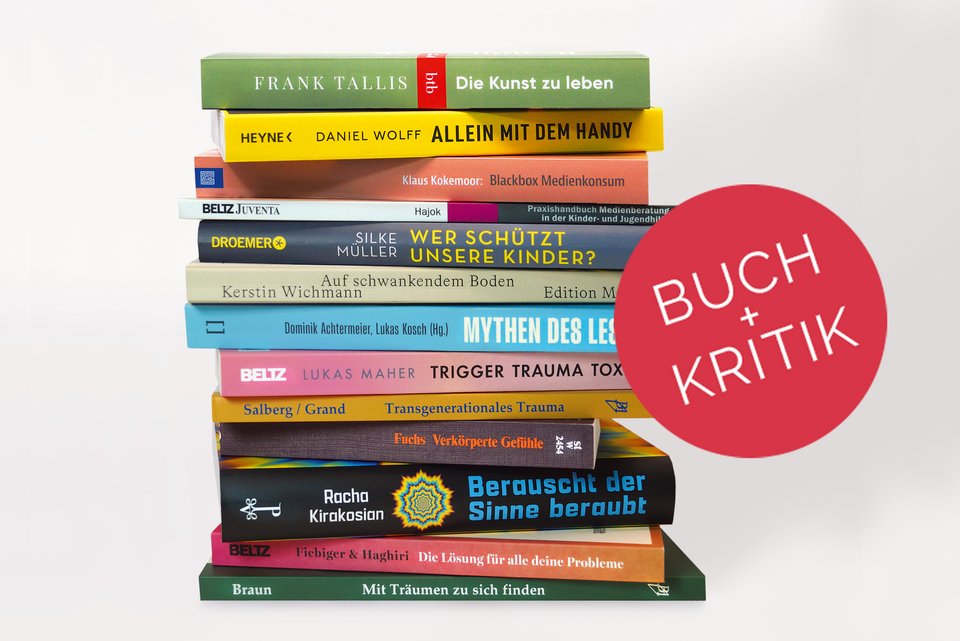Sie tragen noch Windeln und wissen doch schon, wie man über ein Smartphone wischen muss, um an bestimmte Apps zu gelangen. 2023 hatten 20 Prozent der Kleinkinder ím Alter von zwei bis fünf Jahren Zugang zu smarten Geräten – das entspricht einer Steigerung um 50 Prozent im Vergleich zu 2020. Sollten Kleinkinder Medien konsumieren? Wie viel Zeit am Smartphone wäre für ältere Kinder sinnvoll? Und müssten wir sie nicht auch auf ein Leben mit künstlicher Intelligenz (KI) vorbereiten? Vier Bücher befassen sich mit diesen und anderen Fragen zum Medienkonsum unserer Kinder. Drei Sachbücher richten sich an Eltern und Pädagoginnen. Ein Praxishandbuch soll Fachkräfte in Hilfeeinrichtungen unterstützen.
Ahnungslose Eltern
Die allermeisten Eltern, so Daniel Wolff, hätten keine Ahnung, was ihren Kindern im Internet geboten wird: brutalste Gewaltdarstellungen, Rassismus, Pädophile auf Kinderjagd, Sexting (Sex + Texting – das Verschicken selbstgemachter Nacktbilder) mit katastrophalen Folgen, Glücksspiel-Abzocke – das alles in vermeintlich harmlosen Spielen verpackt. Der Autor, Gymnasiallehrer und IT-Journalist arbeitet heute als Digitaltrainer an Schulen in ganz Deutschland. Er kann auf eine Erfahrung aus über tausend Workshops mit Kindern und deren Eltern zurückgreifen.
Im ersten Teil seines Buches beschreibt er, was die Kinder ins Internet zieht und was sie dort erwartet. Im zweiten Teil geht es darum, wie sie geschützt werden und doch die Chancen der digitalen Welt für sich nutzen können.
Viele Kinder nehmen Smartphone mit ins Bett
Mehr als die Hälfte der Eltern erlauben ihren Schulkindern ein Smartphone mit ins Bett zu nehmen, so Wolff – „zum Einschlafen oder als Wecker“. Viele Kinder nähmen das Gerät auch heimlich mit ins Bett. Es falle Kindern schon auf, dass nachts „härtere Videos“ präsentiert würden. Hier seien „profitorientierte Empfehlungsalgorithmen“ im Spiel, die Betrachterinnen und Betrachter wachhalten sollen, damit so lange wie möglich Daten gesammelt und Werbung gezeigt werden können.
Neugier, der Reiz des Verbotenen, aber auch Gruppendruck (man wolle nicht der oder die Einzige sein, die das krasse Video nicht gesehen hat) verführe die Kinder zum Konsum dieser gewalttätigen, oft gut getarnten Filmchen. Danach blieben sie geschockt und allein zurück. Nur zehn Prozent offenbarten sich ihren Eltern. Diese müssten endlich begreifen, dass „digitale Medienerziehung“ eine ihrer Hauptaufgaben ist. Das Buch ist ein Weckruf für Eltern, sich den digitalen Realitäten zu stellen und Verantwortung zu übernehmen.
Auch Klaus Kokemoor ist der Meinung, dass wir erst langsam erkennen, dass unkontrollierter Medienkonsum massive Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung hat. Kinder erlebten immer häufiger die Abwesenheit von Eltern – trotz physischer Anwesenheit.
Kokemoor – er ist Sozialpädagoge, Psychotherapeut und Fachberater für Kitas – beschreibt den Einfluss digitaler Medien auf den kindlichen Reifungsprozess. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten feststellen, dass die Konzentrationsfähigkeit und Impulskontrolle von Kindern mit zunehmender digitaler Mediennutzung sinken.
Im ersten Teil seines Buches reflektiert er seine Einblicke in das „herausfordernde Verhalten“ von Kindern– verstanden etwa als Aggressionen, Sachbeschädigungen oder Fremdverletzungen. Im zweiten Teil wird versucht, bei Eltern ein Bewusstsein für den Einfluss der sozialen Medien zu fördern. Sie müssten in die Lage versetzt werden, ihre Kinder zu „medienmündigem“ Verhalten anzuleiten – verstanden als „die Fähigkeit, digitale Medien dosiert aktiv, kritisch, reflektiert und technisch versiert nutzen zu können“. Das wirksamste Mittel der Prävention sei, „wenn Eltern ihren Mediengebrauch in Gegenwart ihrer Kinder bis drei Jahren unterlassen“.
Sensibilisieren anstatt Verbote aufstellen
Für Kinder ab drei bis sechs Jahren wird maximale Bildschirmzeit von 30 Minuten täglich, gemeinsam mit den Eltern, empfohlen. Kitas sollten Eltern sensibilisieren, aber keine Verbotsschilder aufstellen. Wenn es gelänge, den Medienkonsum im Vorschulalter einzuschränken, könnten schnell Verhaltensänderungen eintreten. Ein wichtiges Buch mit konkreten Handlungsempfehlungen, das Eltern allerdings viel abverlangt.
Den Lehrkräften an Schulen, aber auch Fachkräften in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bescheinigt Daniel Hajok eine „fehlende Professionalisierung hinsichtlich medienbezogener Fragestellungen“. Dieser fehlenden Sachkompetenz versucht das Praxishandbuch des Wissenschaftlers, der sich mit Mediensozialisationsforschung beschäftigt, entgegenzuwirken.
Im ersten Teil werden die Mediennutzung und die dadurch veränderten Lebenswelten junger Menschen skizziert und Chancen und Risiken des Medienkonsums abgewogen. Im Hauptteil geht es um Handlungsempfehlungen, praktische Unterstützungsangebote und Leitlinien für Medienkonzepte.
Im Internet finden sie Antworten auf all ihre Fragen
Spätestens mit zehn Jahren, wenn die meisten Kinder ein eigenes Handy erhielten, entziehe sich der Medienumgang erzieherischen Einflussnahmen. Vor allem Mädchen sind beim kommunikativen Austausch im Netz und dem Verfolgen dessen, was andere treiben, sehr aktiv. Jungen tauchten häufiger und länger in digitale Spielwelten ein. Je weniger Anregungen Kinder aus ihrem direkten sozialen Umfeld erhielten, um so bedeutsamer würden die Anregungen aus den Medien: „Die Jugendlichen suchen und finden heute im Netz quasi all das, was sie an Information und Orientierung benötigen: Antworten auf Fragen aller Art, praktische Unterstützung zur Bewältigung des Alltags und sogar Beratung bei persönlichen Krisenerfahrungen.“ Politische Inhalte würden dabei eher als „Beifang“ mitgenommen.
Das Buch ist nicht theorielastig, es zeigt praktische Möglichkeiten auf, wie Fachkräfte die Herausforderungen im Umgang mit den digitalen Medien bewältigen können.
Allerdings: Die digitale Entwicklung verläuft rasant. Es reicht heute schon nicht mehr, sich auf Social Media auszukennen. Wichtig ist zu verstehen, dass KI und soziale Netzwerke eine oftmals erschreckende Allianz eingehen. Darauf macht Silke Müller aufmerksam. „Wussten Sie, dass es möglich ist, Videos komplett zu verändern, dass es Apps gibt, die Menschen virtuell entkleiden und nackt darstellen?“ Die Schulleiterin präsentiert Beispiele aus dem Schulalltag. So sei im Klassenchat einer neunten Klasse ein Video aufgetaucht, das schwerste pornografische Handlungen zeigt und in dem eine Darstellerin das Gesicht einer Mitschülerin hat.
Cybergrooming, ein weiteres Problem unter vielen, passiere, wenn Erwachsene das Vertrauen von Kindern gewinnen – um sie dann zu missbrauchen. „Es ist für mich einfach unbegreiflich, dass unsere zivilisierte Gesellschaft nicht in der Lage ist, diese Bedrohung und den Angriff auf die Unversehrtheit unserer Kinder zu stoppen.“ Aufklärung und Bildung seien Schlüsselelemente zur Bekämpfung der negativen Auswirkungen von KI. Die Autorin entwickelt konstruktive Ideen für den Umgang, die aber Eigeninitiative bei den Eltern und Veränderungswillen beim „dysfunktionalen System Schule“ voraussetzten.
Die Medienkompetenz der Eltern ist der Schlüssel zum Schutz der Kinder im Internet – das unterstreichen alle vier Autoren.
Daniel Wolff: Allein mit dem Handy. So schützen wir unsere Kinder. Klassenchat, Mobbing, Pornos, Gewaltvideos – was Kinder online wirklich erleben. Heyne 2024, 320 S., € 16,–
Klaus Kokemoor: Blackbox Medienkonsum. Kinder beim Aufwachsen in der digitalisierten Welt gut begleiten. Eine Orientierung für Eltern und Fachkräfte. Psychosozial 2024, 292 S., € 26,90
Daniel Hajok: Praxishandbuch Medienberatung in der Kinder- und Jugendhilfe. Juventa 2024, 151 S., € 22,–
Silke Müller: Wer schützt unsere Kinder? Wie künstliche Intelligenz Familien und Schule verändert und was jetzt zu tun ist. Droemer 2024, 220 S., € 21,–