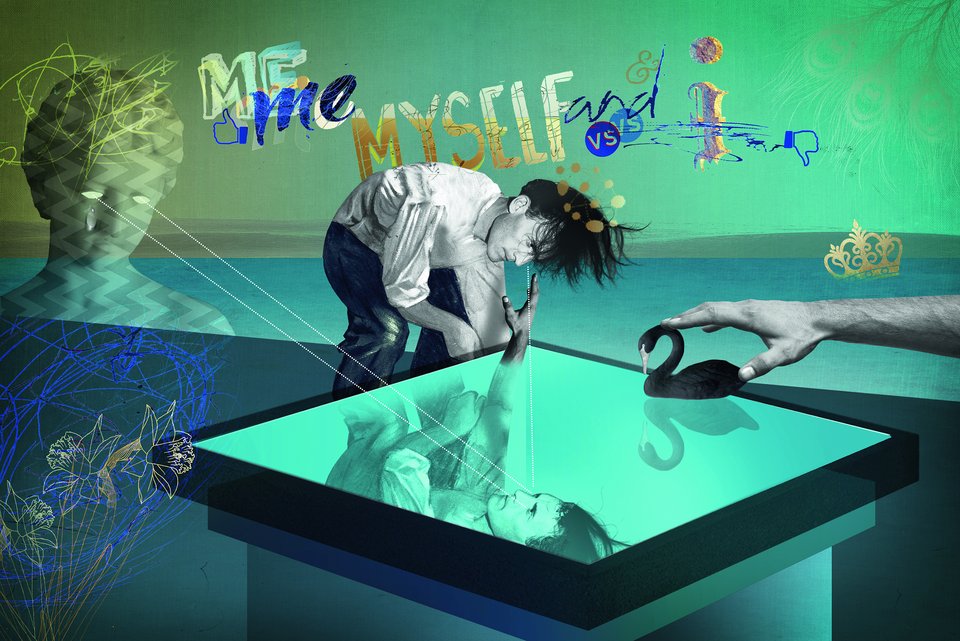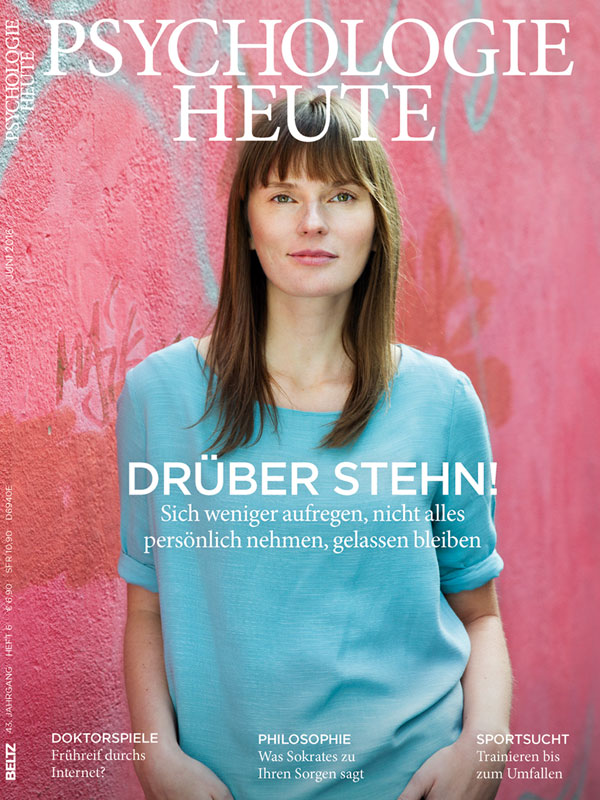Wladimir Putin sitzt mit nackter, stolzgeschwellter Brust auf einem Pferd, beugt sich über einen erlegten Tiger oder blickt entschlossen aus dem Cockpit eines Kampfjets. US-Präsident Donald Trump bezeichnet sich selbst als „wahrhaft großartigen Führer“ und beleidigt weibliche Kritiker gern mal als hässlich. Von Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy und Gerhard Schröder bleiben vor allem die Posen zur Schau gestellter Großartigkeit in Erinnerung. In der Politik ist es seit jeher üblich, machtvolle Männlichkeit…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
seit jeher üblich, machtvolle Männlichkeit zu inszenieren: Narzissmus regiert die Welt.
Nirgendwo zeigt sich so deutlich wie in der Politik, wohin ein aufgeblähtes Ego führen kann: an die Spitze und in die Katastrophe. Höhenflug oder Absturz –diese Ambivalenz begleitet Narzissten im Beruf ebenso wie im Privaten.
„Ob sich narzisstische Eigenschaften als Vorteil erweisen oder in die Sackgasse führen, kommt sehr auf die Umstände an“, sagt Stefan Röpke, Leiter des Bereichs Persönlichkeitsstörungen am Centrum für Psychiatrie der Berliner Charité. „In Extremsituationen kann der unbedingte Führungsanspruch eines Narzissten erwünscht sein, während die gleiche Rücksichtslosigkeit in ruhigeren Zeiten möglicherweise im Gefängnis endet.“ Narzissmus werde heute als Persönlichkeitsmerkmal verstanden, das bei jedem Menschen angelegt, allerdings unterschiedlich stark ausgeprägt sei. Problematisch werde Narzissmus allein durch die Dosis.
Fantasien von Macht und Erfolg
„Kern des Narzissmus ist ein Selbstwertproblem“, meint Röpke. „Dieses geringe Selbstwertgefühl versucht der Narzisst zu stabilisieren, indem er zum Beispiel sich aufwertet und andere abwertet.“ Seit 1982 wird die narzisstische Persönlichkeitsstörung im Diagnosemanual DSM als eigenständiges Störungsbild erfasst. Im DSM-5 von 2013 werden diverse Merkmale aufgelistet – vom übertriebenen Selbstwertgefühl über andauernde Fantasien von Macht und Erfolg bis hin zu Neid und arrogantem Verhalten. Um den Grad einer Störung zu erreichen, müssen Kognition, Affektivität, Impulskontrolle und Beziehungen dauerhaft von der Norm abweichen.
Doch „entscheidend dafür, ob eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vorliegt, ist der Leidensdruck des Betroffenen“, sagt Röpke. Demnach kann man sich also permanent für den Größten und Besten halten und sich suchtartig nach Bewunderung verzehren, ohne dass sich daraus per se dringender therapeutischer Behandlungsbedarf ergibt. In einigen Milieus und Berufen ist der Egotrip geradezu ein Erfolgsrezept und kann dabei helfen, in die Chefetagen aufzusteigen. Überall, wo Durchsetzungsvermögen und Entscheidungsstärke gefragt sind, kann der Narzisst glänzen und die Bewunderung aufsaugen, die er so sehnlich begehrt. Etwa beim Militär, in Behörden oder Konzernen mit einer autoritätsfixierten Unternehmenskultur.
„Das narzisstische Bedürfnis nach sozialer Anerkennung deckt sich mit gesellschaftlichen Werten wie Ehrgeiz, Leistungsstreben und Erfolg“, sagt Sabine C. Herpertz, Direktorin für Allgemeine Psychiatrie am Universitätsklinikum Heidelberg. „Wo es deutliche Hierarchien gibt und Führung erwartet wird, kann ein narzisstischer Persönlichkeitsstil erfolgreich sein. Wenn kooperatives Verhalten gefragt ist, bereitet dieser Stil allerdings Probleme.“ Denn der Narzisst ist ein miserabler Teamspieler. Er neigt dazu, soziale Kontakte danach auszuwählen, ob sie ihm nützen. Gern buckelt er nach oben und tritt nach unten. Auf Kritik reagiert er hochempfindlich. Vergleichsweise harmlose Auslöser könnten Wut, Hass, ja sogar Gewalt bewirken, so Stefan Röpke.
Therapie als letzte Konsequenz
Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind denkbar schlecht dafür ausgestattet, dauerhaft tiefe und erfüllende Beziehungen zu führen. „Zwischenmenschlich ist nämlich nicht Durchsetzungsfähigkeit gefragt, sondern Kompromissfähigkeit“, sagt Herpertz. „Um mit einem Partner gleichberechtigt zusammenzuleben, müsste der Narzisst einen deutlich anderen Stil pflegen als im Beruf.“ Dieses Defizit, emotionale Gleichberechtigung herzustellen, hält auch Röpke für gravierend. Solche Partnerschaften litten daher langfristig an einem Mangel an Empathie und Wärme.
In der ersten Beziehungsphase wird der narzisstische Partner noch als reizvoll und aufregend erlebt. Studien belegen eine Art Blendereffekt. In ersten Begegnungen kann der Narzisst seine Gesprächspartner mit Charme, Witz, Intelligenz und attraktivem Selbstbewusstsein betören. Seine Selbstbezogenheit wird erst nach mehreren Treffen als störend empfunden. In Liebesbeziehungen womöglich noch später, weil der Partner anfangs idealisiert und negative Facetten eher ignoriert werden. „Erst wenn die rosarote Brille einer realistischen Sichtweise weicht, erkennt man die narzisstischen Eigenschaften“, sagt Röpke. „Dann ist man aber möglicherweise schon eine tiefe Beziehung eingegangen, hat geheiratet oder ein gemeinsames Kind. Dem Angehörigen bleibt als letzte Möglichkeit nur, mit der Konsequenz zu drohen: Wenn wir uns keine Hilfe suchen, bin ich weg.“
Psychiaterin Herpertz rät Angehörigen, sich nicht zu unterwerfen oder unterzuordnen. Darauf reagiere der Narzisst nur mit Abwertung. Stattdessen sollten eigene Interessen und Autonomie nicht aufgegeben werden. Viele, die in einer Partnerschaft dauerhaft nicht wahrgenommen werden oder etwa durch narzisstisch motivierte Seitensprünge tief verletzt werden, leiden heftig an der Seite eines Menschen, der sich selbst mehr als alle anderen liebt.
„Therapie? Ich bin perfekt!“
Doch auch wenn daheim Konflikte und Streit zum Dauerzustand werden –von sich aus wird ein Narzisst keine Hilfe suchen. Nicht mal, wenn sein Verhalten offenkundig dazu beiträgt, die Familie zu zerrütten oder Partnerschaften regelmäßig in die Brüche gehen. Das liegt an der Ich-Syntonie seiner Persönlichkeit: Er selbst empfindet sich ja nicht als gestört, sondern als großartig. Schuld haben immer die anderen. Darin liegt das narzisstische Dilemma. Wer sich selbst für perfekt hält, sieht keinen Grund für eine Therapie. Niemand geht wegen seines Narzissmus zum Arzt oder Therapeuten.
Meist gibt es einen Auslöser, der den Betroffenen abrupt aus der Bahn wirft und seine bislang verdeckte verletzliche Seite bloßlegt: Der Partner verlässt ihn. Ihm wird gekündigt. Obwohl er doch so ein großartiger Liebhaber ist, ein ganz und gar unverzichtbarer Leistungsträger. Solche Kränkungen hält er nicht aus. Dann bricht alles zusammen. „Narzisstische Patienten sehen wir im klinischen Alltag am häufigsten mit einer schweren Depression. Daneben kommen auch Suchterkrankungen vor, nicht zuletzt im Zusammenhang mit Stresssymptomen und Erschöpfung“, erläutert Herpertz. „Dann bietet sich die therapeutische Chance, auch die Persönlichkeitsstörung zu behandeln. Erst durch eine schwere Krankheit sind viele bereit, darüber nachzudenken, ob die Krise eine Folge des eigenen interpersonellen Stils sein könnte.“
Behandlung – ein langer Weg
Die psychologischen Schulen haben zwar eine Vielzahl verschiedener Therapien zur Behandlung narzisstischer Störungen entwickelt, doch liegen keine zuverlässigen Studien vor, ob und wie sie wirken. Da bei Narzissten offenbar frühe Lebens- und Lernerfahrungen in starre Muster geführt haben, hält es Röpke für notwendig, diese tiefsitzenden persönlichen Strukturmuster therapeutisch zu korrigieren. Gleichwohl erachtet Kollegin Herpertz aufgrund ihrer klinischen Erfahrung eine langjährige Therapie bei einer narzisstischen Störung meist nicht für angemessen, weil es ja nicht darum gehe, die Persönlichkeit vollständig zu verändern. Vielmehr werde eine Flexibilisierung des Verhaltens angestrebt, eine Erweiterung des individuellen Repertoires. Viele Patienten profitierten schon von 25 Stunden Kurzzeittherapie, so Herpertz. Bei schweren Fällen mit wenig Einsicht brauche es mitunter 40 Sitzungen.
Der wichtigste therapeutische Behandlungsschritt besteht zunächst darin, gemeinsam zu erarbeiten, dass überhaupt eine Störung vorliegt. Der Therapiebeginn ist eine sensible Phase. Narzisstische Persönlichkeiten neigen dazu, die Behandlung früh abzubrechen, was allein schon deshalb problematisch ist, weil ihre Suizidrate hoch ist. „Daher ist es anfangs entscheidend, ein vertrauensvolles Verhältnis zu dem Patienten aufzubauen. Da Narzissten hochsensibel auf Kritik reagieren, muss der Therapeut anfangs alles vermeiden, was als Kränkung verstanden werden kann“, berichtet Herpertz. Erst wenn sie sicher sind, nicht moralisch abgewertet zu werden, steige für Patienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung die Motivation, mitzuarbeiten.
Aha-Effekte in der Therapie
In der Klinik für Allgemeine Psychiatrie der Universität Heidelberg behandelt Herpertz narzisstische Patienten auf Grundlage der kognitiven Verhaltenstherapie. Zu Beginn jeder Therapie werden gemeinsam Ziele vereinbart. Droht gerade eine Partnerschaft in die Brüche zu gehen, kann ein Ziel sein, weniger Konflikte auszutragen und die Qualität der Beziehung zu verbessern. Eine wichtige Technik, um die Wahrnehmung eigener Muster zu schulen und zu korrigieren, sind Rollenspiele, die mit einer Videokamera aufgezeichnet und anschließend gemeinsam ausgewertet werden. Im Rollenspiel nehmen die Patienten die Rolle von ihren Familienangehörigen oder Ehepartnern ein und erleben, wie es sich anfühlt, auf ein narzisstisches Verhalten zu treffen.
Günter Bender (Name geändert) war seit seiner Schulzeit ein Erfolgsmensch. Als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens gab er stets den starken Mann, was ihm großen Respekt einbrachte. Doch als dann eines Tages das Erwerbsleben endete, war auch die Ära der Bewunderung vorbei. Bender fiel in ein tiefes Loch. Als der Rentner eine Psychotherapie begann, klagte er über depressive Symptome. Das Leben erschien ihm sinnlos. Immer habe er sich über Erfolg definiert. Anerkennung von seinen Eltern bekam er nur, wenn er etwas leistete. Gefühle zu zeigen, lernte er nicht, aus Angst, als Schwächling dazustehen. Im Ruhestand gab es nun immer häufiger Streit mit seiner Frau. Früher sei er fremdgegangen, wenn es daheim Ärger gab. Nunmehr wolle er das Verhältnis zu seiner Frau verbessern, auch weil er auf sie angewiesen sei.
In der Psychotherapie lernte Bender zunächst Stärken und Schwächen seiner Persönlichkeit kennen. Dass die Fixierung auf Erfolg und Bewunderung ein inadäquater Versuch war, sein Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Als Hauptziele der Therapie vereinbarten Therapeutin und Patient, sein grandioses Selbstbild und die Überempfindlichkeit gegenüber Kritik abzubauen und vor allem nachempfinden zu lernen, was seine Frau fühlte, wenn er sie von oben herab behandelte und abkanzelte.
Das kalte Verhalten spiegeln
In der Gruppentherapie nahm eine Patientin im Rollenspiel die Position seiner Partnerin ein. Sofort stritten sie heftig. Sie warf ihm vor, er sei egoistisch und kränke sie mit seiner Mischung aus Arroganz und Distanz. Bis hierhin reagierte Bender auf das Rollenspiel wie so oft: amüsiert, mit Spott. Als er dann selbst in die Rolle seiner Frau schlüpfte und spielerisch zur Zielscheibe seiner eigenen Gehässigkeiten wurde, brach er den Dialog abrupt ab und wurde nachdenklich. Dieser eiskalte Umgang sei für ihn kaum auszuhalten, sagte Bender. In der Einzeltherapie wiederholte er später das Rollenspiel und probierte aus, sich seiner Frau gegenüber anders zu verhalten. Zuhören, ausreden lassen, auf Abwertungen verzichten – Selbstverständlichkeiten, die in seinem Repertoire nicht vorgekommen waren.
Viele Patienten sind wie Günter Bender davon überrascht, wie sie auf andere wirken. Ein Aha-Effekt. Konfrontiert mit ihren eigenen Ich-Inszenierungen, müssen die dünnhäutig Selbstverliebten über sich selbst grinsen. Selbstironie ist oft der erste Schritt in Richtung Reflexion. „Rollenspiele bieten die Möglichkeit, einen alternativen Interaktionsstil auszuprobieren“, sagt Herpertz. „Die Patienten stellen dann fest, dass ihre Gesprächspartner vollkommen anders auf sie reagieren, als sie es gewohnt sind. Dadurch machen sie die wichtige Lernerfahrung, dass sie es selbst in der Hand haben, ob sie anecken und Konflikte provozieren.“
Es muss nicht immer Wettkampf sein
Wichtige Therapieziele lassen sich erreichen, indem kognitive Grundannahmen, die den Patienten ein Leben lang starr und unflexibel gemacht haben, infrage gestellt werden. Er lernt: Ich muss nicht immer und überall der Beste sein. Mal im Strom mitzuschwimmen bedeutet nicht zu verlieren, sondern kann im Gegenteil sehr erholsam sein. Flexibilität, wie sie die kognitive Verhaltenstherapie vermittelt, bedeutet, Prioritäten setzen zu lernen, die dem Persönlichkeitsstil entsprechen, und zugleich dessen negative Effekte zu entschärfen. Wer im Job unbedingt an der Spitze stehen will, könnte zum Ausgleich den Ehrgeiz beim Sport reduzieren. Wettkampfsportarten wie Tennis lassen sich durch solche ersetzen, bei denen der Spaß an der Bewegung im Vordergrund steht, wie etwa beim Inlineskaten.
Wer sich auf eine Therapie einlässt, wird für die Erweiterung seines Handlungsrepertoires mit einem schöneren Familienleben belohnt, mit intensiveren Beziehungen und der Fähigkeit, genießen und entspannen zu können. Für viele sind das erste Male. „Narzisstische Patienten, die eine Therapie durchhalten, geben uns als Rückmeldung, dass sie ein großes Stück Lebensqualität gewonnen haben“, sagt Sabine C. Herpertz. Die Chance auf Glück mit der Familie und in der Liebe – dafür lohnt es sich, das Ich eine Nummer kleiner auszuprobieren.