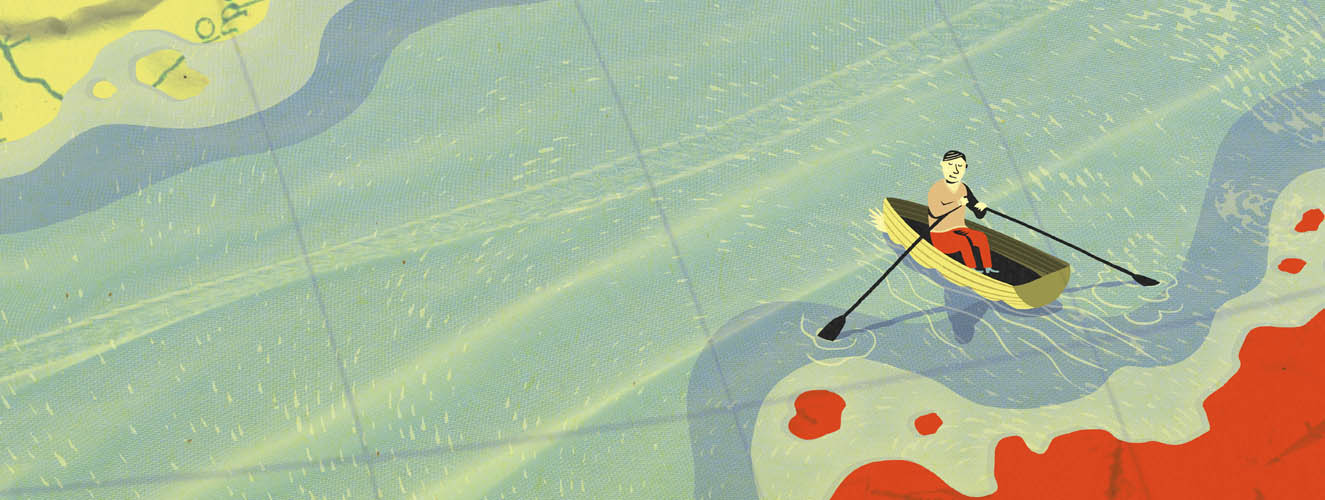Nach Island auswandern – das war für Madeline Jost und ihren Freund Jan Wölke der ganz große Traum. Die schreibende Fotografin (31) und der Musiker (37) aus Hamburg waren 2016 sechs Monate lang mit einem kleinen Wohnmobil kreuz und quer über die Insel im Atlantik gefahren und hatten auf ihrem Blog Soundtracking die Musikszene des Landes dokumentiert. Danach war ihnen klar: Wir wollen auf Dauer auf Island leben. Zurück in Deutschland, stürzten sie sich in die Organisation. Mithilfe isländischer Freunde…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
sie kaufen wollten, um daraus ein kleines Museum mit angeschlossener Zimmervermietung zu machen. Sie verhandelten mit den Eigentümern, engagierten Handwerker und bereiteten den Umzug vor.
Anfang 2017 schien der Traum greifbar nah. Der Hausrat war verpackt, nur der endgültige Zuschlag für das Haus fehlte noch. Und dann kam der große Rückschlag. Die Eigentümer teilten ihnen mit, sie würden das Anwesen nun doch an die lokalen Bauern verkaufen. Vier Monate hatte das Paar geplant und organisiert, und nun stand es auf einmal mit leeren Händen da. Was tun? Aus Sorge, auf der Insel kein ähnlich attraktives und erschwingliches Objekt zu finden, verzichteten sie darauf, nach Alternativen zu suchen und noch mehr Zeit und Energie zu investieren. „Wir waren traurig und verzweifelt“, erzählt Madeline. „Dennoch beschlossen wir, den Traum von Island aufzugeben.“
Wenn man dem berühmten Football-Coach Vincent Lombardi glaubt, dann sind Leute wie Madeline Jost und Jan Wölke Verlierer. Der 1970 verstorbene Amerikaner hat den Spruch geprägt: „Gewinner geben niemals auf, und Leute, die aufgeben, gewinnen nie.“ Damit hat er das Ideal der westlichen Kultur ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Man bewundert Leute, die trotz Schwierigkeiten unbeirrt an ihren Zielen festhalten. Diese Einstellung scheint in den USA besonders ausgeprägt zu sein, aber auch hierzulande regiert die Norm, dass man sich nicht unterkriegen lässt und einmal Begonnenes zu Ende führt.
Dabei wird leicht vergessen, dass es in manchen Situationen besser ist, genau das Gegenteil zu tun: Projekte beenden, Pläne ad acta legen. Das Aufgeben führe zu Unrecht ein Schattendasein, sagen Psychologen, denn für ein ausgeglichenes und erfüllendes Leben sei Ziele loslassen zu können ebenso wichtig wie dranzubleiben. Damit ist nicht gemeint, bei der ersten Schwierigkeit die Flinte ins Korn zu werfen. Aber von Zielen abzulassen kann sinnvoll sein – wenn sie unrealistisch sind, wenn sie nur unter sehr hohem Aufwand zu erreichen sind, wenn man über lange Zeit nicht weiterkommt oder wenn sie den eigenen Bedürfnissen oder Fähigkeiten nicht (mehr) entsprechen. Nicht nur tut es Körper und Seele gut, weil es abträgliche Belastungen reduziert. Es kann auch Freiraum dafür schaffen, neue Vorhaben im Beruf und Privatleben anzugehen, die einem wirklich liegen.
Exzessive Persistenz
Veronika Brandstätter, Psychologieprofessorin an der Universität Zürich, hat das Aufgeben von Zielen intensiv erforscht. Sie bestreitet nicht, dass Stehvermögen und Ausdauer wichtig sind, ganz im Gegenteil. „Sie sind die Grundvoraussetzungen jeglichen Lernens. Alles, was wir können, haben wir nur gelernt, weil wir ausdauernd waren und bei Schwierigkeiten, die beim Lernen immer auftreten, drangeblieben sind.“ Die Arbeiten von Forschern wie Angela Duckworth (University of Pennsylvania) belegen, wie wichtig Hartnäckigkeit (grit) für den Erfolg in der Ausbildung, im Beruf und in Beziehungen ist (siehe Psychologie Heute 11/2016).
Aber Ausdauer sei nur eine Seite der Medaille: „Man kann auch zu viel Durchhaltevermögen haben. Wenn ein Mensch an einem Ziel klebt, obwohl es ihn immer wieder überfordert und seine Kräfte übersteigt, dann ist das kontraproduktiv“, so Brandstätter. „Exzessive Persistenz“, wie Psychologen das nennen, führe zu ständigen Frustrationen und könne sogar depressive Verstimmungen hervorrufen. Außerdem vergebe man die Chance, seine Energie, Zeit und andere Ressourcen in gewinnbringendere Projekte zu stecken. „Jeder hat sicher Beispiele parat, wo er im Nachhinein sagt: Es wäre besser gewesen, wenn ich das Ziel früher aufgegeben hätte.“
Auch der amerikanische Psychologe Alan Bernstein und die Wissenschaftsjournalistin Peg Streep betonen, dass Aufgeben eine wertvolle Fähigkeit ist, die einen im Leben voranbringt. Dinge beenden zu können sei wichtig, erläutern sie in ihrem Buch Quitting, weil der menschliche Verstand darauf programmiert sei, hartnäckig zu sein, selbst wenn ein Ziel unerreichbar ist. Diese inneren Programme, die oft unbewusst abliefen, könnten einen beispielsweise dazu verleiten, die eigenen Fähigkeiten zu überschätzen oder sein Engagement noch zu erhöhen, wenn einem ein Ziel entgleitet. Solche Impulse seien außerordentlich nützlich gewesen, als das Überleben des Menschen noch ganz von physischen Betätigungen wie dem Jagen, von schnellen Reaktionen und eisernem Durchhaltewillen abhängig war. Auch heute noch setze der Verstand diese Strategien ein, die nichts mit Rationalität und Logik zu tun haben.
Zu lernen, wie man aufgibt, kann einen davor bewahren, aussichtslose Unternehmungen immer weiter zu verfolgen. Aufzugeben sei kein Selbstzweck, heben Bernstein und Streep hervor, sondern ein notwendiger erster Schritt, um einen Neustart zu machen und seine Ziele umzudefinieren. „Den Wert des Aufgebens zu akzeptieren mag der eigenen Intuition widersprechen. Wir haben alle gelernt, dass Aufgeben ein Zeichen von Schwäche ist. Doch die Wahrheit ist: Erfolgreiche Menschen wissen sowohl, wann man dranbleibt, als auch, wann man aufgibt.“
Ein ausgeträumter Traum
In diesem Licht betrachtet, sind Madeline Jost und ihr Freund Gewinner – und sie sehen sich auch selbst als Menschen, die etwas gewonnen haben. Den Traum vom Auswandern aufzugeben sei nicht leicht gewesen, wie die Fotografin betont: „Aber heute sage ich: Was für ein Glück, dass wir nicht weiter einem ausgeträumten Traum hinterhergelaufen sind.“ Zunächst hätten sie sich sehr verloren gefühlt. Aber dann gingen sie die Neugestaltung ihrer Zukunft ganz systematisch an: Sie beschlossen, an einen Ort zu ziehen, der ähnlich menschenleer und ruhig wie Island ist, aber in der Nähe ihres alten Wohnortes Hamburg liegt. Eine Google-Suche legte eine passende Region nahe: das Wendland.
Und dann ging alles ganz schnell: Innerhalb von drei Wochen fanden sie in Lüchow eine große helle Wohnung, in die sie zügig einziehen konnten. Einmal dort, knüpften sie Kontakte zu alten und neuen Freunden, akquirierten Projekte und Auftraggeber. Kurze Zeit später kauften sie sich ein Haus, das sie jetzt umbauen und schon bald bewohnen werden. „Wir haben nun hier im Wendland das gefunden, was uns an Island so gefallen hat“, resümiert Madeline. „Dadurch ist mir klargeworden, dass ich viele Möglichkeiten habe, mir das Leben so einzurichten, wie es mir entspricht. Das gibt mir ein unglaubliches Vertrauen. Zudem hat uns die gemeinsame Erfahrung als Paar auf die Probe gestellt und uns näher zusammengebracht.“
Positive Effekte, wie sie Madeline beschreibt, sind kein Einzelfall. Studien zeigen, dass Aufgeben in mehrerlei Hinsicht förderlich ist. Menschen, die von sich sagen, dass sie sich eher leicht von unrealistischen Zielen lösen, zeichnen sich durch ein hohes psychisches Wohlbefinden aus, wie die Untersuchungen des Motivationsforschers Carsten Wrosch (Concordia University, Montreal) und anderer Wissenschaftler zeigen. Solche Leute fühlen sich weniger nervös und unter Druck und empfinden eher, dass sie ihre Zukunft gestalten und steuern können. Ziele nicht loslassen zu können ist dagegen mit hoher emotionaler Belastung, Stressgefühlen und depressiven Symptomen verbunden.
Ein Ziel, das zu einem passt
Wer unrealistische Vorhaben aufgibt, reduziert Stress – und das tut auch dem Körper gut. So wurden in einer weiteren Studie von Wrosch Probanden, die sich relativ leicht von Zielen abwenden konnten, weniger von Verdauungs- und Schlafstörungen, Ekzemen, Asthmaanfällen und anderen Gesundheitsproblemen geplagt als Menschen, die an einem einmal ins Auge gefassten Ziel klebten.
Aufgeben kann aber nicht nur körperliche und seelische Erleichterung verschaffen, sondern einen auch auf einen Pfad zu mehr Erfüllung und Zufriedenheit bringen. Denn wenn man ein bisheriges Vorhaben fallenlässt und sich neuen Möglichkeiten öffnet, dann stehen die Chancen gut, dass man ein Ziel findet, das besser zu einem passt. Darauf deutet eine Studie von Veronika Brandstätter und Marcel Herrmann mit jungen Erwachsenen hin. „Nachdem man ein wichtiges Ziel aufgegeben hat, was ja nicht leicht ist, geht man bei der Suche nach Alternativen in der Regel sorgfältiger vor“, erläutert die Wissenschaftlerin. „Man hat in gewisser Weise seine Lektion gelernt und eruiert seine Möglichkeiten nun sorgsamer. Man hat sich selbst vielleicht auch besser kennengelernt und weiß genauer, worauf es einem wirklich ankommt.“
Das kann bedeuten, das Chemiestudium trotz guter Noten abzubrechen, weil man feststellt, dass man für die einsame Arbeit im Labor zu menschenorientiert ist, und auf Jura umzusatteln mit dem Ziel, später mal als Mediator zu arbeiten. Oder jemand gibt die ehrenamtliche Arbeit im Hospiz dran, weil sie ihn seelisch überfordert. Und engagiert sich künftig für ältere Menschen in einem Verein für Nachbarschaftshilfe.
Schließlich ist Aufgeben auch eine wirkungsvolle Strategie, um seine Erfolgsaussichten zu erhöhen. Das klingt vielleicht paradox, ist in der Wirtschaft aber schon lange bekannt. Ein berühmtes Credo des ehemaligen Chefs des US-Konzerns General Electric, Jack Welch, lautete: „Entweder wir sind mit einem Produkt auf dem Weltmarkt die Nummer eins oder zwei, oder wir halten uns mit dem Produkt nicht auf.“ Dies ist eine Herangehensweise, die auch für Individuen vielversprechend sein kann, wie der amerikanische Autor Seth Godin in einem kleinen Ratgeber erläutert. Egal ob man Sportler, Grafikdesigner oder Firmenchef sei: Wer Herausragendes erreichen wolle, so Godin, der müsse Zeit und Energie in das vielversprechendste Ziel stecken – und jene, in denen man nur mittelmäßig ist oder trotz größter Anstrengungen über längere Zeit nicht weiterkommt, von der Liste streichen. Dieses strategische Aufgeben, wie er es nennt, habe nichts mit Scheitern zu tun, sondern sei „eine bewusste und kluge Entscheidung auf der Basis der Optionen, die einem zur Verfügung stehen“.
Die positiven Wirkungen des strategischen Aufgebens sind auch empirisch belegt. Experimentalstudien eines Teams um den australischen Sportpsychologen Nikos Ntoumanis (Curtin University, Perth) zeigten, dass Athleten, die relativ früh erkannten, dass ein vorgegebenes Ziel in einer Sportart (Radfahren) für sie unerreichbar war, und auf eine andere Sportart (Rudern) umsattelten, weniger grübelten und emotional haderten als Sportler, die länger an ihrem unrealistischen Ziel festhielten. Der Wechsel auf ein vielversprechenderes Vorhaben führe auch zu insgesamt höheren Leistungen, vermutet der Forscher – eine These, die er gerade in einer aktuellen Studie untersucht. „Ein unerreichbares Ziel aufzugeben setzt neben Zeit und Energie auch kognitive und emotionale Ressourcen frei, die genutzt werden können, um andere Ziele mit größerem Erfolg zu verfolgen“, so Ntoumanis.
Warum das Loslassen so schwerfällt
Die Reißleine zu ziehen ist in manchen Situationen die genau richtige Entscheidung – aber eine, die ganz schön schwerfallen kann, wie Christine Bader feststellte. Die Managerin und Autorin aus Seattle kündigte 2017 ihren vermeintlichen Traumjob als Direktorin für soziale Verantwortung bei Amazon, den sie erst 2015 angenommen und auf den sie seit Jahren hingearbeitet hatte. „Er stellte sich als doch nicht so perfekt heraus“, wie Bader in einem Artikel in der New York Times schreibt, „nicht zuletzt, weil sich meine Zwillinge während meiner 22-monatigen Tätigkeit von stummen Babys in neugierige und unwiderstehliche kleine Menschen verwandelt hatten. Meine Bürostunden waren zu bewältigen, aber wenn ich nach Hause kam, war ich nicht so präsent, wie ich es sein wollte.“
Sie hätte es durchziehen können, meint sie in der Rückschau, schließlich half ihr Mann kräftig mit, und sie hatte ein großzügiges Gehalt. „Aber als ich innehielt und mal wirklich aufmerksam war – und aufhörte, geschäftig die Logistik zu managen und durch den Schmerz zu laufen, wie man das [im Laufsport] nennt –, wusste ich, dass die Situation nicht richtig war. Also gab ich den Job auf.“ Dabei ließ sie es nicht bewenden: Sie verabschiedete sich auch von halbfertigen Schreibprojekten, die nicht in Fluss kommen wollten, und gab das Marathonlaufen, das ihr in der Tat Schmerzen verursachte, auf.
Leichtgefallen sei ihr das Loslassen nicht, gibt sie zu. Es habe ihr wehgetan, das Team bei Amazon zu verlassen. Und wenn sie andere Marathonläufer sah, verspürte sie heftigen Neid. „Aber die Qualität und Quantität an Zeit, die ich nun für meine Familie und für mich habe, haben mich mehr als entschädigt. Mir ist klargeworden, dass man manchmal die Pausetaste drücken muss.“
Im Nachhinein ist es oft offensichtlich, dass es vorteilhaft war, etwas aufgegeben zu haben. Doch zu erkennen, dass es besser wäre, ein Vorhaben einzustellen, während man es verfolgt, und den Ausstieg dann auch durchzuziehen ist keineswegs leicht. Psychologen verweisen auf eine Reihe von sozialen, emotionalen und kognitiven Faktoren, die dazu beitragen, dass Menschen an Ideen und Projekten kleben.
Auch die eigene Disposition kann einem einen Strich durch die Rechnung machen. Manche Typen von Menschen, so haben Forscher festgestellt, haben mehr Mühe damit, sich von Zielen zu lösen, als andere. Das gilt beispielsweise für sogenannte lageorientierte Menschen. Dies sind Leute, wie Psychologe Bernstein und Wissenschaftsjournalistin Streep erläutern, die in Situationen, in denen ein Vorhaben schlecht läuft, von negativen Emotionen überwältigt werden und zögerlich reagieren. Sie fallen ins Grübeln, suchen die Schuld bei sich und bleiben in der Situation gefangen. Handlungsorientierte Menschen dagegen können negative Gefühle regulieren, bleiben entscheidungsfreudig und nach vorne gerichtet – und verabschieden sich, wenn nötig, von einem Projekt.
Zudem tun sich Menschen, deren Motivation es ist, etwas zu vermeiden („Ich will keine Fehler machen und keinen Misserfolg haben“), schwerer mit dem Aufgeben als solche, die etwas erreichen wollen („Ich will Erfolg haben“). In einer Studie der Psychologinnen Heather Lench und Linda Levine mussten Probanden in einer vorgegebenen Zeit drei Serien von Anagrammen lösen, also Buchstabenrätsel, bei denen man durch Umstellen von Buchstaben aus einem Wort ein neues sinnvolles Wort bildet. Der Dreh: Die erste Serie enthielt nur Wörter, aus denen sich keine anderen sinnvollen Wörter bilden ließen. Es zeigte sich, dass sich Teilnehmer mit Vermeidungszielen länger mit den unlösbaren Rätseln aufhielten (und mehr Ärger dabei empfanden), während die Teilnehmer mit (positiven) Annäherungszielen schneller das erste Set ad acta legten und zum zweiten und dritten übergingen.
Mache ich Fortschritte, stehe ich still?
Es gibt viele Faktoren, die die Loslösung von Zielen erschweren – aber auch die Art, wie man aufgibt, kann problematisch sein. Nicht jede Form des Aufgebens ist vorteilhaft. Ein Student, der sich nach ein paar vermasselten Klausuren in einem Frustanfall exmatrikuliert, wird möglicherweise im Nachhinein feststellen, dass er vorschnell gehandelt hat. Eine Autorin, die ein Buchprojekt einfach im Sande verlaufen lässt, ohne einen echten Schlussstrich zu ziehen, wird wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich ernsthaft einem anderen Stoff zuzuwenden.
Gekonntes Aufgeben, schreiben Bernstein und Streep, beinhaltet ein umsichtiges und bewusstes Vorgehen. Eine erste zentrale Frage lautet: Ist es sinnvoll, von meinem Ziel abzulassen? Die Beantwortung läuft letztlich auf eine Kosten-Nutzen-Analyse hinaus, so Brandstätter: „Bin ich bereit, noch mehr an Kosten, Nachteilen oder gar Schmerzen in Kauf zu nehmen, um mein Ziel, von dem ich mir Vorteile verspreche, zu realisieren? Dabei besteht natürlich das Grundproblem, dass man nicht in die Zukunft blicken kann und nicht genau weiß, ob man das Ziel tatsächlich erreicht und ob der Aufwand, den man betreiben muss, es wert ist.“
Hundertprozentig sicher wird man bei der Einschätzung also selten sein. Aber es gibt Indikatoren. Ein wichtiges Kriterium hinsichtlich der Erreichbarkeit ist die Frage, ob man Fortschritte erzielt oder nicht: Gibt es Anzeichen, dass ich mich vorwärtsbewege, zumindest ein wenig? Habe ich kritische Meilensteine erreicht und wichtige Hürden genommen? Oder stehe ich schon lange still, beziehungsweise falle ich sogar zurück, und das obwohl ich mir große Mühe gegeben habe? Manchmal ist es auch sinnvoll, so Brandstätter, schon vorab objektive Kriterien zu definieren, die als Richtschnur für einen Abbruch dienen.
Bei der Frage der Kosten können viele Faktoren einfließen, etwa ob ein Projekt dem körperlichen Wohlbefinden schadet, welche anderen wichtigen Ziele man dafür zurückstellen muss und wie sehr es die Psyche belastet. Einen wichtigen Indikator könne man unter das Stichwort chronisches Zähnezusammenbeißen fassen: „Wenn man sich bei einem Vorhaben permanent überwinden und immer wieder gegen innere Widerstände ankämpfen muss, wenn es nur noch darum geht, sich hart an die Kandare zu nehmen, dann ist das ein Warnsignal, dass man vielleicht in das Falsche investiert“, so Brandstätter. Und schließlich ist zu fragen, ob das Ziel überhaupt (noch) den eigenen Bedürfnissen und Wünschen entspricht.
Ablösung auf vier Ebenen
Hat man die Entscheidung getroffen, ein Ziel aufzugeben, dann ist es wichtig, sich vollständig und umfassend davon zu lösen. Dazu gehören vier Ebenen, wie Streep und Bernstein erläutern.
– Erstens gilt es, den Kopf vom bisherigen Ziel freizumachen. Grübeleien wie „Habe ich vielleicht doch zu früh aufgegeben? Hätte ich vielleicht mehr Erfolg gehabt, wenn ich xy gemacht hätte?“ können hartnäckig sein. Es hilft laut Bernstein und Streep wenig, solche aufdringlichen Gedanken unterdrücken zu wollen. Wirkungsvoller sei, sich auf etwas anderes zu konzentrieren.
– Zweitens muss man mit negativen Gefühlen umgehen, die beim Aufgeben von Zielen häufig und unter Umständen in heftiger Form auftreten und von Bedauern und Trauer bis zu Ärger und Aggression reichen können. Auch hier gilt: Unterdrücken hilft wenig.
– Das führt zur dritten, der motivationalen Ebene und beinhaltet, ein neues Ziel ins Auge zu fassen, was sehr hilfreich ist, um sich mental und emotional vom bisherigen Ziel zu lösen. Das kann bedeuten, ein ganz neues Vorhaben anzugehen oder auch das bisherige Ziel so abzuändern, dass es besser zu den eigenen Bedürfnissen und Möglichkeiten passt. Man könnte beispielsweise beschließen, nach Abbruch des Tiermedizinstudiums, das einem zu theoretisch war, eine Ausbildung zum Tierheilpraktiker anzufangen.
– Und viertens schließlich gilt es, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um das alte Vorhaben zu beenden und sich in Richtung des neuen Ziels zu bewegen.
Ein lauter Weckruf
Ein solcher Ablösungsprozess kann langwierig sein, aber am Ende stellt man möglicherweise fest, dass sich ganz unerwartete und vielversprechende Möglichkeiten eröffnen. So ging es auch Deirdre, einer 28-Jährigen, deren Geschichte Bernstein und Streep in ihrem Buch erzählen:
Mit sieben fing Deirdre mit dem wettbewerbsmäßigen Schwimmen an, und der Sport bestimmte ihre Kindheit und frühe Jugend – eine große Schwimmkarriere schien möglich. Doch dann kam alles anders. Mit 14 entwickelte sie eine schmerzhafte Sehnenscheidenentzündung in beiden Schultern. Der Arzt riet ihr, den Sport aufzugeben, aber sie konnte sich das nicht vorstellen. „Mein ganzes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl waren mit dem Schwimmen verbunden.“ Sie quälte sich, versuchte es mit einer mehrmonatigen Pause, aber auch danach blieb der Schmerz so stark, dass sie kaum 500 Meter schwimmen konnte.
Sie versuchte das Schwimmen aufzugeben. Sie lenkte ihren Fokus auf anderes, fing Theaterspielen an, verbrachte ein Schuljahr im Ausland. Aber sie sehnte sich nach der Anerkennung und den Glücksgefühlen, die sie beim Schwimmen gefunden hatte. Und so stieg sie immer wieder ins Becken: für das Team ihrer Universität, als Schwimmlehrerin und Coach.
Erst sechs Jahre nachdem die Schulterprobleme angefangen hatten, gab sie endgültig auf. Bis heute hat sie Schmerzen. Es sei eine ständige Erinnerung daran, dass Durchhalten schädlich sein kann: „Von meiner Natur her gebe ich nicht leicht auf, und ich brauchte offenbar einen lauten Weckruf, bevor ich das verstanden habe.“ Aber Deirdre wirkt nicht bitter. Die Lektionen, die sie gelernt hat, kämen ihr heute als Therapeutin zugute, sagt sie. So arbeitet sie mit Opfern von häuslicher Gewalt, die oft Probleme haben, die schädliche Situation zu verlassen. „Insgesamt hat mich das Aufgeben zu einer interessanteren und vielfältigeren Person gemacht, als ich es wahrscheinlich geworden wäre, wenn ich weiter geschwommen wäre. So viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, wären an mir vorbeigegangen, wenn ich [den Sport] nicht aufgegeben hätte.“
Was das Loslassen bremsen kann
Identität
Wichtige Ziele tragen zum Identitätsgefühl bei, so Veronika Brandstätter: „Sie aufzugeben kann deshalb zu großer Selbstverunsicherung führen.“ Der Sozialpsychologe Eric Klinger habe das sogar mit einem psychologischen Erdbeben verglichen, das einen in den Grundfesten erschüttert. Dieser Effekt werde noch verstärkt, wenn auch andere einen mit einem bestimmten Ziel identifizieren, weil man seit Jahren davon spricht.
Denkfallen
Der menschliche Verstand ist darauf programmiert, vereinfachte kognitive Operationen einzusetzen, die es uns ermöglichen, mit begrenztem Wissen und in begrenzter Zeit Entscheidungen zu treffen und Urteile zu fällen. Das Problem: Manche dieser Urteilstendenzen können einen dazu verleiten, an einem Ziel festzuhalten, obwohl es objektiv betrachtet besser wäre, aufzugeben. Eine solche Denkfalle wird etwas sperrig „Verfügbarkeitsheuristik“ genannt: Sie beinhaltet, dass wir durch Geschichten anderer – zum Beispiel Medienberichte über Sportler oder Jungunternehmer, die sich durchgebisssen haben – die Wahrscheinlichkeit überschätzen, ein eigenes schwieriges Projekt zu einem guten Ende zu führen.
Eine weitere Falle: Menschen tendieren dazu, Entscheidungen davon abhängig zu machen, wie viel sie bereits in ein Projekt investiert haben. So denkt die Gründerin einer wenig erfolgreichen Yogaschule vielleicht: „Jetzt habe ich schon so viel Zeit und Geld in die Schule gesteckt; das will ich nicht verlieren, indem ich sie nun zumache.“ Dabei kommt es für eine objektive Beurteilung nur auf die zukünftigen Kosten und Erträge an. Psychologen nennen das „Sunk-Cost-Täuschung“.
Zudem kann die Frustration, mit einem Projekt nicht weiterzukommen, dazu führen, dass es einem nun wertvoller erscheint als zu dem Zeitpunkt, als man damit angefangen hat. „Das Ziel wird aufgrund seiner Unerreichbarkeit buchstäblich immer reizvoller“, so Bernstein und Streep. Und je wertvoller uns ein Ziel erscheint, desto eher halten wir daran fest.
Gesellschaftliche und soziale Einflüsse
In einer Gesellschaft, in der Leute mit Stehvermögen Heldenstatus genießen, ruft Aufgeben leicht Gefühle von Scham und Angst hervor, was die Bereitschaft, ein Projekt aufzugeben, sehr hemmen kann. Dazu können weitere Faktoren im sozialen Umfeld kommen, erläutert Veronika Brandstätter. So mag eine Studentin, die feststellt, Medizin sei eigentlich nichts für sie, am Studiengang festhalten, weil sie die vorwurfsvollen Blicke oder den Druck ihrer Eltern fürchtet, die beide Ärzte sind. Oder eine Mitarbeiterin in einer Unternehmensberatung quält sich trotz Zweifeln jahrelang durch 70-Stunden-Wochen, weil sie in einer Wettbewerbssituation mit ihren Teamkollegen gefangen ist, in der es darum geht, wer den längsten Atem und die stärksten Nerven hat.
Von Zielen und Zweifeln
Wie leicht wir Projekte aufgeben und zu Neuem aufbrechen, hängt auch mit unserem Alter zusammen
Kinder und Jugendliche
Ein Kind lässt Pläne und Aktivitäten oft nach kurzer Zeit wieder fallen: In einem Monat buddelt es stundenlang im Garten, um sich auf eine Karriere als Paläontologe vorzubereiten. Im nächsten wendet es sich stattdessen dem Schlagzeugspielen zu oder beschließt, Bloggerin zu werden.
In jungen Jahren fällt die Zielablösung in der Regel leichter, so Veronika Brandstätter, denn man hat noch nicht die Verpflichtungen, die ein Erwachsener berücksichtigen muss. Außerdem stehen einem auch mehr Alternativen offen, weil man noch jung genug ist und Zeit hat, um theoretisch alles zu lernen.
Projekte anzufangen und sie wieder aufzugeben spielt im Kinder- und Jugendalter aber auch eine besondere Rolle für die Entwicklung. Das Überangebot an Aktivitäten und Hobbys könne zwar dazu führen, dass junge Menschen rastlos vom einen zum anderen wechselten – aus Angst etwas zu verpassen –, kritisiert die Psychologin. „Aber generell ist Experimentieren für sie wichtig, um die Welt zu entdecken, Wissen und Erfahrungen zu sammeln, soziale Netze zu knüpfen und auch herauszufinden, was ihnen liegt.“
Auf diese Weise kann Aufgeben sogar längerfristig das Durchhaltevermögen stärken, wie Angela Duckworth (University of Pennsylvania) erläutert: Durch spielerische Beschäftigung und Ausprobieren könnten echtes Interesse und sogar Leidenschaft entstehen – zentrale Voraussetzungen für spätere Zielstrebigkeit: „Kinder arbeiten nicht hart für etwas, das ihnen egal ist.“ Je älter ein Kind werde, desto wichtiger sei, dass es an einer Sache dranbleibe, damit es erlebe, dass man durch Erfahrung besser wird und Rückschläge überwinden kann. Doch auch für ältere Jungen und Mädchen sei Aufhören manchmal die richtige Wahl, um Neues auszuprobieren und etwas zu finden, das sie wirklich lieben.
Junge Erwachsene
Im Alter zwischen 18 und 25 geht es darum, die eigene Identität in den verschiedensten Bereichen zu formen, erklärt Brandstätter: „Man muss herausfinden, was einen beruflich interessiert und wie man zukünftig seinen Lebensunterhalt verdienen will. Man bildet auch eine politische Werthaltung und einen Lebensstil heraus. Man steht vielleicht kurz davor, eine Lebenspartnerschaft einzugehen. Sich persönliche Ziele zu setzen und sich wieder von ihnen zu lösen kann man in der Phase der emerging adulthood als eine Form der Identitätsfindung interpretieren. Man erforscht verschiedene mögliche Selbst und probiert sie aus.“
Einerseits legt man sich in diesen wichtigen Entwicklungsjahren auf bestimmte Dinge fest; andererseits können ernsthafte Zweifel an den eigenen Zielen und Plänen aufkommen: Ist das Studienfach wirklich das richtige für mich? Will ich mit dem jetzigen Freund, der derzeitigen Freundin alt werden? „Eine solche Phase des Haderns ist nicht angenehm“, so Brandstätter. „In einer Handlungskrise, wie wir das nennen, können starke negative Emotionen auftreten, man fühlt sich häufig auch körperlich nicht gut, und die Leistungsfähigkeit kann leiden. Aber so unangenehm das ist, es führt auch dazu, dass man seinen Blick öffnet, anderen Möglichkeiten aufgeschlossener gegenübersteht, sorgfältiger abwägt und sich ein klareres Bild seiner Präferenzen und Optionen bildet – und am Ende oft ein Ziel findet, das besser zu einem passt.“
Weil junge Erwachsene in der Identitätsfindung sind, tritt dieser positive Effekt der Handlungskrise bei ihnen offenbar besonders stark hervor. So zeigte sich in einer Längsschnittstudie mit 207 Studenten von durchschnittlich 21 Jahren: Je schwerwiegender eine Krise war, die ein junger Mensch bei der Aufgabe eines Ziels im Bereich Beruf, Liebe, Familie, Gesundheit oder Freizeitaktivitäten durchgemacht hatte, als desto wichtiger und identitätsstiftender bewertete er das neue Ziel, auf das er im Laufe der Krise umgeschwenkt war, und desto sicherer war er, dass er damit die richtige Wahl getroffen hatte. „Persönliche Ziele sind Ausdruck der Persönlichkeit eines Menschen“, erläutert Brandstätter. „Die hohe Entscheidungssicherheit bei diesen Probanden weist also darauf hin, dass sich ihre Identität stabilisiert hat.“
Loslassen im Alter
Im Alter ist Aufgeben aus anderen Gründen wichtig. Wenn Augen und Ohren weniger gut wahrnehmen, die Muskeln schwächer werden oder das Gedächtnis nachlässt, können Projekte und Aktivitäten, die man bislang mit Begeisterung verfolgt hat, zunehmend schwieriger oder gar unmöglich werden. Für den einen ist es die stundenlange Gartenarbeit, für einen anderen das Skilaufen oder Klavierspielen. Wer trotz Funktionseinschränkungen Ziele, die eigentlich nicht mehr erreichbar sind, weiterverfolgt, erläutern Carsten Wrosch (Concordia University, Montreal) und Kollegen, muss mit ständigen Frustrationen und Misserfolgen umgehen und kann dann zunehmend unter Stimmungsproblemen leiden – bis hin zu einer Depression.
Dies bestätigt auch eine empirische Untersuchung der Forscher. In einer Längsschnittstudie befragten sie 135 Kanadier im Alter zwischen 64 und 90 Jahren (Durchschnitt: 72), inwieweit es ihnen schwerfalle, nicht mehr über ein wichtiges Ziel, das sie aufgeben mussten, nachzudenken. Es zeigte sich, dass diejenigen, die sich mit dem Loslassen schwertaten, während der sechsjährigen Studienlaufzeit mit zunehmenden Funktionseinschränkungen mehr depressive Symptome entwickelten. Bei Senioren dagegen, die sich leichter von Zielen distanzierten, ging der Anstieg von mentalen und körperlichen Zipperlein nicht mit mehr Stimmungsproblemen einher. Bessere Stimmung wiederum war mit einer geringeren Anfälligkeit für akute Krankheiten verbunden, wie eine Nachfolgestudie von Wrosch und der Psychologin Joelle Jobin zeigt. So erkrankten Senioren, die von sich sagten, sie trennten sich eher leicht von Zielen, signifikant weniger häufig an grippalen Infekten als Senioren mit Beharrungstendenzen. Dies galt insbesondere für die besonders alten Teilnehmer der untersuchten Gruppe. Natürlich ist es wichtig, im Alter aktiv zu bleiben und weiter gewisse Herausforderungen zu suchen, aber starr an alten Zielen festzuhalten ist, wie Wroschs Arbeiten zeigen, kontraproduktiv.
Zum Nach- und Weiterlesen
Veronika Brandstätter, Marcel Herrmann: Goal disengagement in emerging adulthood: The adaptive potential of action crises. International Journal of Behavioral Development, 40/2, 2016, 117–125
Peg Streep, Alan Bernstein: Quitting. Why we fear it – and why we shouldn't – in life, love, and work. Da Capo Lifelong Books, Philadelphia 2015
Seth Godin: The dip. A little book that teaches you when to quit (and when to stick). Portfolio/Penguin, New York 2007
Carsten Wrosch u. a.: Giving up on unattainable goals: benefits for health? Personality and Social Psychology Bulletin, 33/2, 2007, 251–265