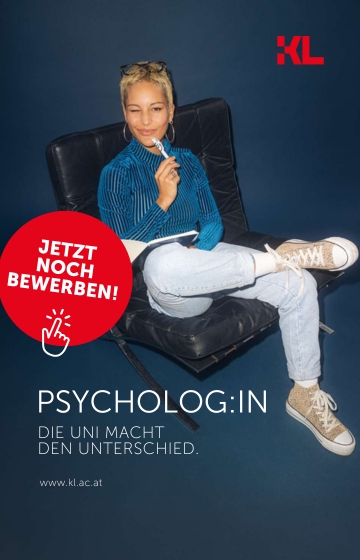Das Licht der aufgehenden Sonne, flirrendes Wasser, Menschen im Gegenlicht, am Strand, mit Board, im Meer, Aufbruch mit dem Auto, die Surfbretter auf dem Dach, eine leere, breite Landstraße – und immer wieder: Wellen, Wellen, Wellen. Die Eröffnungssequenz des Surffilm-Klassikers The Endless Summer verkörpert eindrucksvoll, was viele von uns mit Surfen verbinden: Abenteuer, Aufbruch, Freiheit.
Fast 60 Jahre ist der Film alt, und das merkt man ihm auch an. Zeitlos bleibt er in dem Gefühl der Sehnsucht, das die Aufnahmen unverändert auslösen können. Es sind in Bilder übersetzte Träume von nicht enden wollenden Sommern, perfekten Wellen, einem sorglosen Leben, die Regisseur Bruce Brown damals schuf – und die auch heute noch einen Teil der Anziehungskraft des Surfens ausmachen.
Warum fasziniert Surfen viele von uns? Was interessiert Menschen daran, auch abseits der Strände? Warum wird Surfen so gerne aufgegriffen in Medien, Werbung, Mode? Auf der Suche nach psychologischen Mechanismen, die die Popularität des Wellenreitens erklären könnten, wird schnell klar: Surfen ist ein vielschichtiges Phänomen. Ein Versuch der Annäherung in zehn Thesen:
1. Surfen hat ein positives Image
„Badeurlaub“ zählt traditionell auch in Deutschland zu den beliebtesten Urlaubsformen. Allein die Kulisse aus blauem Himmel, Sandstrand und türkisblauem Wasser löst bei uns unweigerlich Gefühle der Erholung aus. Zwar wird Surfen auch anderswo praktiziert, bei weniger milden Temperaturen etwa oder auf stehenden Wellen („rapid surfing“), das klassische, ikonische Bild ist aber jenes des Surfers auf einer Welle in einem tropischen Gewässer (siehe auch: 2. Surfen produziert fantastische Bilder).
Während der Ursprung des Surfens vor Hunderten von Jahren bei indigenen Völkern verortet wird, ist das „Wellenreiten“ als (Sub-) Kultur, wie wir es heute kennen, zudem stark US-amerikanisch – oder besser: kalifornisch – geprägt. Von Kalifornien aus entwickelte es sich seit den 1950er Jahren vom Nischen- zum Massenphänomen. Der Golden oder Sunshine State, wie der US-Bundesstaat gerne genannt wird, steht traditionell in dem Ruf, einen besonders hohen Lebenswert zu bieten.
Damals war Surfen noch verpönt, erinnert sich The Endless Summer-Regisseur Bruce Brown, etwas, mit dem man aufhört, wenn man erwachsen ist. Entsprechend beliebt wurde es in der aufkommenden Jugendkultur, verbunden mit neuer Musik, neuen (Lebens-) Zielen. Dieser Archetyp des Surfers, der fürs Wellenreiten lebt, prägt das Image des Sports trotz Kommerzialisierung und demografischem Wandel bis heute, wie etwa David M. Kennedy, Professor an der University of Melbourne, in dem Buch The Science and Culture of Surfing beschreibt.
2. Surfen produziert fantastische Bilder
Surfen sieht einfach gut aus – wenn man es richtig macht. Nur etwa fünf Prozent ihrer Zeit im Wasser verbringen Surfende auf einer Welle. Aber die Mühe lohnt sich, denn der Anblick ist mitunter atemberaubend: Ein Mensch, der das sonst so (über-) mächtige Element bezwingt und scheinbar mühelos über das wogende Meer gleitet. Wer dabei einen eigenen, unverwechselbaren Style zeigt, demonstriert noch mehr Überlegenheit.
Für Craig Sims, Assistant Professor an der Bond University in Gold Coast, Australien, ist die „besonders betörende Ästhetik“ eine der wichtigsten Eigenheiten des Surfens. Er bezieht das vor allem auf Surf-Videos und Fotos, die in der westlichen Surf-Community seit jeher eine große Rolle spielen. Sie zu betrachten sei für uns besonders reizvoll, da sie den fast magischen Moment der Verbundenheit zwischen Surfer und Welle einfangen, eine flüchtige Interaktion, die sonst ohne Spuren bleibt.
Ein Surf-Foto, führt Sims in The Science and Culture of Surfing aus, „erlaubt dem Betrachter, alle festgehaltenen Aspekte im Detail zu studieren: das Sonnenlicht, die Oberfläche des Wassers, die Form der Welle, die Haltung des Surfers, die Lage des Boards, die aufsteigende Gischt sowie Eigenschaften des Hinter- und Vordergrunds“. Dieser Detailreichtum spreche unsere Sinne an und beflügele unsere Fantasie: Das könnte ich sein! Dort! Es animiert und involviert uns also auf vielerlei Weise.
3. Surfen eröffnet neue Perspektiven
In vielen Ländern kann man nicht oder nicht konstant gut surfen, deshalb ist Surfen eng mit Reisen verbunden. Zudem steigen mit der Erfahrung häufig auch Begehrlichkeiten, neue Spots kennenzulernen. Insofern erzählen Surferinnen oft von Reisen, die sie fürs Surfen unternommen haben, und es gibt viele Berichte über Surfer, die an Orten mit guten Surf-Bedingungen leben (der Roman Gidget ist ein frühes Erfolgsbeispiel).
Surfen steht entsprechend für ferne Länder, neue Perspektiven, Mobilität, auch abseits des Wassers. Die Psychologin Mayla Wedekind, die des Surfens wegen mehr als sechs Jahre auf Bali lebte, beschreibt in ihrer Autobiografie Das Meer, die Welle und ich exemplarisch ihre ersten Berührungspunkte: „Das richtige Wellenreiten kannte ich nur aus Filmszenen über den Lifestyle in Kalifornien oder Abenteuer auf Hawaii. Diese Bilder faszinierten mich schon früh, jedoch erschienen sie mir wie aus einer anderen Welt, weit weg von meinem einfachen norddeutschen Dasein.“
Nachdrücklich beeindruckt habe sie der US-amerikanische Spielfilm Soul Surfer, so Wedekind, der die Geschichte der hawaiianischen Surferin Bethany Hamilton nacherzählt; Hamilton verlor bei einem Haiangriff einen Arm: „Über den lockeren Surf-Lifestyle, besonders aber auch das Abenteuer, mit Haien zu schwimmen und sich in ungewisse Strömungen zu stürzen, wollte ich mehr wissen.“ Auch deshalb sei sie nach dem Abitur für ein Jahr nach Australien gegangen, wo Surfen zu den beliebtesten Sportarten zählt.
4. Surfen ist eine Herausforderung
Surfen zu lernen ist nicht einfach, vor allem als Erwachsene – diese Erfahrung macht Surferin Mayla Wedekind als Erstes an der australischen Ostküste. Eindrücklich merkt sie das im Vergleich mit den dort lebenden Kindern, „die sich den Sport einfach spielerisch nebenbei aneigneten“, wie sie in Das Meer, die Welle und ich schreibt. Trotz der Herausforderung – oder vielleicht auch deswegen – bestimmt Surfen bald ihren Alltag.
Die Anforderungen, die Wellenreiten an die körperliche Fitness und Geschicklichkeit stellt, in Kombination mit den durch die Natur gegebenen Unsicherheiten, wecken den Ehrgeiz vieler Surferinnen und Surfer. Zwar ist „Spaß haben“ für die meisten der Hauptgrund zum Surfen, der Wunsch, die eigenen Surf-Fähigkeiten weiterzuentwickeln, spielt aber ebenfalls eine wichtige Rolle, wie etwa eine Umfrage unter britischen Surfern aus dem Jahr 2024 zeigt.
Beim Surfen geht es – wie bei allen Extremsportarten – darum, Risiken einzugehen, Aufregung zu spüren, an die eigenen Grenzen zu gehen und diese immer weiter zu verschieben. Surfer Today fasst die Herausforderung so zusammen: „Surfen ist ein Sport mit Tausenden Details, Techniken und Ausrüstungs-Hacks“. Es sei einfach, die Basics zu lernen. Auf höherem Niveau gebe es dann allerdings weit mehr zu verbessern.
5. Surfen stiftet Identität
Niemand findet heute allein zum Surfen. Manche entdecken Vorbilder direkt vor sich, am Strand, viele andere begegnen ihren Inspirationsquellen zunächst medial (siehe auch: 3. Surfen eröffnet neue Perspektiven). Wer regelmäßig surft, wird unweigerlich Mitglied der Surf-Community, die weltweit schätzungsweise 32 Millionen Menschen umfasst. Surfen wird dann zum Teil der eigenen sozialen Identität: Ich bin (auch) Surfer/ Surferin.
Innerhalb dieser Gruppe gibt es allein aufgrund der schieren Menge an Surfenden viele weitere Differenzierungen, die sich aus unterschiedlichen Merkmalen speisen und örtlich unterscheiden. Bei ihren Untersuchungen unter Surfern in Cornwall identifizierte Emily Beaumont beispielsweise folgende Subtypen: „wannabe“, „professional surfer“, „soul surfer“ und „local surfer“, wobei sich letztere noch weiter aufgliedern lassen.
Unser Selbstverständnis beeinflusst, welche „sozialen Signale“ wir etwa durch Kleidung, Sprache oder Mediennutzung an andere senden. Surfende ähneln sich: „Durch Mode, Musik und persönlichen Charakter kann man einen Surfer häufig über kulturelle Grenzen hinweg erkennen“, so David M. Kennedy in The Science and Culture of Surfing. Der als besonders authentisch geltende Lifestyle (siehe auch: 1. Surfen hat ein positives Image) wirke so anziehend, dass sogar Menschen fernab vom Wasser eine surfer persona anstrebten, etwa indem sie Produkte entsprechender (Bekleidungs-) Marken erwerben. Surfen ist auch deshalb eine Milliardenindustrie.
6. Surfen ist (relativ) zugänglich
Im Vergleich zu früheren Jahrzehnten ist es heute vergleichsweise einfach, Surfen zu lernen: Es gibt an vielerlei Orten Kurse sowie Tausende im Internet verfügbare Informationen zu allen denkbaren Aspekten. Sogar akademische Ausbildungen (etwa Surf Science in Cornwall) werden mittlerweile angeboten. Nichtsdestotrotz bleibt es ein Sport, den man sich leisten können und zu dem man Zugang haben muss.
Die Filmreihe Black Surfers Matter auf Arte beispielsweise zeigt Verteilungskämpfe und Rassismus in Kalifornien sowie Versuche, dagegen vorzugehen. Auch hierzulande gibt es Initiativen und Projekte, um Surfen inklusiver zu machen und sozial benachteiligte Gruppen einzubeziehen. An öffentlichen Stellen wie dem Eisbach in München ist Surfen immerhin kostenlos, wenn auch nur für „sehr erfahrene“ Surferinnen empfehlenswert. Die Floßlände dagegen – nach eigenen Angaben die älteste surfbare Flusswelle der Welt – eigne sich auch für Einsteiger, heißt es im Münchner Stadtportal
Wie stark Surfen männlich dominiert ist, berichtet Surferin Mayla Wedekind aus eigener Erfahrung; aber auch Auseinandersetzungen mit Frauen hat sie erlebt. Das mitunter aggressive Verhalten im Wasser („surf rage“) resultiere wohl aus der „Überfüllung von Surfspots und der Entwicklung des Wellenreitens zum Massenmarkt“, so das Portal Natursport.info der Deutschen Sporthochschule Köln. Der „Wettstreit um die besten Wellen einer Surfsession“ sei oft durch missachtete Verhaltensregeln bedingt.
7. Surfen fühlt sich gut an
Surfer, die nur für die Wellen leben? Sind vermutlich süchtig. Denn Surfen kann zur Obsession werden, und das liegt daran, was wir empfinden, wenn es uns gelingt. Im besten Fall geraten wir dann in einen Flow, erreichen also einen transformativen Zustand der Selbstvergessenheit, wie ihn Mihaly Csikszentmihalyi 1975 erstmalig beschrieb: Wir gehen vollkommen im Surfen auf und vergessen alles andere.
Surfen bedeutet auch: Geschwindigkeit und infolgedessen Thrill, also ein hohes Maß an Erregung. Es sind auch eher Personen mit ausgeprägtem Sensation Seeking, die sich vom Surfen angezogen fühlen. Erfahrene Surferinnen und Surfer berichten von Gewöhnungseffekten: Zwar spürten sie auch bei kleineren Wellen Zufriedenheit, um einen Thrill in bereits erlebter Intensität zu erfahren, brauche es aber immer größere Wellen, immer höhere Risiken.
Der australische Psychologe Richy Bennett, Autor des Buches The Surfer’s Mind, sagte dem Magazin The Psychologist: Surfen erlaube es uns, mit dem Ozean „zu spielen“ und sich gleichzeitig mit der eigenen Sterblichkeit zu konfrontieren angesichts der für uns unkontrollierbaren Kraft der Natur. Man könne dabei „sein ganzes Dasein“ erforschen, „von den großartigsten Flow-Erlebnissen zu den schlimmsten Todesängsten“.
8. Surfen verbindet uns mit der Natur
Fürs Surfen brauchen wir Wasser, und mit diesem Element fühlen wir Menschen uns per se stark verbunden. Allein der Anblick von Flüssen, Seen oder Küsten, als blue space bezeichnete Landschaftselemente, führt zu positiven Emotionen. Das Meer mit seiner Weite, Wasser, Wellen, Horizont, macht uns ehrfürchtig. Die gewaltige Natur, „Angst- und Trostraum in einem“, wie es in dem Buch Meer, du berührst meine Seele heißt, bringt uns zum Staunen – wir fühlen uns im Vergleich klein und unwichtig, im besten Sinn.
Sind wir tatsächlich am Meer, stimuliert uns die Begegnung auf vielfältige Weise. Die Beschäftigung im und am Wasser, der Sand, die Sonne, die Luft, Meeresrauschen, all das löst körperliche und psychische Prozesse aus, die unser Wohlbefinden stärken. Wir fühlen uns frei in dieser Umgebung, die Erholung steigt und Stressgefühle nehmen ab.
Fürs Surfen müssen wir die Bedingungen, die die Natur uns vorgibt, genau studieren und verstehen lernen: Wind, Wetter, Wellen. Diese detaillierte Beschäftigung mit den natürlichen Gegebenheiten fördert unsere Verbindung zur Umwelt. Wir verstehen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur besser und sorgen uns auch mehr um den Fortbestand des Meeres.
9. Surfen bringt uns zu uns selbst zurück
Beim Surfen sind wir auf uns selbst gestellt und dazu (fast) nackt: Nur ich und das Meer – und dazwischen noch das Board als Vehikel. Wir sind den Elementen schutzlos ausgeliefert, und das ist Gefahr und Gewinn gleichermaßen. Um erfolgreich beim Surfen zu sein, müssen wir nicht nur körperlich fit und geschickt sein, sondern auch die Risiken und Chancen in der sich ständig ändernden maritimen Umgebung richtig einschätzen lernen.
Gelingt uns das, verstehen wir das zu Recht als Resultat eigener Anstrengungen, und das kann uns auch in anderen Bereichen unseres Lebens stärken. Allein beim Schwimmen in natürlichen Gewässern machen wir nützliche Erfahrungen, die sich auf den Alltag übertragen lassen – wie etwa „ins kalte Wasser zu springen“ als Möglichkeit, die Offenheit für Neues zu steigern. (siehe auch: 10. Surfen kann therapeutisch wirken)
Hinzu kommt: Wir sind wie alle Lebewesen aus dem Meer entstanden, unsere Körper bestehen zu großen Teilen aus Wasser, unsere Tränen, unser Schweiß sind salzig – das Meer ist so etwas wie unser Zuhause, auch im psychologischen Sinn. In der Psychoanalyse spricht man von einem „ozeanischen Gefühl“, um das Empfinden einer umfassenden Verbundenheit und Verschmelzung mit der Umwelt zu bezeichnen. Das Meer verkörpert aber auch das Unbewusste, das (Ur-) Weibliche und Mütterliche, wie etwa das Buch Meer, du berührst meine Seele ausführt.
10. Surfen kann therapeutisch wirken
Natur, Bewegung, Gemeinschaft, Selbstwirksamkeit: Die Idee, dass Surfen eine therapeutische Wirkung haben kann, überrascht bei näherer Betrachtung nicht. Tatsächlich ist das Anliegen, Surfen als Intervention bekannter zu machen, das die 2017 gegründete International Surf Therapy Organization (ISTO) antreibt, kein Zeichen für eine Weiterentwicklung des Sports, sondern eher eine Art Rückbesinnung zu den Anfängen und der frühen Bedeutung des Surfens für indigene Völker etwa in Tahiti oder Hawaii.
Laut der Juniorprofessorin Kau’i Baumhofer Merritt von der University of Hawaii sei Surfen in Hawaii schon vor Jahrtausenden eine „mentale, physische und spirituelle Aktivität“ gewesen, die gleichermaßen „angeregt und geheilt“ habe, wie US-Autor Cash Lambert in seinem Buch Surf Therapy ausführt. Surfen diente damals zwar auch der Fitness sowie als Möglichkeit, Überlegenheit zu demonstrieren, Konflikte zu lösen und Partnerschaften zu stiften, wie es in dem Buch Surfing: A History of the Ancient Hawaiian Sport heißt. Spiritualität spielte indes immer eine große Rolle bei dem „Tanz mit den Wellen“, dessen Ziel es war, sich eins zu fühlen mit der Welt und der Welle im Besonderen. Studien belegen, dass Surfen tatsächlich Gefühle der Spiritualität verstärken kann.
Surf-Psychologe Richy Bennett verbindet mit dem Surfen existenzielle Gefühle wie etwa das Gehaltenwerden durch den Ozean beim Paddeln oder das Erwischen einer Welle, das an das Hochnehmen eines Babys durch die Eltern erinnere. Der Ozean sei ein Ort, der nicht urteile, der bedingungslos sei: „Egal, ob man Anfänger ist oder Fortgeschrittener: Die selbe Welle wird dich mit derselben Kraft treffen.“ Traumatisierten Menschen falle es leichter, sich in so einer Umgebung wieder verletzlich zu zeigen und loszulassen – ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Besserung, so Bennett.
Tatsächlich ist für die Behandlung von Posttraumatischen Belastungsstörungen bei US-amerikanischen Veteranen eine signifikante positive Wirkung von Surf-Programmen belegt. Auch bei anderen Zielgruppen waren nach einer solchen Intervention ein erhöhtes Wohlbefinden sowie eine Reduktion der psychischen Symptome beobachtbar. In Deutschland bietet das Universitätsklinikum Freiburg seit 2022 eine „Surftherapie“ für Jugendliche mit Depressionen an – allerdings wird das Programm ausdrücklich nur als Ergänzung und nicht als Ersatz einer Psychotherapie angesehen.
Möchten Sie mehr zum Thema erfahren? Dann lesen Sie unseren Beitrag zur Surftherapie in Freiburg – mit Erfahrungsberichten einer Teilnehmerin sowie einer beteiligten Psychotherapeutin. Plus: Alle wichtigen Fakten und verbundenen Kenntnisse aus der Wissenschaft.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!
Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.
Quellen
Amrhein, M., Barkhoff, H., Heiby, E. M. (2021). The effects of an ocean surfing course intervention on spirituality and depression. The Sport Journal, 10.09.2021
Emily Beaumont: The local surfer: Issues of identity and community within South East Cornwall. University of Exeter 2011
Berger, J. (2008): Identity signaling, social influence, and social contagion. In M. J. Prinstein & K. A. Dodge (Hrsg.): Understanding peer influence in children and adolescents (181–199). The Guilford Press 2008
Deutscher Wellenreitverband: Wellenreiten und Umwelt (zuletzt abgerufen am 07.08.2025)
Diehm, R., Armatas, C. (2004). Surfing: an avenue for socially acceptable risk-taking, satisfying needs for sensation seeking and experience seeking. Personality and Individual Differences, 36 (3), 663–677
Elmahdy Y. M., Orams, M., Mykletun, R. J. (2024). Exploring the personal benefits of surfing: insights from cold-water surfers in Jæren, Norway. Frontiers in Sustainable Tourism, 1286424.
Ben Finney, James D. Houston: Surfing: A History of the Ancient Hawaiian Sport. Pomegranate Artbooks 1996
Gallardo-Pujol, D., Renom Pinsach, J., Viñals Vilà, L. (2024): Blue health: How the sea benefits our physical and mental wellbeing. The Conversation, 19.11.2024 (zuletzt abgerufen am 04.08.2025)
Gascon, M., Zijlema, W., Vert, C., White, M. P., Nieuwenhuijsen, M. J. (2017). Outdoor blue spaces, human health and well-being: A systematic review of quantitative studies. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 220/8, 1207–1221
Gordon, D.: ‚You explore your entire being‘. The Psychologist, 29.06.2021 (zuletzt abgerufen am 04.08.2025)
David M. Kennedy (Hrsg.): The Science and Culture of Surfing. Springer 2025
Cash Lambert: Surf Therapy. Hatherleigh 2024
Manero, A., George, P., Yusoff, A. (2024). Understanding surfing as a ‚blue space‘ activity for its contributions to health and wellbeing. npj Ocean Sustainability, 3/37
Moreton, S. G., Brennan, M. K., Nicholls, V. I., Wolf, I. D., & Muir, D. L. (2021). Exploring potential mechanisms underpinning the therapeutic effects of surfing. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 22(2), 117–134
Natursport.info: Wellenreiten (zuletzt abgerufen am 07.08.2025)
Nendel, J. (2009). Surfing in Early Twentieth-Century Hawai’i: The Appropriation of a Transcendent Experience to Competitive American Sport. International Journal of the History of Sport, 26/16, 2432–2446
O’Brien, D. (2025). Surf Tourism. In: Kennedy, D. M. (Hrsg.): The Science and Culture of Surfing. Springer 2025
Peck, B. D., Lagopoulos, J. (2019). How Surfing Could be a Treatment for Mental Illness. Frontiers for Young Minds, 7:70
Lisa A. Reese: Marketing the Authentic Surfer: Authenticity, Lifestyle, Lifestyle Branding. Washington State University 2009
Richard Reschika: Meer, du berührst meine Seele. Gütersloher Verlagshaus 2012
Román, C., Borja, A., Uyarra, M. V., Sarai Pouso, S. (2022): Surfing the waves: Environmental and socio-economic aspects of surf tourism and recreation. Science of The Total Environment, 826, 154122
Sims, C., O’Brien, D. (2025). The Surf Industry. In: Kennedy, D.M. (Hrsg.) The Science and Culture of Surfing. Springer 2025
Schkade, D. A., & Kahneman, D. (1998). Does Living in California Make People Happy? A Focusing Illusion in Judgments of Life Satisfaction. Psychological Science, 9(5), 340–346
Stranger, M. (1999). The Aesthetics of Risk: A Study of Surfing. International Review for the Sociology of Sport, 34(3), 265–276
Taylor A, O'Malley M, O'Callaghan R, Goodwin J. (2025): Exploring the Use of Sea Swimming as an Intervention With Young People With Mental Health Challenges: A Qualitative Descriptive Study. International Journal of Mental Health Nursing, 34: e70000
Mayla Wedekind: Das Meer, die Welle und ich. Gräfe und Unzer 2024