Kurz vor meinem Masterabschluss absolviere ich mein letztes Praktikum in einer Psychiatrie. Ich hole einen neu aufgenommenen Patienten zur Diagnostik ab. Vor den Klinikfenstern wärmt die rare Märzsonne den asphaltierten Parkplatz auf. Ich klopfe beschwingt an die Tür.
„Ah, Sie sind die Ernährungsberaterin?“, fragt der Patient, bevor ich mich vorstellen kann. „Nein, die Psychologin“, erwidere ich irritiert, „haben Sie denn einen Termin zur Ernährungsberatung?“ „Nein“, sagt der Patient, seinerseits irritiert, „ich dachte nur, weil…“ Er bricht mitten im Satz ab, wandert mit seinem Blick von meinem Haar, über meinen Körper, zu meinen Füßen, besinnt sich dann und blickt schuldbewusst zu mir. Ich kommentiere das nicht, stelle mich mit Namen und Stationszugehörigkeit vor und führe die Diagnostik durch. Während der Patient am Computer einen Fragebogen bearbeitet, blicke ich heimlich an mir herunter. Ich trage einen leichten Strickpullover mit heller Jeans – und frage mich, ob das ein typisches Ernährungsberaterinnen-Outfit ist.
Vieldeutige Situationen wie diese sind viel häufiger als offener Sexismus. Diesen habe ich auch erlebt – von der anzüglich gestellten Frage, ob ich jemanden „auch mal diagnostizieren“ könne, bis zu abwertenden Geschlechterstereotypen in der Gruppentherapie. Meine Ausbildungskolleginnen berichten Ähnliches. Diskriminierung hat immer auch eine Machtkomponente. Zum Beispiel erlebe ich, dass unsere Praktikantinnen viel häufiger angeflirtet oder nach ihrem privaten Kontakt gefragt werden, als feste Teammitglieder.
Wenn mir in meinem Alltag jemand unangemessen oder sogar übergriffig begegnet, werde ich wütend und grenze mich ab. „Das ist sexistisch“, oder „sprich nicht so mit mir“, sage ich dann zum Beispiel.
Wie aber können wir in der Psychiatrie damit umgehen, in der die Patientinnen und Patienten Schutzbefohlene sind, für die wir Verantwortung tragen? Das Unbehagen, einen Patienten für sein Verhalten zu kritisieren und möglicherweise auch zu beschämen, ist groß. Schließlich haben wir den Auftrag, zu seinem psychischen Wohlbefinden beizutragen. Deshalb habe ich schon oft geschwiegen.
Dabei liegt in den meisten dieser Situationen ein Potenzial für einen konstruktiven gemeinsamen Austausch: Manchmal sind die Patienten dankbar für den Hinweis, dass ihr Spruch verletzend oder unangemessen war. Möglicherweise erfahren sie immer wieder Ablehnung, ohne genau zu verstehen, was sie anders machen könnten. Manchmal fühlen sich die weiblichen Patientinnen auf dem Gang besser geschützt, weil sie merken, dass sexistisches Verhalten vom Personal nicht einfach hingenommen wird und sie das folglich auch nicht müssen. Und manchmal geht es auch einfach um die eigene Würde und Selbstfürsorge. In einer Supervisionsstunde haben wir gesammelt, wie wir mit Aussagen dieser Art am besten umgehen können. Beispiele waren:
„Ich nehme das als Kompliment. Ich darf und möchte Ihnen auf dieser privaten Ebene allerdings nicht begegnen. Deshalb möchte ich Sie bitten, solche Kommentare in Zukunft zu unterlassen.“
„Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Was möchten Sie damit sagen?“
„Wenn es um belastende und persönliche Themen geht, habe ich öfter den Eindruck, dass Sie mit mir flirten. Wie sehen Sie das?“
„Das empfinde ich als sexistisch. Bitte achten Sie auf meine Grenzen.“
In der Ausbildung lernen wir, Rückmeldungen ehrlich zu formulieren und dabei die therapeutische Beziehung aufrecht zu erhalten. Hoffentlich lernen wir genauso, unsere eigenen Grenzen zu spüren und diese freundlich und bestimmt zu wahren. Letzten Endes geht es darum, Therapie zu einem möglichst sicheren Raum zu machen. Für beide Seiten.

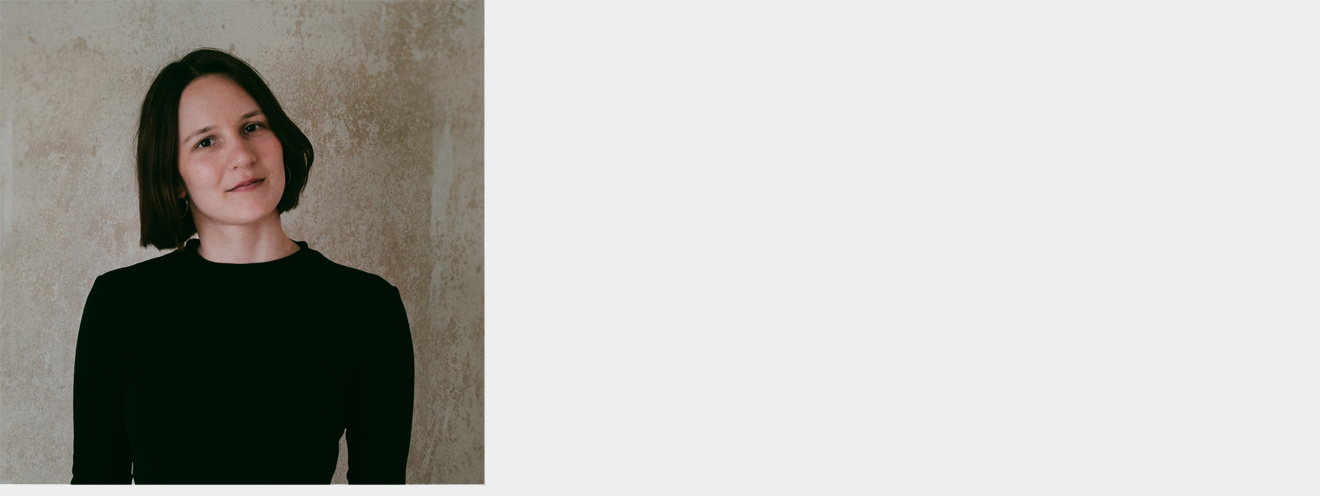
Transparenz-Hinweis: Es gibt keine Therapeutin ohne Patientinnen – deshalb erzählt diese Kolumne von Menschen in der Psychiatrie. Da der Schutz der Behandelten an oberster Stelle steht, werden die Fallbeispiele bezüglich ihrer soziodemographischen und biografischen Daten stark verändert und erscheinen mit zeitlichem Abstand. Die berichteten Begegnungen bleiben in ihrem emotionalen Kern erhalten.








