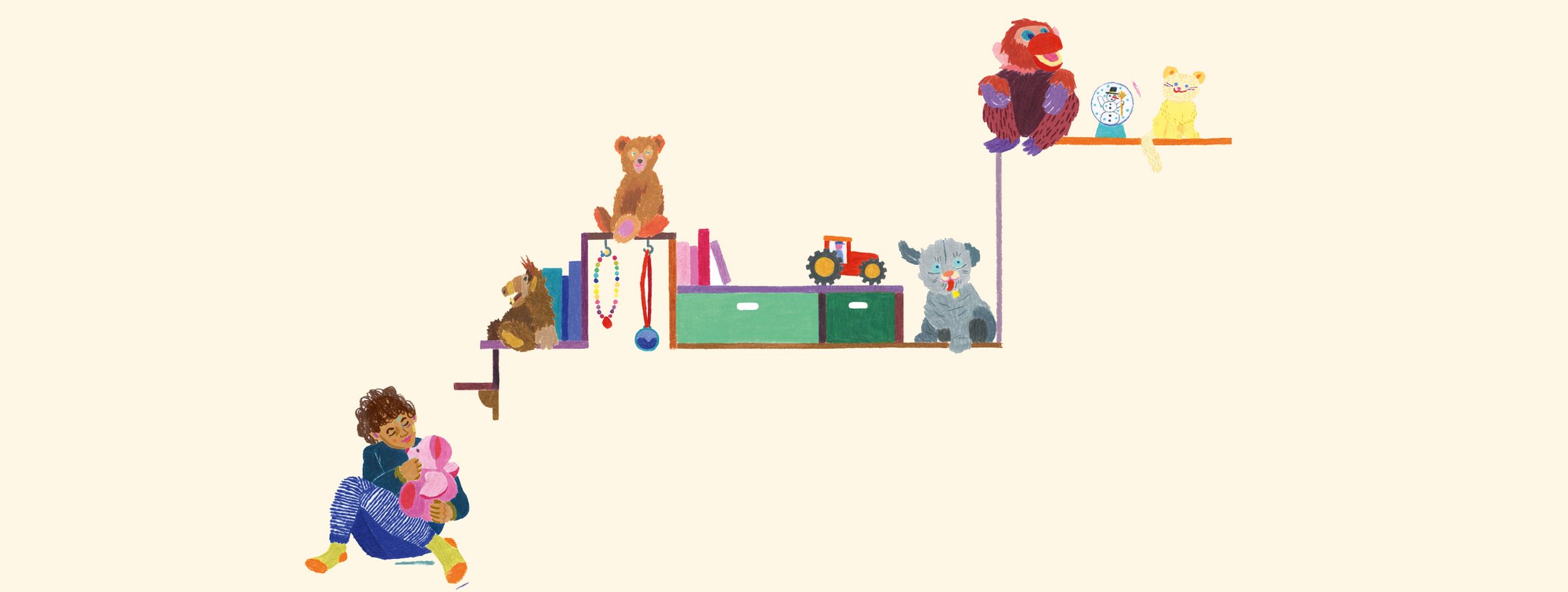Mal ehrlich: Haben Sie noch ein Kuscheltier? Obwohl Sie längst erwachsen sind? Schläft es bei Ihnen im Bett und kuscheln Sie noch manchmal damit, wenn Sie einen schlechten Tag haben? Nehmen Sie es noch mit auf Reisen? Damit zumindest wären Sie nicht allein: In einer repräsentativen Befragung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) unter 1100 Deutschen gaben im Jahr 2013 fast ein Fünftel der Frauen und ein Zehntel der Männer an, ihr Kuscheltier noch mitzunehmen. 14 Prozent aller Befragten können nicht…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
können nicht ohne einschlafen.
„Alle Menschen haben ein Bedürfnis, ein Verlangen nach sozial-emotionalem Kontakt“, sagt Shu-Chen Li, Professorin für Entwicklungspsychologie und Neurowissenschaft der Lebensspanne an der Technischen Universität Dresden.
Ein Aspekt sozial-emotionalen Kontakts ist Berührung, also streicheln, kuscheln, anschmiegen. Li erzählt, dass Streicheln in einer bestimmten Geschwindigkeit Rezeptoren unter der Haut aktiviert, die Stress und negative Gefühle wie Einsamkeit lindern. Auch der Anblick einer anderen Person, die zärtlich berührt wird, löst ähnliche Reaktionen in Gehirnregionen aus, die für das Sozialverhalten wichtig sind. „Man kann spekulieren, dass das Gefühl der sanften Berührung beim Streicheln von Kuscheltieren ähnliche Auswirkungen haben könnte“, sagt Shu-Chen Li. Um dies zu überprüfen, müsste man jedoch neue empirische Studien durchführen.
Der Druck, erwachsen zu sein
Li sagt, es könne auch befreiend sein, seiner kindlichen Seite durch das Kuscheltier Raum zu geben, besonders für Menschen, die beruflich viel Verantwortung trügen. Gelegentlich sei der Druck, erwachsen zu sein und seine Rolle zu spielen, besonders groß – genau wie das Bedürfnis nach Ausgleich und Entspannung. Kuscheltiere stünden oft auch für schöne Erinnerungen an die Kindheit. Noch immer eine Verbindung zu ihr zu haben werde viel zu oft negativ beäugt, offen darüber zu sprechen sei nicht immer einfach.
Diese Erfahrung macht auch Denise Rudolf. Sie repariert Teddybären, Kuscheläffchen und Plüschlämmchen, die vor lauter Liebe drohen auseinanderzufallen. Was einmal als Hobby angefangen hat, ist für sie mittlerweile zum Beruf geworden: Der Bedarf ist einfach zu groß. Jeden Monat nimmt sie sich vier bis fünf Tiere vor. Doch ihre Patienten wandern nach der Behandlung in den meisten Fällen nicht etwa zurück in die Arme sehnsüchtig wartender Kinder, sondern zu ihren erwachsenen Besitzerinnen und Besitzern.
Kuschelig, weich und warm
Ihre Kuscheltierklinik sei für viele eine Art safe space, an dem sie die Nähe zu ihrem flauschigen Freund nicht verstecken müssten. „Manche sprechen noch mit ihren Kuscheltieren, wenn sie sie bei mir abgeben, und verabschieden sich“, sagt Rudolf.
Warum die einen ihren Bären aus Kindertagen in einer Kiste im Keller vergessen, andere ihn aber zum Einschlafen im Arm halten, ist noch nicht genauer erforscht. Besser untersucht ist hingegen die Beziehung zu Kuscheltieren im Kindesalter:
Bereits Anfang der 1950er Jahre prägte der englische Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott den Begriff des Übergangsobjekts: Objekte wie zum Beispiel Kuscheltiere sollen Kleinkindern helfen, den Unterschied zwischen sich selbst und der Welt außerhalb des eigenen Körpers zu verstehen. Eine wichtige Funktion dieses Übergangsobjekts ist aber auch, zu beruhigen und zu trösten, wenn die engste Bezugsperson nicht da sein kann. Gerade deshalb sind Übergangsobjekte häufig Stofftiere, die sich kuschelig, weich und warm anfühlen und auch den eigenen Geruch annehmen.
„Das Kuscheltier ist für Kinder Beziehungspartner, Spielpartner, Seelentröster, aber auch Übungspartner beim Sprechenlernen“, sagt Holger Domsch, Professor für Entwicklungspsychologie an der FH Münster. „Viele Kleinkinder nennen auf die Frage, wer ihr Freund sei, auch ihr Kuscheltier. Das zeigt, welche Fantasiekraft in diesem Alter vorhanden ist und wofür das Kuscheltier stehen kann.“
Vom Bett in den Schrank
Wenn sich mit dem Heranwachsen die Beziehungen zu anderen Menschen verändern und Kindheitsfantasien weniger werden, verlieren Kuscheltiere für ihre Besitzerinnen und Besitzer zunehmend an Bedeutung. Ein weiterer Faktor, der beim Ablöseprozess eine Rolle spielt, sind wahrscheinlich auch soziale Normen: „Im Jugendalter sind im Zuge der Identitätssuche das Streben nach dem Erwachsenenalter und eine starke Befürchtung, dass Gleichaltrige Negatives denken könnten, charakteristisch. Dies ist sicherlich ebenfalls ein Katalysator dafür, dass das Kuscheltier weniger bedeutsam wird“, sagt Holger Domsch.
Das muss aber nicht bedeuten, dass die vorher so geliebten Plüschtiere dann weggegeben oder entsorgt werden – sie werden aber weniger mitgenommen, wandern vielleicht nach und nach vom Bett ins Regal, später in eine Kiste und dann in den Keller.
Einige Menschen, die auch im Erwachsenenalter häufiger noch Kuscheltiere bei sich tragen, sind Patientinnen und Patienten in Psychiatrien. Als auffallend viele von ihnen, insbesondere Frauen mit bestimmten Diagnosen, Kuscheltiere für den Aufenthalt in der Psychiatrie am Ulmer Universitätsklinikum mitbrachten, bewog das Markus Kiefer, Leiter der Abteilung für kognitive Elektrophysiologie, Psychiatrie und Psychotherapie, dieses Phänomen näher zu untersuchen.
Kuscheltierschwemme im Krankenhaus
In einer kleinen Studie mit 16 Frauen mit Borderlinestörung und 16 gesunden Frauen nahm Kiefer die Wirkung von Kuscheltieren in Bezug auf die Hirnaktivität in den Blick. Voraussetzung für die Teilnahme war, selbst noch ein Kuscheltier zu besitzen. Den Teilnehmerinnen wurden dann sowohl Bilder ihrer Lieblingskuscheltiere gezeigt als auch von solchen, die für sie weniger Bedeutung hatten. Die Hirnaktivität der Patientinnen wurde mit der von nicht erkrankten Frauen verglichen.
„Wenn die Patientinnen Bilder ihrer Bezugskuscheltiere sahen, waren frontale Hirnareale stärker aktiv als bei den Bildern anderer vertrauter Kuscheltiere oder fremder Objekte. Das deutet darauf hin, dass Bezugskuscheltiere gerade für Patientinnen mit Borderline eine hohe emotionale Bedeutung haben“, sagt Kiefer zu den Ergebnissen. Dieser Effekt war umso größer, je depressiver die Patientinnen und je größer ihre Ängste waren, geliebte Bezugspersonen zu verlieren. Zwar hatten die Kuscheltiere auch für die Teilnehmerinnen ohne Diagnose eine emotionale Bedeutung, es zeigte sich aber, dass sie die Objekte nicht essenziell brauchten.
Für Borderlinepatientinnen funktionieren ihre Kuscheltiere also wie Übergangsobjekte in der Kindheit: Zum einen können sie durch das Objekt Emotionen ableiten. Richtig eingesetzt kann das helfen, etwa selbstverletzendes Verhalten zu vermeiden. Zum anderen bieten Kuscheltiere aber auch einen stabilen Bezugspunkt, wenn es Patientinnen oder Patienten – zum Beispiel durch schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit – schwerfällt, Vertrauen aufzubauen und Beziehungen einzugehen. Das Kuscheltier ist immer verfügbar, verletzt nicht und spricht kein böses Wort.
Je größer die Bindungsangst, desto größer auch die Bindung an das Kuscheltier. Andersherum kann eine abnehmende Bindung ein Indikator für einen besseren Gesundheitszustand sein: Kann die Patientin öfter auf das Kuscheltier verzichten, kann das dafür sprechen, dass die Symptome auch insgesamt weniger geworden sind.
Für traurige Momente
Vor der Studie von Markus Kiefer führte das Ulmer Uniklinikum auch eine systematische Beobachtungsstudie durch, die den Anfangseindruck bestätigte: Besonders Patientinnen mit Persönlichkeitsstörungen hatten für sie emotional bedeutsame Gegenstände wie Kuscheltiere im Gepäck; Patientinnen mit anderen Diagnosen seltener.
Ähnliches fand auch ein finnisches Forschungsteam heraus, das den Zusammenhang zwischen der engen Bindung an gewisse Objekte und Depressionen untersuchte. Das Team fragte 1054 Jugendliche – Durchschnittsalter 14 Jahre –, wer von ihnen noch Übergangsobjekte habe und welche das seien. In einem weiteren Schritt mussten die Jugendlichen Fragen zu Symptomen von Depression beantworten.
Das Ergebnis: Zwar zeigten sich in Bezug auf Depressionen keine signifikanten Unterschiede zwischen denen, die ein Übergangsobjekt nutzten, und denen, die ohne eines auskamen, besonders bei Mädchen konnte allerdings ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Nutzung von Übergangsobjekten und dem Gefühl von Traurigkeit und Einsamkeit festgestellt werden.
Kindheitserinnerung oder Unsicherheit
Doch bedeutet das, dass jeder Mensch, der noch an seinem Stofftier hängt, womöglich auch an einer psychischen Erkrankung leidet? „Entscheidend ist die emotionale Funktion, die das Kuscheltier hat“, sagt Markus Kiefer.
Wer also ein Kuscheltier im Regal stehen hat, weil sie es süß findet oder weil er damit schöne Kindheitserinnerungen verbindet, hat eine andere Beziehung zum Kuscheltier als jemand, der ohne es nicht einschlafen kann. Oder jemand, der emotional aufgewühlt und unruhig ist, wenn es einmal nicht in der Nähe ist.
„Die Vermutung liegt nahe, dass Menschen, die als Erwachsene noch eine intensive emotionale Beziehung zu ihrem Kuscheltier haben, zumindest eine akzentuierte Persönlichkeit oder eine gewisse emotionale Instabilität oder Bindungsunsicherheit haben“, sagt Markus Kiefer – allerdings mit dem deutlichen Hinweis, dass es dazu keine belastbaren Zahlen oder Studien unter Menschen ohne psychologische Diagnose gebe.
Pathologisch abhängig?
Ähnliches vermutet auch Georg Krause, der beim Kölner Caritasverband mit psychisch schwerkranken Menschen gearbeitet hat und nun eine Ehe-, Partnerschafts- und Trauerberatung betreibt:
„Menschen, für die ihre Kuscheltiere auch später noch eine große Bedeutung haben, gehören wahrscheinlich eher zu den unsicher gebundenen Bindungstypen.“ In seiner Praxis erlebt er immer wieder, dass Kuscheltiere als Ersatz dienen, wenn es um bestimmte Gefühle geht – zum Beispiel Trauer, Einsamkeit oder Verlassensängste. „Diese Gefühle kann man mit Kuscheltieren gut ausleben, das kennen viele noch aus der Kindheit“, sagt Krause. Die Objekte könnten aber auch mit positiven Gefühlen verknüpft sein, etwa wenn jemand gerne sammelt.
Allen, die sich fragen, ob ihr Verhalten pathologisch ist, zum Beispiel in Bezug auf Kuscheltiere, empfiehlt Krause folgende drei Fragen: Dauert das Verhalten länger als ein halbes Jahr? Werden dadurch soziale Kontakte vernachlässigt oder zerstört? Besteht Leidensdruck? Wer zwei oder drei dieser Fragen mit „Ja“ beantworte, könne darüber nachdenken, mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten zu sprechen, sagt Krause.
In seiner Arbeit mit Paaren erlebt er Probleme mit Kuscheltieren vor allem, wenn eine Person noch am Kuscheltier hängt und die andere das nicht akzeptiert. Oder wenn Konkurrenzdenken entsteht, etwa weil einer der beiden lieber oder intensiver mit dem Teddy kuschelt als mit der Partnerin oder dem Partner.
Schräglage im Bett
Auch auf die Sexualität in der Partnerschaft können Kuscheltiere im gemeinsamen Bett negative Auswirkungen haben. Allerdings nicht rein durch ihre Anwesenheit, denn die könne man ausblenden. „Paare sprechen und nähern sich einander normalerweise auf der Erwachsenenebene. Tut einer von beiden dies auf der Kindebene, etwa weil er mit Kuscheltieren spielt oder mit einer kindlichen Stimme spricht, kann eine Schräglage entstehen“, sagt der Paartherapeut. Wenn er das auch im sexuellen Kontext tut, könne das dafür sorgen, dass keine Lust aufkommt.
Denjenigen, die sich deshalb von ihren Stofftieren lösen wollen, empfiehlt er, langsam vorzugehen. Durch das Kuscheltier werde ein Bedürfnis gestillt. Fehlt das ganz plötzlich, sucht man nach einem Ersatz, ähnlich wie Ex-Raucherinnen, die statt zu rauchen nun Schokolade essen. Wichtig sei dabei auch die Frage nach dem Anlass. Warum will ich mich lösen? Warum stört es? Und wen stört es überhaupt?
„Wenn man seine Kuscheltiere weggibt, nur weil der Partner das verlangt, ist das kein guter Grund. Wenn Kuscheltiere einem wichtig sind, darf man sich darin natürlich treu bleiben.“ Mit dem Partner könne man bessere Kompromisse finden, etwa sie vom Bett in den Schrank zu räumen.
Das Kuscheltier und der Tod
Wenn sie im Erwachsenenalter auch oft als skurril empfunden werden, haben Kuscheltiere also durchaus eine Funktion. Man beginne deshalb langsam, in der Trauerberatung mit ihnen zu arbeiten. „Erwachsene haben da oft noch Hemmungen“, sagt Krause. Dabei könnten die Plüschtiere auch ihnen Trost spenden und einen Verlust leichter machen. Außerdem helfen sie vielen gegen Einsamkeit. Während der Coronalockdowns – so vermutet Krause – könnten Kuscheltiere womöglich sogar Leben gerettet haben.
Literatur
Ritva Erkolahti u.a.: The prevalence of transitional object use in adolescence: is there a connection between the existence of a transitional object and depressive symptoms? European Child & Adolescent Psychiatry, 18, 2009, 400–406. DOI: 10.1007/s00787-009-0747-7
Markus Kiefer u.a.: Brain activity to transitional objects in patients with borderline personality disorder. Scientific Reports, 7/13121, 2017. DOI: 10.1038/s41598-017-13508-8
Mariana von Mohr u.a.: The soothing function of touch: affective touch reduces feelings of social exclusion. Scientific Reports, 7/13516, 2017. DOI: 10.1038/s41598-017-13355-7
Carlos Schönfeldt-Lecuona u.a.: Relationship between transitional objects and personality disorders in female psychiatric inpatients: a prospective study. Journal of Personality Disorders, 28/154, 2014. DOI: 10.1521/pedi_2014_28_154
Isac Sehlstedt u.a.: Gentle touch perception across the lifespan. Psychology and Aging, 31/2, 2016, 176–184. DOI: 10.1037/pag0000074
Donald W. Winnicott: Vom Spiel zur Kreativität. Klett Cotta, Stuttgart 1974