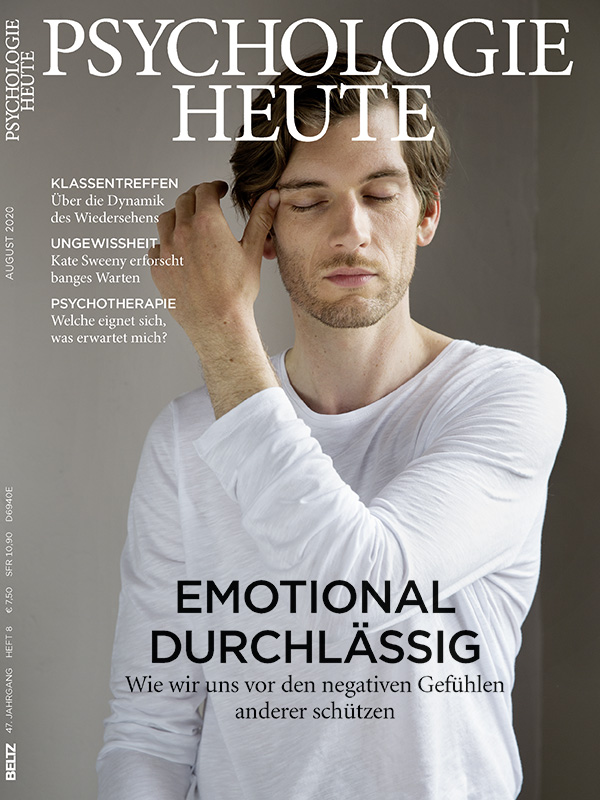Zunächst ist es lediglich „ein Problem“ – eine schwierige Geschichte. Es gibt verschiedene Versuche, das Problem zu lösen, doch es ist unverändert da. Inzwischen reden auch andere darüber, Partner, Freunde, Eltern. Das Problem hat noch keinen festen Namen. Mal heißt es „Stress“, dann „Beziehungsschwierigkeiten“, dann sind es „ein paar schlechte Tage“. Mal sieht es so aus, als seien der Job oder die Kinder die Auslöser; mal so, als liege es doch an uns selbst: „Du nimmst dir aber auch immer alles so zu Herzen!“ Irgendwann entsteht daraus die Idee, es sei „etwas Psychisches“. Sofort regt sich Widerstand. Muss ich in Therapie? Ich doch nicht! Aber das Problem bleibt. Es ändert sich: anscheinend nichts.
Also wird gegoogelt, die engsten Vertrauten werden einbezogen. Das Problem bekommt jetzt neue Namen: Depression, Angststörung, Persönlichkeitsstörung. Das klingt nach möglichen Ursachen, aber es macht die Sache nicht leichter. Ist das Problem eine Störung, eine Krankheit? Und bedeutet das, dass ich es ohne Hilfe nicht bewältigen kann? Obwohl es eine große Anzahl von Menschen gibt, die sich bei einer genauen Untersuchung als psychisch behandlungsbedürftig erweisen würden, gehen viele nicht zur Psychotherapie. Sie schlagen sich irgendwie durch. Das ist nicht immer verkehrt – manche Probleme lösen sich von allein.
Und wenn nicht? Es ist uns peinlich, Hilfe zu benötigen, zu einer Therapie zu müssen. Der Entschluss für eine Psychotherapie entsteht meist erst dann, wenn die Betroffenen einen bestimmten Punkt überschreiten. Der Psychotherapieforscher Jerome David Frank nannte diesen Punkt Demoralisation, einen verzweifelten Zustand, in dem man nicht mehr weiterweiß.
Es bleibt die Hürde, überhaupt einen Psychotherapeuten zu finden. Viele warten lange auf einen Therapieplatz, im Durchschnitt zwanzig Wochen. Inzwischen vermitteln die Kassenärztlichen Vereinigungen Termine für sogenannte Sprechstunden – auch wenn es in vielen Fällen bei diesem einmaligen Erstkontakt mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten bleibt, weil sie oder er keine Therapietermine frei hat.
Sprechstunden dienen dazu, sich gegenseitig kennenzulernen, das Problem zu klären und zu entscheiden, ob man gut miteinander auskommt. Es ist gut investierte Zeit, mit mehreren Therapeuten zu sprechen, bevor man festlegt, mit wem man – wenn möglich – eine Therapie beginnen möchte. Danach gibt es noch bis zu vier „probatorische Sitzungen“, die dabei helfen sollen, die Therapie vorzubereiten. Anschließend wird der Therapeut bei der Krankenkasse einen Antrag stellen. Das werden zunächst oft zwölf Sitzungen sein, in manchen Fällen aber auch gleich bis zu 60 Stunden. Jederzeit gibt es die Möglichkeit, die Gespräche wieder zu beenden – auch dann, wenn die Therapie schon begonnen wurde.
Welche Therapien gibt es?
Zu Beginn weise ich alle meine Klienten darauf hin, welches die Unterschiede zwischen meinem Ansatz und anderen therapeutischen Verfahren sind. Von den Krankenkassen werden aktuell Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und Psychoanalyse bezahlt. Demnächst wird auch die systemische Therapie zugelassen werden.
Die Therapierichtungen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Ein grundlegender Unterschied besteht in ihrer zeitlichen Ausrichtung. Wir leben in der Gegenwart, hinter uns liegt die Vergangenheit, vor uns die Zukunft.
Alle drei Zeitformen haben Bedeutung für uns: Wir sollten im Hier und Jetzt leben, heißt es. Oft denken wir aber auch, dass die Vergangenheit darüber mitbestimmt, wer wir heute sind. Und entscheidet nicht unsere Vorstellung von der Zukunft darüber, ob wir den Eindruck haben, uns in die richtige Richtung zu bewegen?
Welchen Zeitraum Ihres Lebens finden die Therapeuten der jeweiligen Richtung am spannendsten? Verhaltenstherapeuten orientieren sich häufig an der Gegenwart. Sie wollen wissen, was aktuell passiert und was das Problem jetzt aufrechterhält.
Psychoanalytiker und Tiefenpsychologen konzentrieren sich mehr auf die Vergangenheit. Wie wurde mit uns als Kind umgegangen? Welche Spuren tragen wir davon bis heute in uns? Das Ziel ist, sich selbst besser zu verstehen und dadurch einen anderen Umgang mit sich selbst zu ermöglichen. Dieser Ansatz wurde vom wohl bekanntesten aller Psychotherapeuten entwickelt, von Sigmund Freud. Seine „Redekur“, die er selbst scherzhaft auch als „Schornsteinfegen“ bezeichnete, geht auf die altgriechische Katharsis zurück: die Idee, dass das Aussprechen und kontrollierte Ausleben innerer Konflikte zu ihrer Linderung beiträgt. Wenn Sie also an schlechten Tagen in ihre eigene Vergangenheit schauen, um sich besser zu verstehen, dann stehen Sie damit in der Tradition Freuds.
Es gibt auch Ansätze, die sich mit der Zukunft beschäftigen. Die systemische Therapie etwa interessiert sich vor allem für das Umfeld, in dem das jeweilige Problem entsteht und fortbesteht. Ein Teil der systemischen Therapeuten fragt viel nach Zielen, also wie wir uns das Leben vorstellen, sobald das Problem gelöst sein wird. Sie erfragen, wohin sich ihre Klienten entwickeln wollen. Aus dieser Idee entstand die vielleicht bekannteste Innovation der systemischen Therapie: die Wunderfrage. „Angenommen“, so lautet sie, „es passiert ein Wunder und Ihr Problem ist gelöst. Woran werden Sie das als Erstes merken?“ Danach wird daran gearbeitet, „das Wunder“ Schritt für Schritt Wirklichkeit werden zu lassen.
Was würde Sie in meiner eigenen, verhaltenstherapeutisch ausgerichteten Praxis erwarten? Wir betrachten Ihre Situation in drei Schritten. Zunächst wird der Anlass exploriert: Was ist genau passiert, bevor das Problem auftrat? Was hätte eine Kamera beobachten können? Dann betrachten wir, wie Sie sich gefühlt haben und was Sie anschließend taten. Als Drittes überlegen wir gemeinsam, was Ihnen dabei durch den Kopf gegangen ist.
Ein Beispiel: Die S-Bahn, in die Sie einsteigen, ist rappelvoll, die Luft ist verbraucht und fast schon dickflüssig. Als sich die Türen schließen, schießt Ihnen durch den Kopf: „O Gott, hier drin kann man ja ersticken!“ Sofort beginnt Ihr Herz zu rasen und tatsächlich bekommen Sie heftige Atemprobleme. Nach der Einfahrt in den nächsten Bahnhof hechten Sie auf den Bahnsteig, um dem Erstickungstod zu entkommen. Puh, das ist gerade noch mal gutgegangen!
Wir haben jetzt eine Arbeitsgrundlage und damit auch die Themen, die uns in der Therapie beschäftigen werden: Wir sprechen über Ihre Probleme, indem wir sie anhand Ihrer Gedanken, Gefühle und Handlungen beschreiben, denn als Verhaltenstherapeuten gehen wir davon aus, dass durch bestimmte Denkgewohnheiten harmlose Situationen zu echten Problemen werden können. Für unsere Arbeit ist es also wichtig, dass Sie auf andere Gedanken kommen und sich dadurch auch Ihre Gefühle ändern.
Inzwischen gibt es auch im verhaltenstherapeutischen Ansatz Therapeuten, die sich gern mit der Zukunft und der Vergangenheit beschäftigen. Die Schematherapie etwa sucht nach Verhaltens- und Erlebensmustern, die in der Kindheit entstanden sind, heute aber stören – etwa wenn der Klient sich noch immer so verhält, als müsste er gegen seine abwertende Mutter ankämpfen.
Mit Blick auf die Zukunft ist die sogenannte stärkenbasierte Verhaltenstherapie hingegen davon abgekommen, Probleme ihrer Klienten allzu genau zu analysieren, und versucht stattdessen, positive neue Verhaltensweisen aufzubauen, „neue Träume zu träumen“. Und im eher gegenwartsbezogenen Ansatz des acceptance and commitment (ACT) wird nicht länger versucht, Gedanken zu verändern, sondern zu diesen auf Abstand zu gehen.
Wohin geht die Reise?
Zu all diesen genannten Verfahren gibt es Untersuchungen, die belegen, dass sie bei einem breiten Spektrum an Problemen wirksam sind. Fragen Sie Ihren Therapeuten nach seinem bevorzugten Ansatz. Sie wissen dann besser, was Sie erwartet und worüber bevorzugt gesprochen wird. Viele Menschen haben bereits Präferenzen, wenn sie die psychotherapeutische Praxis betreten, wollen beispielsweise ihre Kindheit aufarbeiten oder lieber konkret etwas tun. Ihre Wünsche an die Therapie sollten Sie offen ansprechen. Grundsätzlich sollte gelten: Die Themen legen Therapeut und Klient gemeinsam fest.
Ich bemerke häufig, dass Klienten im Laufe der Therapie anfangen, sich selbst durch die Brille des Therapeuten zu betrachten. Menschen, die erfolgreich eine Psychoanalyse gemacht haben, erzählen dann von einer „Aussöhnung mit sich selbst“, dass sie gelernt haben, „besser auf Gefühle zu hören“. Wer erfolgreich eine verhaltenstherapeutische Konfrontationstherapie gemacht hat, wird aber vielleicht genau das Gegenteil berichten: Wie es wichtig war, eben nicht auf die eigenen Gefühle zu hören, die einen denken ließen, außerhalb der Wohnung sei es viel zu gefährlich. Stattdessen: „Augen auf und durch! Nicht die Angst entscheidet, sondern ich!“
Sie werden sich im Laufe einer Psychotherapie verändern, etwa in ihrer Haltung, ihren Denkmustern. War das nicht auch von Anfang an die Absicht? Wenn man sich verändert, ist das manchmal auch eine Herausforderung für die Menschen, mit denen man zu tun hat. „Ich erkenne dich gar nicht wieder!“, hören wir dann. Welche Erwartungen haben unsere wichtigsten Partner an die Therapie? Ist da ausschließlich Freude, wenn wir wieder selbständig S-Bahn fahren können? Oder verlieren sie auch eine inzwischen lieb gewordene Rolle als Beschützer?
In einer Psychotherapie werden Probleme oft in einen neuen Zusammenhang gebracht. Ist unsere Angst vor S-Bahnen vielleicht eine Möglichkeit, einen desinteressiert gewordenen Partner dazu zu bewegen, sich mehr um uns zu kümmern? So werden immer wieder Themen angesprochen, die Auswirkungen auf wichtige Menschen in unserem Leben haben können. Deshalb ist es manchmal sinnvoll, den Partner von Beginn an in die Gespräche einzubeziehen.
Die therapeutische Beziehung
Eine zentrale Rolle in der Therapie spielt die Beziehung – manche sprechen lieber von einem „Arbeitsbündnis“ – zwischen Klient und Therapeut. Wir erinnern uns an viele Menschen, mit denen wir uns wohlgefühlt haben, bei denen „die Chemie stimmte“. Und auch an solche, wo das nicht der Fall war. Oft ist es schwer, in Worte zu fassen, warum wir mit einigen besser und mit anderen schlechter auskommen. Der Philosoph Michel de Montaigne hat einmal versucht zu erklären, was seine Freundschaft mit einem bestimmten Menschen ausmachte, und endete fast resigniert mit den Worten: „Weil er und ich es waren.“ Was eine gute Beziehung ausmacht, lässt sich wohl am besten aus dem Bauch heraus beantworten.
Viele Psychotherapieforscher halten die therapeutische Beziehung für den wichtigsten Faktor, der zum Gelingen beiträgt. Wie kaum ein anderer hat sich Carl Rogers für eine gute Beziehung zwischen Therapeut und Klient starkgemacht. Rogers ist der Erfinder der „Gesprächstherapie“. Der Therapeut sollte seinen Gesprächspartnern echt, empathisch und zugewandt begegnen, meinte er. Und der Psychotherapeut Victor Meyer hat einmal gesagt: „Man kommt mit einem Patienten mit einer guten therapeutischen Beziehung und lausigen Techniken weiter als mit guten Techniken und einer lausigen Beziehung.“
Auch Verhaltenstherapeuten machen sich inzwischen viele Gedanken, wie man die Beziehung zu den Klienten so gestalten kann, dass sie den Bedürfnissen und Zielen der Klienten gerecht wird. Zu diesen Zielen zählen sie das „Streben nach Selbstwert“ sowie den „Wunsch nach Kontrolle und Anerkennung“. Die schematherapeutisch orientierten Verhaltenstherapeuten gehen noch weiter und sagen, dass sie ihre Klienten „neu beeltern“. Sie versuchen, eine „korrigierende Beziehungserfahrung“ zu ermöglichen, also nachträglich diejenigen Erfahrungen zu ermöglichen, die in der Kindheit gefehlt haben. Ein solches Vorgehen kommt tiefenpsychologischen Therapeuten bekannt vor.
Wann also ist die Beziehung zwischen Klient und Therapeut gut? Wenn sie eine gemeinsame Auffassung vom Problem, der angestrebten Lösung und von den Mitteln haben, mit denen man die Ziele des Klienten erreicht. So pragmatisch definiert der Psychotherapieforscher Bruce Wampold die therapeutische Beziehung. Ziehen beide gemeinsam an einem Strang, sagt Wampold, dann werden sie mit Freude und Nachdruck gemeinsame Anstrengungen unternehmen, die zum Erfolg führen. Und das meint man ja meist, wenn man sagt, dass „die Chemie stimmt“.
Wenn es in der Therapie hakt
Trotzdem läuft nicht immer alles glatt. Nehmen wir mal folgendes Szenario an: Lange Zeit haben Sie sich in der Therapie wohlgefühlt und haben Fortschritte gemacht. Doch in letzter Zeit fühlen Sie sich zu Veränderungen gedrängt, die Sie nicht gutheißen. Zudem wirkt der Therapeut unkonzentriert: Ihr Onkel heißt doch gar nicht Hermann!
Ein guter Therapeut wird immer wieder nachfragen, ob es irgendwann in der Therapie hakt. Und ein „guter Klient“ sollte aktiv ansprechen, wenn es hakt. Beides ist nicht selbstverständlich. Die Forschung sagt, dass Therapien, in denen Schwierigkeiten, die zwischen Therapeut und Klient aufgetaucht sind, besprochen und behoben werden, oft besonders gute Ergebnisse haben. Freuen wir uns also darauf, wenn es mal hakt und wir darüber sprechen können!
Manchmal liegt es auch daran, dass ein Problem nicht durch Therapie lösbar ist, etwa wenn die Arbeits- und Wohnsituation mit an der Problematik schuld ist oder eine organische Krankheit das Problem weiterbestehen lässt. Dann muss sich der Fokus der Therapie verändern. Wie kann ich mit dem Krebs erträglich leben? Welche Stellen kann ich ansprechen, um eine bessere Wohnung oder Arbeit zu bekommen?
Wenn es in der Therapie Probleme gibt, dann kann man das also manchmal auch dadurch verbessern, dass man die Ziele neu justiert. So sind zum Beispiel „mehr Selbstbewusstsein“, „glückliche Beziehungen“ oder „Angstfreiheit“ häufige Wünsche an die Therapie. Weil das jedoch sehr breite Begriffe sind, ist nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Therapeuten sagen manchmal: Es wird ein langer Tag auf dem Golfplatz, wenn man nicht weiß, wo das 18. Loch ist… Es ist eine der wichtigsten Aufgaben des Therapeuten, gemeinsam mit dem Klienten aus solchen Wünschen erreichbare Therapieziele zu formulieren, also etwa: „Bei meinem Chef und meinen Eltern meine Meinung klar zum Ausdruck bringen“, „Beim Streiten mit meiner Partnerin sachlich bleiben“ oder „Trotz Angst zum Zahnarzt gehen“.
Weil manche Veränderungen außerhalb der aktuellen Lebenserfahrung liegen, kann es manchmal auch sinnvoll sein, noch Unverstandenes tastend auszuprobieren. Eine meiner Klientinnen war zunächst enttäuscht, dass ich als Verhaltenstherapeut nicht ihre Kindheit aufarbeiten konnte, entschied sich aber doch zu einer Therapie bei mir. Beim erfolgreichen Abschluss fragte ich sie, ob sie noch bedauere, dass wir statt über ihre Kindheit so viel über ihre gegenwärtigen Gedanken und Gefühle gesprochen hatten. „Ich habe nichts von dem erreicht, was ich mir ursprünglich von der Therapie versprochen hatte“, antwortete sie. „Und doch geht es mir heute viel besser.“
Ist eine Therapie schmerzhaft?
Behandlungen sind mit Nebenwirkungen verbunden. Kann, was hilft, einfach nur guttun? Wenn wir uns Placebotabletten anschauen, also Zuckerpillen, die nur so tun, als enthielten sie einen Wirkstoff, dann sind diese oft groß, haben schrille Farben und sind schwer zu schlucken. Der Schmerz scheint zur Heilung dazuzugehören. Manchmal ist das auch in der Psychotherapie so. Wenn ich mit einer Klientin gegen ihre Höhenphobie auf einen Turm klettere, weiß sie bereits, dass sie dort sehr viel Angst erwartet. Das ist dann ein sehr unangenehmes Ereignis, das sich aber langfristig lohnt. Ähnlich sollte es sein, wenn während einer Psychoanalyse schmerzhafte Erinnerungen durchgesprochen werden. Ein guter Therapeut wird solche schmerzhaften Teile der Therapie sorgfältig vorbereiten.
Es wird also in der Therapie nicht immer „schön“ sein. Eine Therapie sollte aber auch nicht nur mühsam sein. Patient und Therapeut sollten sich immer fragen, ob der momentan eingeschlagene Weg der richtige ist. Führt er dazu, dass der Klient den Eltern gegenüber nun selbstbewusster auftreten kann? Oder dass er nun weniger traurig ist als zuvor? Aus der Forschung wissen wir, dass insbesondere auch das Gespräch über Stärken und Erfolge hilfreich ist. Das wirkt wohltuend.
Wann ist eine Therapie zu Ende? Einer meiner Ausbilder riet mir, auf die Frage nach der Behandlungszeit zu antworten, dass bei einer „einfachen Panikstörung“ ohne weitere Probleme die Behandlungszeit zwischen 7 und 70 Stunden liegen werde. Die Behandlungsdauer, wollte er damit sagen, ist je nach Person, Problematik und Umständen sehr unterschiedlich.
Bekommen wir vom Arzt Antibiotika, dann meist mit dem Hinweis, wir sollten die ganze Packung einnehmen. Sonst überleben Reste der Erreger und wir werden wieder krank. Aber im Hinblick auf eine Psychotherapie führt dieses Bild in die Irre. Psychische Probleme sind keine Infektion. Der Entschluss zu einer Therapie entsteht aus dem Gefühl, Hilfe zu brauchen. Warum also sollte über das Ende einer Therapie anders entschieden werden als über ihren Anfang? Den Schluss der Therapie bestimmen meist Klient und Therapeut gemeinsam. Manchmal frage ich meine Klienten direkt: „Was meinen Sie, was sich noch verändern müsste, damit Sie mich nicht mehr brauchen?“
Ein gutes Kriterium dafür, wann eine Therapie beendet werden kann, ist die Remoralisierung des Klienten, also sein Eindruck, die Dinge nun wieder selbst in die Hand nehmen zu können. Am Ende ist das Problem kein Problem mehr; es ist jetzt eine Episode des Lebens unter vielen: Ich habe, als ich nicht mehr weiterwusste, Unterstützung gefunden. Vielleicht ist es auch das, was einen Besuch beim Psychotherapeuten so hilfreich macht: in Zeiten, in denen jeder selbst für sich sorgen soll, die Erfahrung gemacht zu haben, dass man in der Not nicht allein ist.
Thorsten Padberg praktiziert als Psychotherapeut in Berlin. Er ist Co-Moderator des vielgelobten sechsteiligen Podcasts Therapieland bei Deutschlandfunk Kultur.
Die Fotos stammen aus Sebastian Zimmermanns Buch: Fifty Shrinks. Portraits aus New York. W. Kohlhammer, Stuttgart 2019
Zum Weiterlesen
Gitta Jacob: Psychotherapie. Eine Gebrauchsanweisung. Wie Ihre Therapie gelingt. Beltz, Weinheim 2017