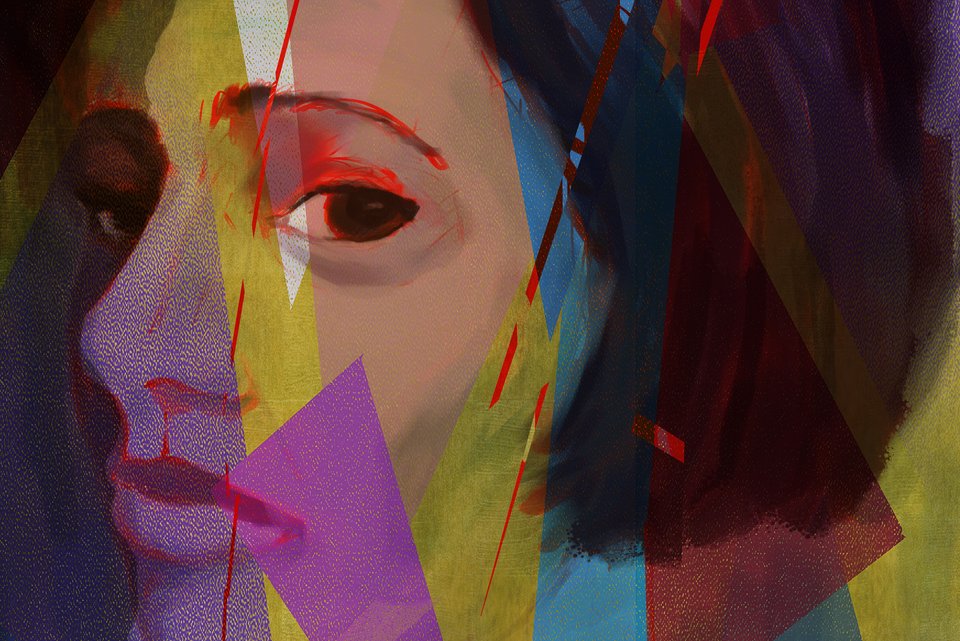Ein Mann mit Schizophrenie lebt in dem Wahn, fasten und wallfahren zu müssen, um für die Sünden der Menschheit zu büßen. Also isst er nicht mehr und wandert. Bereits seit 20 Jahren zirkelt er im Kreis: fasten, wandern, Klinik. Fasten, wandern, Klinik. Psychotherapie, Medikamente und Elektrokonvulsionsbehandlungen verändern daran wenig. Er wird immer wieder über Schläuche ernährt, damit er überlebt, zieht sie aber mehrfach heraus.
Wie gut stehen also die Chancen, dass eine erneute Behandlung in der…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
zieht sie aber mehrfach heraus.
Wie gut stehen also die Chancen, dass eine erneute Behandlung in der Psychiatrie den Mann von seinem Wahn befreit? Wie sinnvoll ist es, diese Prozedur weitere Jahre, vielleicht Jahrzehnte fortzuführen? Und: Möchte der Patient das überhaupt?
Dass psychische Erkrankungen nicht auf Medikamente, Psychotherapie oder andere Behandlungsansätze ansprechen, ist nicht selten. Ein Beispiel: Nach drei Therapieversuchen mit Psychopharmaka haben etwa 15 Prozent aller Menschen mit Depression noch immer keine Linderung ihrer Symptome erfahren. Das ist Lehrbuchwissen. Dass etwa ein Drittel aller Patientinnen und Patienten chronisch erkrankt, ebenfalls. Eine Übersichtsarbeit hat in 2024 offenbart, dass die meisten psychisch Erkrankten nicht ausreichend von Psychotherapie profitieren. In Forschungsarbeiten ist derweil immer öfter die Rede von schweren und schwierig zu behandelnden psychischen Erkrankungen. Es treibt die Fachleute aus Medizin und Psychotherapie um: nicht helfen zu können, wo gerade sie es doch können sollten.
Wenn Heilung nicht gelingt
Bestimmte Diagnosen fallen besonders häufig in diese Kategorie, etwa Schizophrenie, bipolare Störungen oder auch die Essstörung Anorexie. Es handelt sich bei jeder dieser Geschichten um einen einzelnen Fall, aber nicht um Raritäten. Das zeigt auch ein Symposium beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) in Berlin im Jahr 2022. Fast alle der 250 Sitzplätze im Saal sind besetzt. Hier geht es stets um Heilung, neue Therapiewege und moderne Forschungsbefunde. Aber die Startfolie dieses Symposiums ruft: „Unheilbarkeit“. Eine Stimme am Mikro fragt gleich zu Beginn: „Wer von Ihnen kennt mindestens eine Patientin oder einen Patienten, bei denen Sie alles ausprobiert haben, ohne Erfolg, und die so schwer psychisch erkrankt sind, dass weitere Behandlungsversuche kaum erfolgversprechend sind?“ Fast alle melden sich.
Regelmäßig stellt die Psychosomatikerin und Ethikerin Anna Westermair von der Universität Zürich diese Frage bei Vorträgen. „Und immer ist es das gleiche Ergebnis. Die große Mehrheit kennt solche Fälle.“ Schon früh hat Westermair selbst so eine Situation erlebt. Während der Facharztausbildung mit Ende 20 hat sie auf einer Station für Menschen mit schweren Essstörungen gelernt. Eine junge Patientin schwebte aufgrund der Unterernährung in Lebensgefahr. Da sie ihren Gesundheitszustand nicht mehr einschätzen konnte, wurde sie gegen ihren Willen zwangsernährt. „Die subjektive Realität der Frau war, dass sie gefoltert wird. So hat sie es empfunden. Für sie war es nicht ertragbar“, erinnert sich Westermair.
Die Patientin verstarb trotz der Nahrungszufuhr. Was die Ärztin daran vor allem schockierte: „Am Ende kam heraus, dass niemand im Team daran geglaubt hatte, dass die Zwangsernährung überhaupt noch etwas bringen würde.“ Trotzdem sei damals nicht der Gedanke aufgekommen, etwas nicht zu tun. Alle hatten das Gefühl: Ja, es ist eine innere Pflicht, ihr Leben erhalten zu müssen. Um jeden Preis.
In der Psychiatrie genauso wie in der Somatik, wo es um körperliche Erkrankungen geht, kann man Westermair zufolge nie mit Sicherheit sagen, ob jemand nicht mehr heilbar ist. Und trotzdem gebe es diese Fälle, bei denen scheinbar nichts wirke und man nicht mehr wisse, was man noch tun könne. Seit mehreren Jahren erforscht sie nun diese Grenzbereiche und durchdenkt die ethischen Fragen am Institut für biomedizinische Ethik und Geschichte der Medizin der Universität Zürich. Was wäre zum Beispiel gewesen, wenn man bei der Frau mit Anorexie von einer Zwangsernährung abgesehen hätte und stattdessen die Patientin gefragt hätte, was sie sich wünsche? Was ihr jetzt noch guttun würde? Wenn es eh aussichtslos schien, hätte man dann nicht zusehen müssen, dass die Frau in Begleitung einer Pflegekraft noch ein paar Mal ihre Familie zu Hause besuchen kann?
Die palliative Psychiatrie
Westermair hat auch die Geschichte des fastenden und wandernden Mannes gemeinsam mit ihrem Kollegen Manuel Trachsel in einem Forschungsbericht für das Journal of Ethics mit weiteren Fallberichten zusammengetragen. Der Mann ist an seiner Erkrankung verstorben, aber im Rahmen einer palliativen Versorgung. Den Begriff „palliativ“ verbinden die meisten mit Krebserkrankungen und einem unausweichlichen Tod. Ihn in Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen zu bringen bereitet vielen Unbehagen. Tatsächlich hat sich aber in Deutschland und weltweit ein neuer Zweig innerhalb der Medizin entwickelt: die palliative Psychiatrie.
„Ich finde den Begriff sehr demoralisierend“, sagt die Präsidentin der DGPPN Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank. Er impliziere das Wissen, dass bei einer Person die Erkrankung mit 100-prozentiger Sicherheit voranschreiten werde. „Aufzeichnungen aus früheren Jahrzehnten der Psychiatrie haben uns gezeigt, dass spontane Genesungen immer möglich sind.“ Sie selbst gehe deshalb stets hoffnungsvoll an die Behandlung heran, auch bei therapieresistenten und schweren Erkrankungen. Bei dem neuen Zweig schwinge für sie hingegen Hoffnungslosigkeit mit.
Was genau die palliative Psychiatrie umfasst, ist noch nicht ausdiskutiert, zu jung ist das Feld und die Debatte darum. Aber dass es nicht immer um die Versorgung am Lebensende geht, betonen alle, die in diesem Bereich forschen und agieren. „Im Fokus stehen Menschen, bei denen die beste existierende Behandlungsoption nur eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit hat, eine minimale Besserung zu erreichen“, erklärt Anna Westermair.
Krankheit heilen oder Leiden lindern?
Sie und ihre Kollegen fragen: Was können wir machen, wenn wir nichts mehr machen können? Wenn etwa eine Frau mit Anorexie mehrere Dutzend Behandlungen in Kliniken hinter sich hat und zuletzt 140 Tage am Stück im Krankenhaus war, die meiste Zeit auf der Intensivstation. Wenn ein Mann auch nach dem dreißigsten Entzug in die Sucht zurückfällt und mit jedem Mal mehr Boden unter den Füßen verliert. Wenn eine Person mit Schizophrenie stets nach einer halbwegs erfolgreichen Behandlung aus der Klinik kommt, die Medikamente absetzt, erneut in eine heftige Psychose gleitet, aggressiv ist und deshalb mehrfach im Gefängnis landet. Wenn jemand trotz Medikamenten, Psychotherapie und Klinikaufenthalt mit den Jahren zunehmend kränker wird.
Durch die Brille der palliativen Psychiatrie gesehen, ist in sehr aussichtslosen Fällen nicht mehr die Heilung das oberste Ziel, sondern die Lebensqualität, und zwar im Jetzt und Hier. Die Grundhaltung: Akzeptieren, dass eine schwere Erkrankung nicht therapierbar sein kann. Um dann nach anderen Wegen Ausschau zu halten – und den Menschen, den es betrifft, zu fragen, was er braucht und sich wünscht.
„Dass man das Therapieziel wechselt, ist nicht besonders oder neu“, sagt die DGPPN-Präsidentin Gouzoulis-Mayfrank. Es gehöre zur guten klinischen Praxis dazu, alles anzubieten, was es gibt, und wenn nichts hilft, das Ziel zu ändern. „Statt einer fünffachen Medikation schauen wir dann, wie ich die Person dabei unterstützen kann, zu akzeptieren, dass eine Erkrankung Restsymptome hinterlässt.“ Es gebe diese Fälle, wo man ohne Erfolg alles ausprobiert habe, dann seien diese aber trotzdem nicht palliativ. „Das hat die Konnotation, als ob eine psychische Erkrankung unweigerlich zum Tod führt.“
Manuel Trachsel, Professor für Bio- und Medizinethik an der Universität Basel, sagt hingegen: „Viele gängige Interventionen in der Psychiatrie können als palliativ bezeichnet werden.“ Ihm zufolge zielen zahlreiche Behandlungen direkt darauf ab, das Leiden zu lindern, anstatt die zugrunde liegende Krankheit zu heilen. Ein Beispiel sei die Substitutionsbehandlung bei Menschen mit Heroinabhängigkeit. Das Ziel davon ist nicht, die Sucht zu heilen, sondern über eine gezielte Abgabe von Substanzen Entzugssymptome zu lindern und die Menschen an einem geregelten Alltag teilhaben zu lassen.
Der Elefant im Raum, über den keiner sprechen will
Es scheint ein Ringen um Begrifflichkeiten. Palliativ, aussichtslos, unheilbar, therapieresistent, chronisch. Je nach Wortwahl schwingt etwas anderes mit, aber im Kern haben die Begriffe viel gemeinsam, nämlich dass es nicht so weitergeht. Und bei all dem steht sehr wohl ein Elefant im Raum, über den keiner sprechen möchte: der Tod. Psychische Erkrankungen sind nicht per se tödlich, und doch dokumentieren Forschende immer wieder Patientengeschichten aus der Psychiatrie, die tödlich enden. Sie sind quasi der Kern des neuen Zweiges. Denn zu akzeptieren, dass etwas nicht besser wird, und auf konventionelle Therapiewege zu verzichten heißt manchmal auch, das Risiko einzugehen, dass ein Mensch dann verstirbt.
Auf das Verhältnis von Nutzen und Schaden kommt es an, betont Anna Westermair. „Je länger jemand Symptome zeigt und umso öfter Behandlungsversuche scheitern, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Therapieversuch Krankheitsanzeichen senkt. Solche Patienten sprechen auch immer weniger auf die Medikamente an, es werden dann eher Versuche unternommen, für die es wenig bis keine Evidenz gibt. Dazu kommen oft neue oder immer mehr unerwünschte Nebenwirkungen auf körperlicher und auch psychischer Ebene – und irgendwann kippt es“, sagt sie. Die negativen Effekte der Behandlung überwiegen die potenzielle Heilsamkeit. Der Patient leidet unter Krankheit und Behandlung. Warum dann also so weitermachen?
Kritische Stimmen stellen ihrerseits ebenso ethischen Fragen: Reduziert man wirklich den Schaden, wenn am Ende der Tod steht? Und spielt die palliative Haltung nicht der Erkrankung in die Hände? Spricht dann aus dem Patienten wirklich sein Wille oder ist es Teil der Erkrankung, wenn die Person trotz lebensgefährlichem Untergewicht eine künstliche Ernährung ablehnt? Ist es die Patientin oder die Depression, die keinen weiteren Therapieversuch mehr möchte?
Schutz vor aggressiver Behandlung
Diese Fragen treiben auch Sarah Kayser um. Die Psychiaterin und Neurologin forscht am Universitätsklinikum Tübingen im Bereich palliative Psychiatrie. Für sie ist es eher eine Haltung, die sie und ihre Mitstreiter innerhalb des Faches Psychiatrie einnehmen – es geht ihr nicht um Richtig oder Falsch. Kolleginnen und Kollegen begegnen ihr meist mit Erstaunen, mitunter mit Unverständnis, wenn sie von ihrem Forschungsinteresse erzählt. „In der Psychiatrie darf nicht gestorben werden. Palliativ und Psychiatrie ist für manche wie die ‚vegetarische Wurst‘. Das passt für sie nicht zusammen“, sagt sie. Warum, da könne sie auch nur mutmaßen. Todesfälle im Zusammenhang mit seelischen Leiden seien oft Suizide und die gelten als psychiatrischer Notfall, nicht als hinnehmbar. In der Nazizeit wurden zudem viele Menschen mit psychischen Behinderungen oder Erkrankungen ermordet. Und schließlich gebe es die große Angst vieler Ärztinnen, aufzugeben.
Kayser selbst arbeitet auf einer gerontopsychiatrischen Station, also mit betagten psychisch erkrankten Menschen, die dort auch sterben dürfen. Sie hat eine Zusatzqualifi-kation für Palliativmedizin erworben und wünscht sich mehr Offenheit von ihren Kolleginnen und Kollegen. Ihre Erfahrung ist, dass die Patientinnen merken, wenn man ihnen etwas vormacht. „Wenn ich keine Hoffnung mehr habe, sollte ich das auch mit ihnen besprechen“, sagt sie.
Die Realität in den Kliniken ist aber eine andere. Die Philosophin Natalie Dorfman von der University of Washington hat gemeinsam mit einem Psychologieteam eine Umfrage unter 212 Psychiaterinnen und Psychiatern in den USA durchgeführt. Sie legten den Teilnehmenden zwei Fallberichte von Menschen mit sehr schwerer Depression oder einer schweren Borderlinepersönlichkeitsstörung vor, bei denen sämtliche bisherigen Behandlungsversuche fehlgeschlagen waren. Ihnen wurden dann verschiedene Behandlungsoptionen vorgeschlagen und gefragt, welche davon sie jetzt anwenden würden – und ob sie daran glaubten, dass diese Interventionen überhaupt etwas bringen würden. Die große Mehrheit der Teilnehmenden wollte eine der Optionen ausprobieren, doch nur die wenigsten hatten noch die Hoffnung auf einen Behandlungserfolg.
„Für mich ist palliative Versorgung in der Psychiatrie vor allem der Schutz vor einer aggressiven Behandlung“, sagt Sarah Kayser, die Psychiaterin und Neurologin. In der Medizin herrsche ein großer Druck, noch dies oder das oder jenes zu versuchen. Nicht immer entspricht das dem Willen des Patienten, also finden Behandlungen teilweise auch unter Zwang statt.
„Sie hatte noch zehn gute Monate“
Die Forscherin Westermair aus Zürich hat im Rahmen der Facharztausbildung auch eine Zeitlang auf einer Palliativstation gearbeitet, also mit Menschen, die aufgrund einer körperlichen Erkrankung im Sterben lagen. Sie sagt: „Als ich nach diesen Monaten zurück in der Psychiatrie war, habe ich gemerkt, wie viel leichter und besser ich mich dort um sehr schwer erkrankte Patientinnen kümmern konnte. Ich habe gelernt, meine Ohnmacht auszuhalten.“
Die junge Psychiaterin hat die Hoffnung, dass mit der Diskussion um Aussichtslosigkeit und palliative Versorgung neue Denkräume aufgestoßen werden. „In der Somatik haben die Kollegen bereits für viele Situationen einen Plan F. Sie sind routiniert darin zu erkennen, wenn alles, was auf Heilung abzielt, nichts bringt, wenn Patienten eine Behandlung nicht mehr wollen oder die Nebenwirkungen für sie nicht akzeptabel sind“, sagt sie. Natürlich: Feste Abläufe werde es dafür nie geben, dafür seien die Fälle zu individuell, aber wenigstens der Blick könne sich doch weiten.
Es brauche kreative Herangehensweisen – und dennoch Stringenz. Westermair empfiehlt zum Beispiel in solchen kritischen Fällen immer, die Meinung von zwei weiteren Fachleuten hinzuzuziehen, bevor man die palliative Richtung einschlägt. Denn: Ja, es gibt spontane Heilungen. Genauso kann es sein, dass die vorherige Behandlung Lücken aufwies.Im Fachjargon spricht man von Pseudoresistenzen, also von Erkrankungen, die scheinbar auf keine Behandlung ansprechen, während die Ursachen dafür aber ganz andere sind. So kann es sein, dass die bisherige Therapie nicht der Leitlinie entsprach, also nicht das optimale Medikament gegeben wurde oder zu wenig oder keine passende Psychotherapie zum Einsatz kam oder die Diagnose schlicht nicht zutraf.
Wenn selbst das Optimum an Behandlung nicht anspricht
„Aber es wird immer Menschen geben, deren Erkrankung trotz korrekter Diagnose und leitliniengerechter Behandlung, also dem Optimum nicht auf die Behandlung anspricht“, sagt Westermair. Sie sieht es so, wie die kritischen Stimmen ihrer Forschungsrichtung: Desto weniger Menschen eine palliative Versorgung in der Psychiatrie benötigen, umso besser. Dennoch werde es immer diese sehr harten klinischen Fälle geben.
Die meisten davon bewegen die Ärztin sehr. Wie der von der Frau, die zuletzt mit einem Body-Mass-Index unter 10 zu ihr in die Klinik kam. Ab einem Index von 16 spricht man von ausgeprägtem Untergewicht. Die Frau litt seit knapp 30 Jahren an Magersucht, wurde bereits mehrfach künstlich ernährt, beim letzten Mal 14 Monate am Stück, dreimal täglich, festgeschnallt am Bett. Durch die Behandlung nahm sie kurzzeitig immer zu, brach dann aber nach der Entlassung jedes Mal den Kontakt zur Klinik ab, statt ambulant in einer Psychotherapie zu bleiben.
Bei diesem Mal hat sie also einen BMI von 9,8. Sie sagt, sie will leben, aber keine Zwangsernährung mehr. Sie ist zermürbt und erschöpft von der Erkrankung. Sie sagt: „Ich kann es noch ein einziges Mal versuchen, aber nur wenn ich nicht zwangsernährt werde, falls ich es nicht schaffe, zuzunehmen.“ Die Behandelnden haben den Eindruck, dass die Patientin gut versteht, wie es um sie steht und was die Entscheidung bedeutet. Sie machen einen Deal mit ihr: „Sie gibt noch einmal alles, was sie kann, und wir lassen sie gehen, falls sie es nicht schafft“, erzählt Anna Westermair und hält inne.
Tatsächlich legt die Patientin in diesem einen letzten Versuch an Gewicht zu, erreicht einen BMI von 12,5 und wird gegen den ärztlichen Rat aus der Klinik entlassen. Ihr Vater wird später sagen: „Sie hatte noch zehn gute Monate.“ Dann kommt sie wieder in die Klinik, hat zu viel Gewicht verloren. Doch der Deal steht. Sie wird palliativ versorgt: kein Wiegen mehr, keine Ernährung durch Schläuche, aber wenn sie möchte normale Lebensmittel. Keine unnötigen Medikamente, nur Mittel gegen Schmerzen. Falls die Frau doch umschwenkt, sind alle bereit, ihr Leben zu retten. Doch die Frau verstirbt.
Vielleicht wäre sie auch ohne diese Vereinbarung irgendwann an der schweren Erkrankung verstorben. Doch wohl nur auf diesem Weg hatte sie zum ersten Mal seit langem wieder Zuversicht – und noch mal etwas vom Leben.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback! Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.
Quellen
Awais Aftab: What should clinicians know about palliative psychopharmacology? AMA Journal of Ethics, 9/25, 2023, E710-717
Michael Bauer u.a.: Akute und therapieresistente Depressionen. Pharmakotherapie - Psychotherapie - Innovationen. Springer Nature 2005 (2. Auflage)
Courtney Bergan: The right to choose and refuse mental health care: A human rights based approach to ending compulsory psychiatric intervention. Journal of Health Care Law and Policy, 1/27, 2024, 49-106
Edwin Birch u.a.: Harm reduction in severe and long-standing anorexia nervosa – part of the journey but not the destination. A narrative review with lived experience. Journal of Eating Disorders, 1/12, 2024
Manfred Gerlach u.a.: Nationale VersorgungLeitlinie Unipolare Depression. Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin, 2022
Pim Cuijpers u.a.: Absolute and relative outcomes of psychotherapies for eight mental disorders: a systematic review and meta-analysis. World Psychiatry, 2/23, 2024, 267-275
Natalie Dorfman u.a.: What do psychiatrists think about caring for patients who have extremely treatment-refractory illness? AJOB Neuroscience, 1/15, 2024, 51-58
Junona Elgudin u.a.: Palliative Psychiatry for a patient with treatment-refractory schizophrenia and severe chronic malignant catatonia: case report. Annals of Palliative Medicine, 2/13, 2024, 433-439
Brent Kious u.a.: Does it matter whether a psychiatric intervention is „palliative“? AMA Journal of Ethics, 9/25, 2023, E655-660
Daniel Rosenbaum u.a.: Psychiatric Futility and Palliative Care for a Patient With Clozapine-resistant Schizophrenia. Journal of Psychiatric Practice 4/28, 2022, 344-348
Nicolas Trad: According to which health outcomes measures should palliative psychiatric prognosis, progress and success be defined? AMA Journal of Ethics, 9/25, 2023, E684-689
Anna Lisa Westermair u.a.: Scoping review of end-of-life care for persons with anorexia nervosa. Annals of Palliative Medicine, 13/3, 2024, 685-707
Anna Lisa Westermair und Manuel Trachsel: Moral intuitions about futility as prompts for evaluating goals in mental health care. AMA Journal of Ethics, 9/25, 2023, E690-702
Hanna Whitaker: Should patients be allowed to die from anorexia? New York Times, 3. Januar 2024