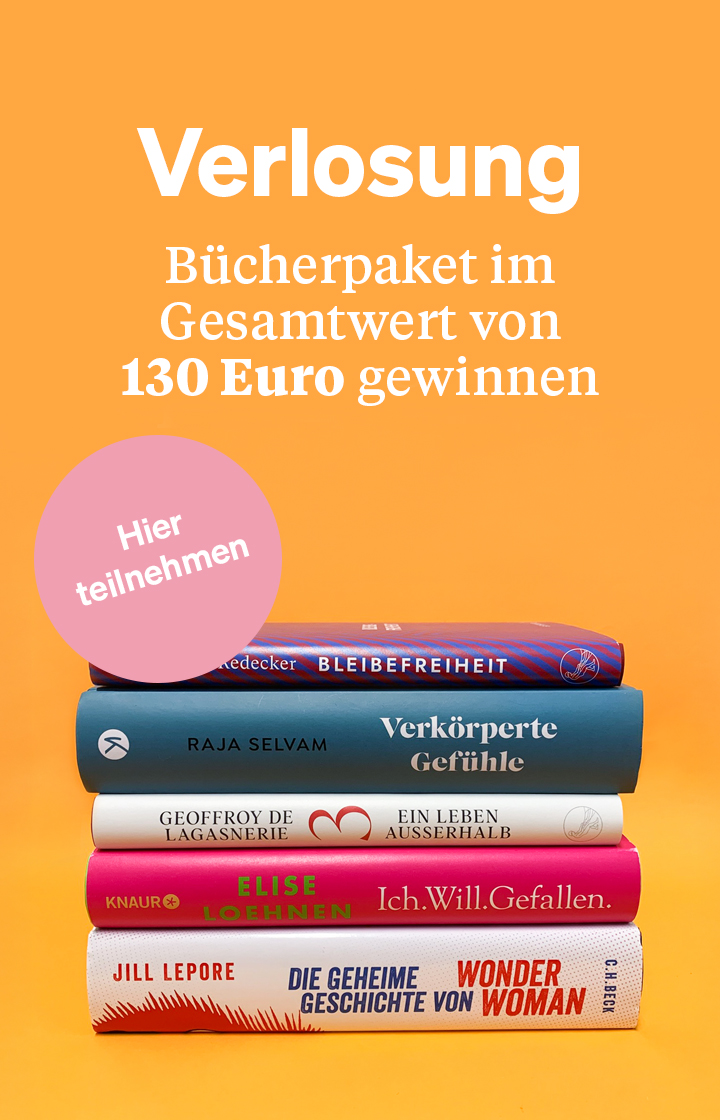Geschichten sind wichtig. Aus ihnen lernen Schülerinnen und Schüler etwas über die Welt, die Komplexität von Beziehungen, die Bandbreite von Emotionen und das Verständnis des Selbst. Von Volksmärchen bis hin zu Romanen spielen Erzählungen in Kulturen auf der ganzen Welt eine wesentliche Rolle. Wie Aristoteles betonte, können sie uns (anders als reine Chroniken) helfen zu verstehen, wie Dinge miteinander verbunden sind und wie die Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung aussehen. Die Philosophin Martha Nussbaum argumentiert, dass Geschichten uns helfen, moralisch sensibler und verantwortlicher für unsere Handlungen und unseren Umgang miteinander zu werden.
Geschichten waren auch das Herzstück wichtiger sozialer Bewegungen. Martin Luther Kings berühmte Rede von 1963 entwarf eine alternative Erzählung zur Realität, in der das Leben der Schwarzen in den USA unterdrückt wurde. Aber Geschichten können auch eine korrumpierende Wirkung haben und werden genutzt, um bestimmte Gruppen zu unterdrücken. In der Incel-Bewegung beispielsweise dominieren Erzählungen, in denen Frauen zu viel Macht über Männer haben. In der Realität hingegen genießen Männer weiterhin viele Privilegien. Hier entfernen die Narrative die Menschen von der Wahrheit.
Es reicht also nicht, Geschichten zu haben. Sicherlich können sie die Wirklichkeit reflektieren und aufzeigen, wie sie vielleicht sein sollte. Aber wie erkennen wir gute und schlechte Geschichten? Eine aktuelle Studie zeigt, dass Erzählungen selten die Macht haben, unsere tiefen Überzeugungen und Einstellungen zu ändern. Sie können aber bereits vorhandene Vorurteile verstärken. Ob wir eine Geschichte als realitätsgetreu bewerten oder nicht, hängt davon ab, wie sie zu unserem bereits vorhandenen Verständnis der Welt, unserer Denkweise und unseren kognitiven Verzerrungen passt und weniger von ihrem tatsächlichen Wahrheitsgehalt.
Eine kritische Position einnehmen
Was können wir tun? Die Antwort ist zweigeteilt: Einerseits müssen wir uns mit vielen verschiedenen Erzählungen auseinandersetzen, damit wir uns stets im Klaren darüber sind, dass es noch andere gibt. Aber um eine kritische Position gegenüber Geschichten einzunehmen und die Kontrolle über unsere Überzeugungen zu erlangen, müssen wir uns auch mit nichtnarrativen Werken von der Poesie bis zur Malerei beschäftigen. Solche Kunstwerke machen uns darauf aufmerksam, wie verschieden Sichtweisen sein können und wie sie unsere Erfahrungen, den Bedeutungsgehalt und die Entstehung von Erzählungen prägen.
Bedeutet das, dass wir auf Geschichten verzichten müssen? Anstatt sie als Wissensquelle zu sehen, sollten wir sie dafür wertschätzen, wie viele Facetten der Fantasie sie beschreiben. Geschichten bereichern unsere Sprache, helfen uns, menschliche Charaktere, ihre Motivationen und Sichtweisen zu erforschen und zu verstehen, wie komplex das Leben sein kann. Mit der Hilfe von Erzählungen können wir die Möglichkeiten der Imagination erforschen und sorgfältig bewerten. Aber wir müssen uns vor der Simplifizierung hüten, dass Geschichten uns etwas über die Wirklichkeit beibringen.
Karen Simecek ist außerordentliche Professorin für Philosophie an der Universität Warwick in Großbritannien.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!
Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an:redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.