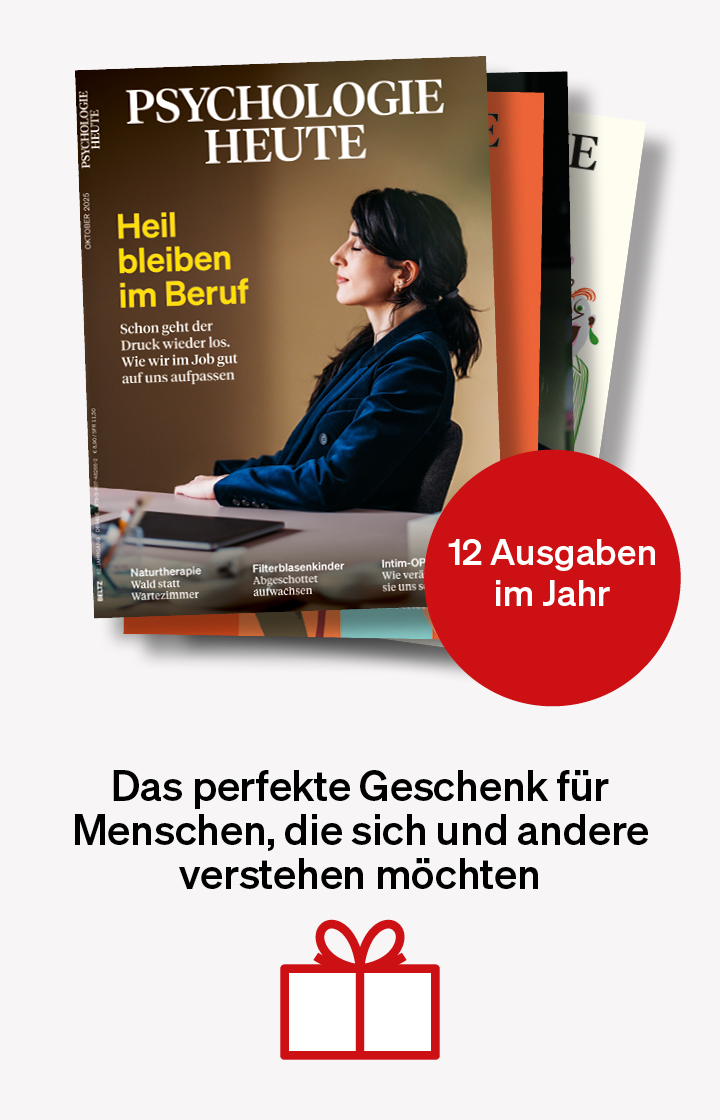„Lange Zeit hatte man angenommen, dass es mit dem Alter bergab geht – und zwar in allen möglichen Lebensbereichen“, berichtet die Psychologin Claudia Haase von der Northwestern University. „Die Realität aber sieht anders aus, gerade was den Umgang mit Gefühlen angeht.“ Das Klischee von den griesgrämigen Alten ist von der Forschung längst widerlegt. Ältere Menschen sind im Vergleich zu jüngeren sogar eher heiteren Mutes, es geht ihnen emotional besser. Allerdings sind sie auch stärker genau darauf angewiesen, denn mit fortschreitendem Alter spielen Emotionen und der Umgang mit ihnen eine immer wichtigere Rolle für die Gesundheit und die geistige Fitness. Das ist der Tenor vier neuer Studien, die auf dem 53. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Wien vorgestellt wurden.
1 Gefühle und Körper
Das emotionale und körperliche Wohlbefinden sind wechselseitig miteinander verschränkt – und zwar bei älteren Menschen deutlich stärker als bei jüngeren. Das fand ein Team der Universitäten Jena, Leipzig und Heidelberg sowie der Colorado State University in einer Längsschnittstudie heraus. Antje Rauers und ihre Mitforschenden baten 398 Personen im Alter zwischen 12 und 90 Jahren, an 54 zufällig ausgewählten Zeitpunkten in ihrem Alltag jeweils kurz zu notieren, wie sie sich erstens emotional und zweitens körperlich in diesem Augenblick gerade fühlten. Auch wie es generell um ihre physische Gesundheit stand, wurde erfasst. Zweieinhalb Jahre später wiederholten Rauers und ihr Team das gesamte Prozedere.
Es stellte sich heraus: Die körperliche Gesundheit einer Person erlaubte Vorhersagen, wie gut sie sich einige Stunden später und sogar nach mehr als zwei Jahren emotional fühlen würde. Das galt auch umgekehrt: Emotionale Zufriedenheit war mit physischem Wohlbefinden einige Stunden später verbunden. Und: Die emotionale Zufriedenheit einer Person war ein Hinweis auf ihren subjektiven und objektiven Gesundheitszustand zweieinhalb Jahre später. Beides galt für ältere Menschen stärker als für jüngere. Gefühle haben also mit zunehmendem Alter einen immer stärkeren Einfluss auf die Gesundheit. Eine denkbare Erklärung: Ältere Menschen, die sich emotional gut fühlen, verhalten sich womöglich gesundheitsbewusster, bewegen sich zum Beispiel mehr als oft niedergeschlagene Menschen.
2 Aktivität und Gefühle
Überhaupt ist es im fortgeschrittenen Alter eine gute stimmungsaufhellende Medizin, etwas zu unternehmen, am besten mit anderen Menschen – etwa gemeinsam zu wandern oder zu kochen oder mit den Enkeln zu spielen. Ein Team um Christina Röcke von der Universität Zürich verfolgte über eine Woche hinweg, was 241 Freiwillige im Alter zwischen 56 und 88 Jahren gerade taten und wie sie sich dabei fühlten. Es zeigte sich: Gemeinsame Freizeitaktivitäten waren nicht nur für das Gefühlsleben, sondern auch für den Geist anregend: Wer sich sozial auf Trab gehalten hatte, schnitt einige Stunden später in einem Gedächtnistest besser ab. Dabei erwies es sich sogar als günstig, wenn die Betreffenden von dem, was sie da in ihrer Freizeit unternahmen, so stark gefordert waren, dass sich in ihren Speichelproben später eine erhöhte Dosis Kortisol angesammelt hatte. Kortisol gilt zwar als „Stresshormon“, wirkt aber eher mobilmachend, wenn es nur auf Zeit und nicht dauerhaft ausgeschüttet wird.
3 Nachhall von Gefühlen
Allerdings wirken auch belastende Gefühle bei älteren Menschen länger nach, wie die Psychologin Olga Klimecki von der Universität Jena beobachtete. Mit ihren Mitforschenden aus der Schweiz, Frankreich und England zeigte sie in zwei Experimenten insgesamt 182 älteren und jüngeren Freiwilligen Videoszenen, die von Verletzung und Leid erzählten – etwa eine weinende, von Staub bedeckte junge Frau nach einem Erdbeben, ein humpelndes Kind mit verletztem Bein oder eine ältere Frau, die auf dem Weg zum Krankenbett von einer jüngeren gestützt wird.
Anschließend beobachteten die Forschenden mit einem Hirnscanner, welche Spuren die bedrückenden Szenen hinterlassen hatten. Sie registrierten vor allem bei den älteren und nicht so sehr bei den jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen verstärkten Austausch zwischen der Amygdala – einer wichtigen Gefühlschaltstelle des Gehirns – und dem hinteren cingulären Kortex. Diese Hirnaktivität fiel besonders stark bei denjenigen älteren Personen aus, die von den Szenen emotional stark berührt worden waren, und sie ging mit Angst und Grübeln einher. Offenbar ließ das Gesehene diese älteren Menschen nicht los, es arbeitete noch immer in ihnen. Das wirft die Frage auf: Wenn älteren Menschen Trauriges so nahegeht, wie ist es dann möglich, dass sie laut ihren Selbstauskünften – auch in dieser Studie – generell eher von heiteren als von schwermütigen Gefühlen heimgesucht werden?
4 Akzeptanz von Gefühlen
Eine mögliche Erklärung liefert eine Studie, die Claudia Haase mit ihrem Team an der Northwestern University unternahm. Auch hier sahen die 129 Freiwilligen im Alter zwischen 64 und 83 Jahren Szenen aus Filmen wie Titanic oder The Champ, die von Verlust und Trauer handelten. Ein Teil der Versuchspersonen schaute einfach nur zu, die anderen wurden gebeten, während der Vorführung eine Strategie zur Emotionsregulation einzusetzen. Die einen sollten es mit positiver Neubewertung versuchen, also die positiven Aspekte des Gesehenen hervorheben und „negative Emotionen“ vermeiden. Andere setzten die Technik der Distanzierung ein, bemühten sich also, die Szene von einer neutralen Warte aus zu verfolgen, ohne sich emotional vereinnahmen zu lassen. Die letzte Gruppe hingegen praktizierte Akzeptanz: Gefühle zulassen, wie sie kommen, ohne gegen sie anzukämpfen.
Akzeptanz erwies sich als die erfolgreichste Strategie: Mit dieser Methode kamen die Betreffenden nach eigener Einschätzung am besten mit dem Gesehenen klar. Mehr noch: Diejenigen älteren Menschen, die es sich in ihrem Leben zur Gewohnheit gemacht hatten, auch traurige Gefühle anzunehmen, statt bloß die angenehmen Emotionen zuzulassen, waren generell weniger ängstlich und depressiv. Und sie zeigten eine höhere „Herzratenvariabilität“, ein physiologischer Indikator für einen gelassenen Umgang mit Stress.
Ältere Menschen lassen also auch die weniger angenehmen unter den Emotionen an sich heran. Vielleicht arbeiten diese Emotionen auch deshalb – siehe Punkt drei – für eine Weile in ihnen nach. Auf lange Sicht ermöglicht aber womöglich gerade diese Akzeptanz der trüben Gefühle, sie später auch wieder ziehen zu lassen.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!
Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an:redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.